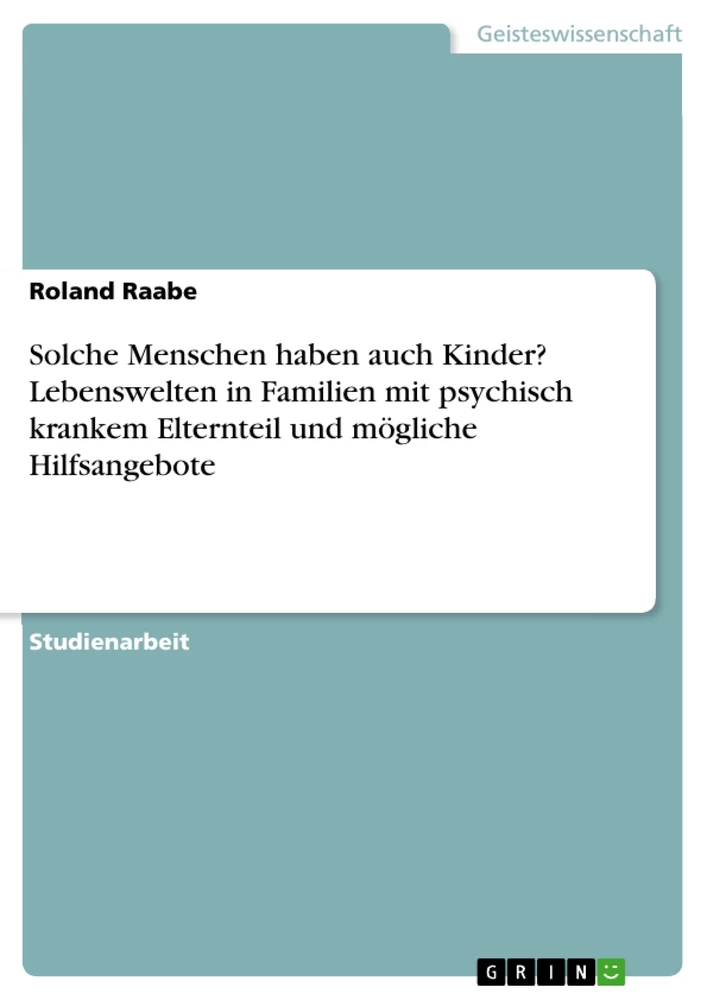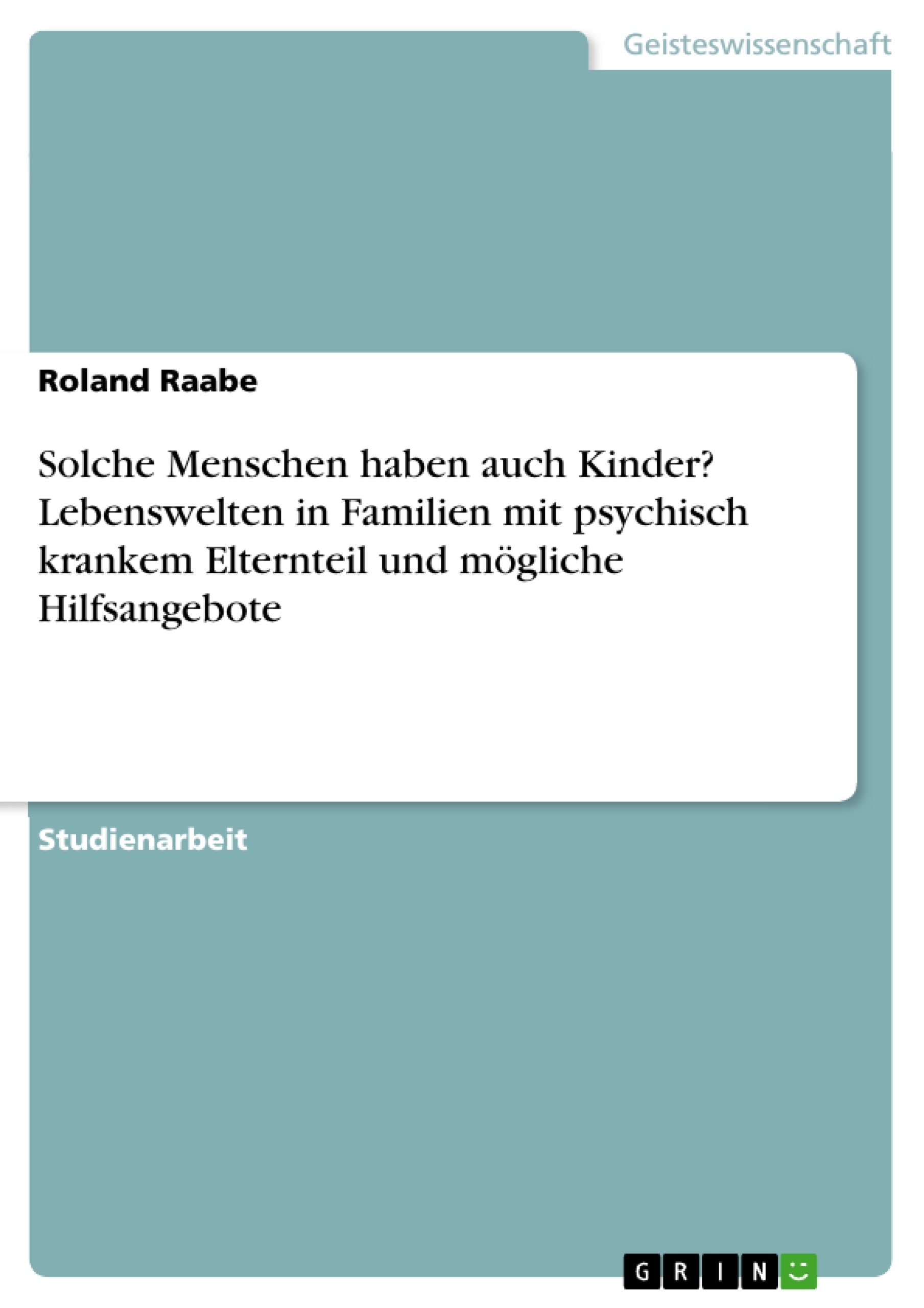Der Titel dieser Arbeit lautet „Solche Menschen haben auch Kinder?“. Hiermit soll der Umstand angesprochen werden, dass die Thematisierung psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit immer noch ein Tabu darstellt und diese Art von Krankheit mit vielen Vorurteilen beladen ist. Vor allem aber die Tatsache, dass ein solcher Krankheitsfall natürlich auch in Familien auftreten kann und die Kinder dieser Familien als kleine Angehörige mitbelastet sind, blieb sogar in der Fachwelt lange Zeit unbeachtet. Doch die geschätzte Zahl von 200000 - 500000 minderjährigen Kindern in Deutschland, die mindestens einen psychisch kranken Elternteil haben (Schizophrenie oder depressive Erkrankungen, andere bilden die wahrscheinlich hohe Dunkelziffer) (Schone / Wagenblass, 2001), spricht nicht von einer zu vernachlässigen kleinen Gruppe oder einer sozialen Randerscheinung und zeigt auf, wie wichtig es ist, dass diesem Thema Beachtung geschenkt wird.
Wie gestalten sich also die Lebenswelten in diesen Familien, welche Schwierigkeiten haben sie zu bewältigen und welche Risiken zeichnen sich hier für die Kinder ab? Um diese Fragen zu klären, wird im ersten Teil dieser Arbeit zunächst die Situation der Familienmitglieder dargestellt, wobei der Schwerpunkt allerdings bei den Kindern liegen soll. Desweiteren werden die Risiken für die kindliche Entwicklung erläutert, um dann auf die rechtlichen Aspekte bezüglich des Sorgerechts und des Kindeswohls einzugehen. Im zweiten Teil sollen dann Hilfsangebote aus verschiedenen Bereichen vorgestellt werden, die Familien mit psychisch krankem Elternteil bei der Bewältigung der zuvor dargelegten Hindernisse unterstützen können.
Roland Raabe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil: Familiensituation und Risiken für die kindliche Entwicklung
- Psychische Erkrankungen als Familienerkrankungen
- Die Situation der Eltern
- Die Situation der Kinder
- „High-Risk-Forschung“ bezüglich der Risiken für die psychische Entwicklung der Kinder
- Die Sorgerechtsfrage
- Psychische Erkrankungen als Familienerkrankungen
- Zweiter Teil: Präventive Hilfsangebote für Familien mit psychisch krankem Elternteil
- Das Präventionsprojekt KIPKEL e.V. im Kreis Mettmann
- Vorbereitungsphase und Finanzierung des Projektes
- Die Annäherung an die betroffenen Familien
- Der Arbeitsprozess
- Die Mutter-Kind-Wohneinrichtung „Die Brücke“ e.V
- Erster Kontakt und Aufnahme
- Der Arbeitsprozess
- Stationäre Betreuung von Mutter und Kind
- Das Präventionsprojekt KIPKEL e.V. im Kreis Mettmann
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Solche Menschen haben auch Kinder?“ befasst sich mit der Tabuisierung psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit und ihren Auswirkungen auf Familien, insbesondere Kinder. Die Arbeit untersucht die Lebenswelten in Familien mit psychisch kranken Elternteilen und analysiert die damit verbundenen Herausforderungen und Risiken für die kindliche Entwicklung. Des Weiteren werden präventive Hilfsangebote für diese Familien vorgestellt.
- Psychische Erkrankungen als familiäre Belastung und ihre Auswirkungen auf das Familiensystem
- Risiken für die psychische Entwicklung von Kindern in Familien mit psychisch kranken Elternteilen
- Rechtliche Aspekte bezüglich Sorgerecht und Kindeswohl
- Präventive Hilfsangebote für Familien mit psychisch kranken Elternteilen
- Vorstellung verschiedener Hilfsprojekte und -einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Tabuisierung von psychischen Erkrankungen und die besondere Belastung von Kindern in Familien mit psychisch kranken Elternteilen. Der erste Teil der Arbeit fokussiert auf die Familiensituation und die Risiken für die kindliche Entwicklung. Hierbei werden die Belastungen der Eltern, die Situation der Kinder und die „High-Risk-Forschung“ bezüglich der Risiken für die kindliche Entwicklung behandelt. Des Weiteren wird auf die Sorgerechtsfrage eingegangen. Der zweite Teil der Arbeit stellt präventive Hilfsangebote für Familien mit psychisch krankem Elternteil vor. Der Schwerpunkt liegt auf dem Präventionsprojekt KIPKEL e.V. im Kreis Mettmann und der Mutter-Kind-Wohneinrichtung „Die Brücke“ e.V.
Schlüsselwörter
Psychische Erkrankungen, Familiensystem, Risiken für die kindliche Entwicklung, Sorgerecht, Kindeswohl, Präventionsarbeit, Hilfsangebote, Familien mit psychisch krankem Elternteil, KIPKEL e.V., „Die Brücke“ e.V.
- Quote paper
- Roland Raabe (Author), 2006, Solche Menschen haben auch Kinder? Lebenswelten in Familien mit psychisch krankem Elternteil und mögliche Hilfsangebote, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62661