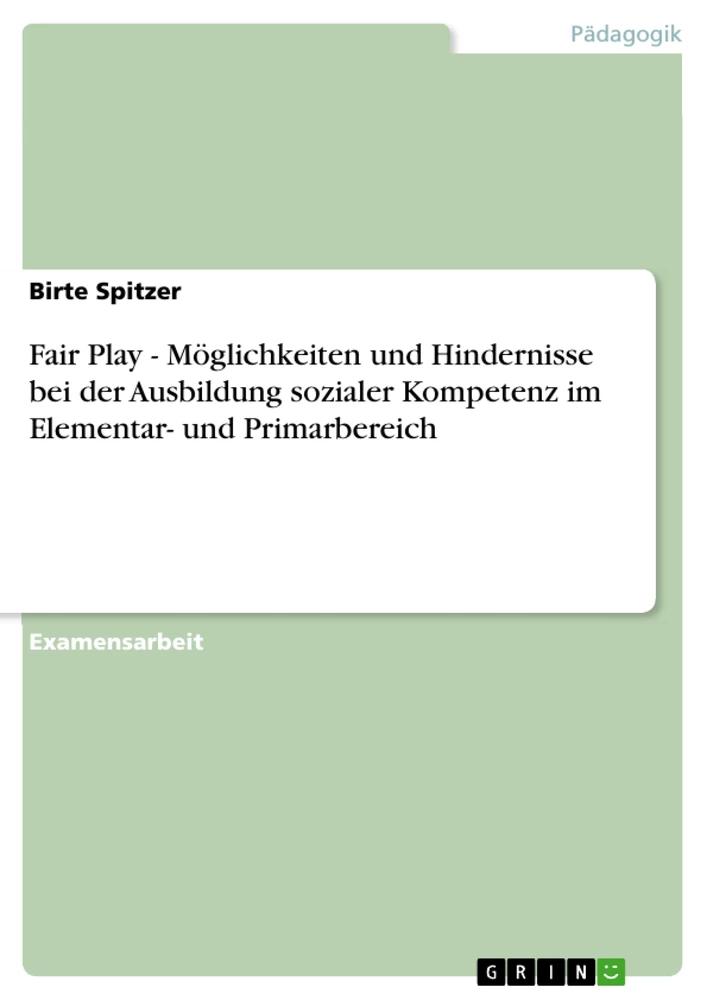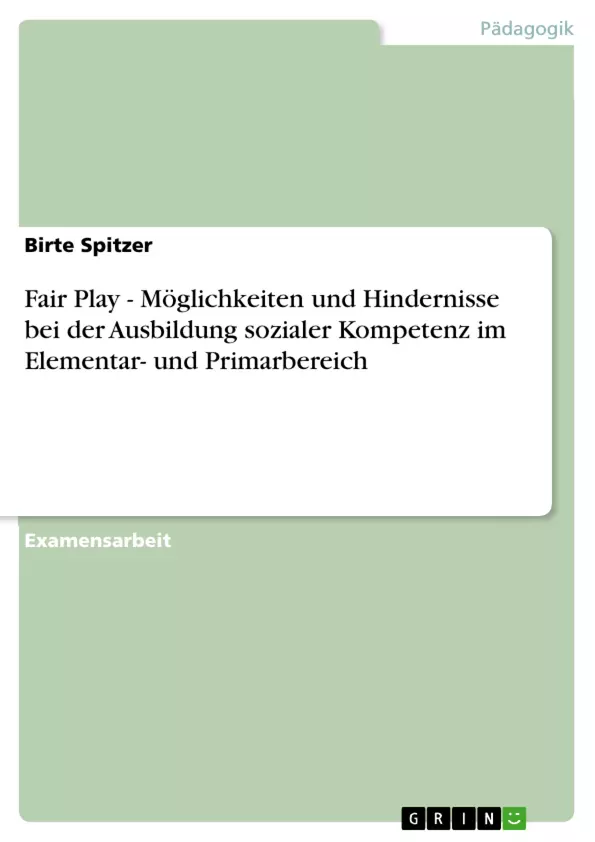„Fair Play“ - was bedeutet das überhaupt? Da sich meine Examensarbeit auf soziales Lernen im Elementar- und Primarbereich konzentriert, halte ich es für wichtig, die Kinder selbst zu Wort kommen zu lassen. In Anlehnung an die Überschrift dieser Arbeit habe ich Kinder zweier Grundschulen gebeten aufzuschreiben, was für sie „fair“ bedeutet. Die Kinder der vierten Klasse finden es fair, wenn Dinge oder Aufgaben gleich aufgeteilt werden und man einander hilft. Unfair hingegen wäre es, jemanden zu ärgern oder sogar zu schlagen, schlecht über andere zu reden oder nicht mitspielen zu dürfen. So schreibt ein Mädchen (10 Jahre) beispielsweise:„Ich finde es gerecht, dass man anderen hilft. Ich finde es nicht fair, wenn man über seine beste Freundin lästert. Ich finde es fair, wenn man teilt. Es ist nicht gerecht, wenn man bei einem Spiel schummelt“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Veränderte Kindheit
- Veränderungen in der Familie
- Veränderungen im Erziehungsverhalten
- Veränderungen im Spiel- und Freizeitverhalten
- Veränderungen in der Medienwelt
- Fazit
- Soziales Lernen
- Definitionen
- Die Entwicklung sozialer Kompetenz in den unterschiedlichen Institutionen
- Familie
- Kindergarten
- Grundschule
- Fazit
- Soziales Lernen in der Grundschule: Wege zur Selbst- und Mitbestimmung
- Demokratisierung am Beispiel Klassenrat
- Rituale im Unterrichtsalltag der Grundschule
- Zukunftswerkstatt - Problemlösen durch Eigeninitiative
- Fazit
- Die Bedeutung des Schulsports in der Grundschule für das soziale Lernen und die Ausbildung von „Fair Play“
- Regeln und Fairness – ihre Bedeutung für den Sport und für ein soziales Miteinander im Alltag
- Exkurs: Ringen und Kämpfen im Sportunterricht der Grundschule – ein Beitrag zu Vertrauen, Moral und Gewaltprävention
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Förderung sozialer Kompetenz, insbesondere mit dem Konzept „Fair Play“, im Elementar- und Primarbereich. Sie analysiert den Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen auf die Entwicklung von Kindern und die Bedeutung von sozialem Lernen für die Integration und Teilhabe an der Gesellschaft.
- Veränderte Kindheit und deren Folgen für die soziale Entwicklung
- Definition und Bedeutung von sozialem Lernen
- Die Rolle von Familie, Kindergarten und Grundschule bei der Entwicklung sozialer Kompetenz
- Wege zur Selbst- und Mitbestimmung im Schulalltag
- Der Beitrag des Schulsports zur Förderung von Fairness und sozialem Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Fair Play“ ein und verdeutlicht dessen Bedeutung für das alltägliche Miteinander von Kindern. Kapitel 2 beleuchtet den Wandel der Kindheit und die damit verbundenen Veränderungen in Familie, Erziehungsverhalten, Spiel- und Freizeitverhalten sowie der Medienwelt. In Kapitel 3 werden verschiedene Definitionen von sozialem Lernen vorgestellt. Kapitel 4 untersucht die Rolle von Familie, Kindergarten und Grundschule bei der Entwicklung sozialer Kompetenz. Kapitel 5 fokussiert sich auf die Förderung von Selbst- und Mitbestimmung im Grundschulunterricht. Kapitel 6 analysiert die Bedeutung des Schulsports für die Ausbildung von „Fair Play“ und sozialem Verhalten. Die Arbeit betrachtet kritisch die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich durch gesellschaftliche Veränderungen für die Förderung sozialer Kompetenz im Elementar- und Primarbereich ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Soziales Lernen, Fair Play, Entwicklung sozialer Kompetenz, veränderte Kindheit, Familie, Kindergarten, Grundschule, Selbst- und Mitbestimmung, Schulsport.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Fair Play“ für Kinder?
Kinder verbinden damit das Teilen, gegenseitige Hilfe und das Einhalten von Regeln, während Lästern oder Schlagen als unfair empfunden werden.
Welchen Einfluss hat die „veränderte Kindheit“ auf das soziale Lernen?
Wandel in Familie, Medienkonsum und Freizeitverhalten beeinflussen, wie Kinder soziale Kompetenzen entwickeln und Konflikte lösen.
Wie fördert die Grundschule soziale Mitbestimmung?
Durch Instrumente wie den Klassenrat, Rituale im Alltag und Projekte wie die „Zukunftswerkstatt“ lernen Kinder Eigeninitiative und Demokratie.
Welche Rolle spielt der Schulsport beim sozialen Lernen?
Sport bietet ein Feld, um Regeln und Fairness praktisch zu erfahren, Vertrauen aufzubauen und Gewaltprävention (z.B. durch Ringen und Kämpfen) zu üben.
Welche Institutionen sind für die Ausbildung sozialer Kompetenz wichtig?
Die Entwicklung beginnt in der Familie und wird im Kindergarten sowie in der Grundschule systematisch weitergeführt.
- Arbeit zitieren
- Birte Spitzer (Autor:in), 2006, Fair Play - Möglichkeiten und Hindernisse bei der Ausbildung sozialer Kompetenz im Elementar- und Primarbereich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62662