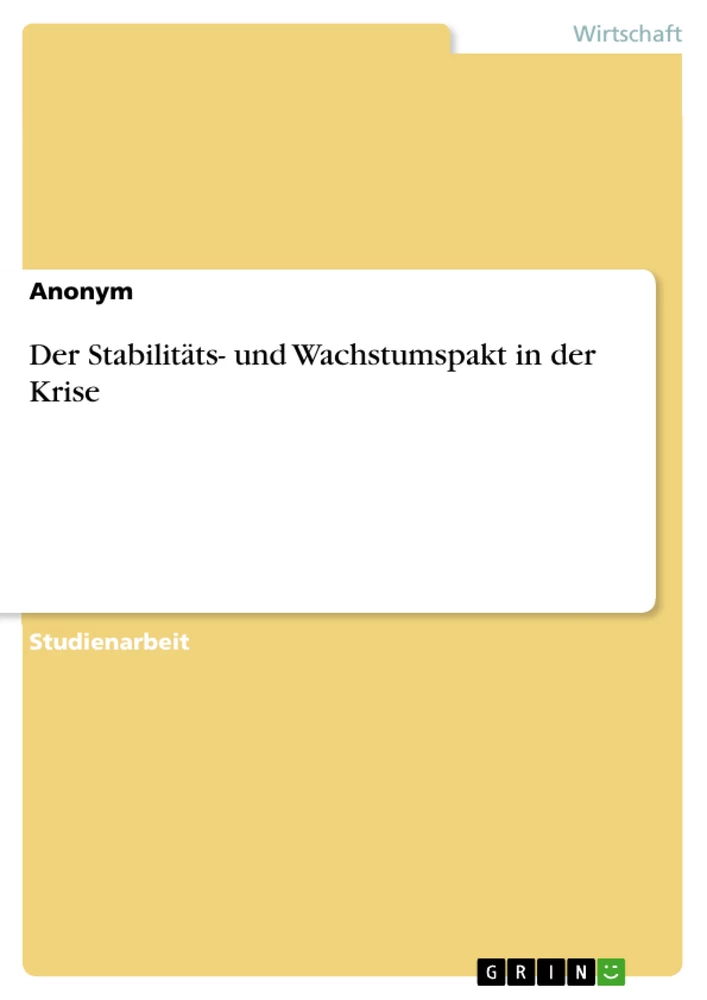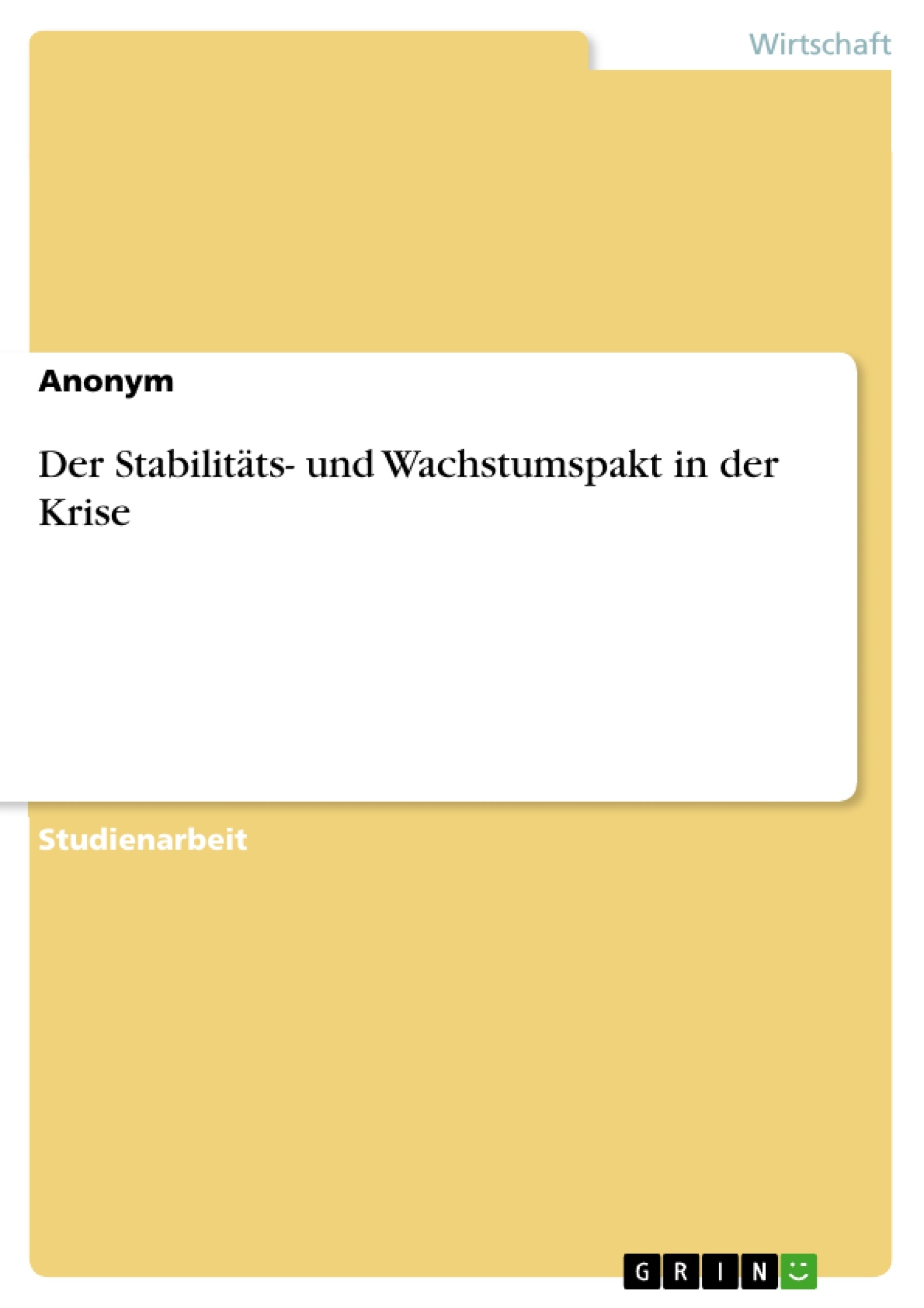Am 22./23. März 2005 billigte der Europäische Rat die nach kontroverser Diskussion am 20. März 2005 erzielte Einigung der EU-Finanzminister zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.
Der Pakt wird seit seiner Formulierung und seines Inkrafttretens hinsichtlich seiner Notwendigkeit von Politikern wie Ökonomen diskutiert und wurde vielfach auch als wirkungslos betrachtet nachdem am 25. November 2003, unter Kritik der EZB, der europäischen Kommission und einiger EWU-Teilnehmerstaaten, das gegen Deutschland und Frankreich aufgrund des Stabilitäts- und Wachstumspakts eingeleitete Defizitverfahren vom ECOFIN-Rat vorläufig ausgesetzt wurde, obgleich bereits im Jahr 2002 für beide Länder ein übermäßiges Defizit festgestellt, die gestatteten 3 % vom BIP überschritten wurden.
Diese Arbeit stellt die Entwicklung des Paktes aus dem Vertrag von Maastricht und dem deutschen Vorschlag eines „Stabilitätspakts für Europa“ dar. Nach Analyse der wichtigsten Argumente für die strenge Auslegung des Paktes sowie derjenigen für eine Modifikation des Regelwerks werden die Neuregelungen des Paktes, zu denen es am 20. März 2005 kam, vorgestellt und auf ihre Sinnigkeit hin geprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Vertrag von Maastricht und der SWP
- Der Vertrag von Maastricht
- Darstellung der Konvergenzkriterien
- Kritik am Vertragswerk von Maastricht
- Vom „Stabilitätspakt für Europa“ zum SWP
- Funktionsweise des Sanktionsmechanismus
- Der Vertrag von Maastricht
- Staatsverschuldung und Inflation
- Ermittlung der Staatsverschuldung
- Der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Inflation
- Inflationsursachen nach Keynesianischer und Neoklassischer Theorie
- Argumente für eine Beibehaltung des ursprünglichen Pakts
- Gefahr für die Geldwertstabilität
- Erhalt der Glaubwürdigkeit
- Argumente gegen eine Beibehaltung des ursprünglichen Pakts
- Unrealistische Verschuldungskriterien
- Umstrittene Korrelation von Defizit und Inflation
- Mangelnde Differenzierung der staatlichen Ausgaben
- Wirken des Sanktionsmechanismus
- Mangelnde Flexibilität und Förderung einer prozyklischen Fiskalpolitik
- Neuregelungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit analysiert den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) in seiner Krise und verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Paktes, seine Funktionsweise und die Kritik an seinem Regelwerk zu beleuchten. Dazu werden die historischen Wurzeln des SWP im Vertrag von Maastricht und dem deutschen Vorschlag eines „Stabilitätspakts für Europa“ betrachtet. Die Arbeit untersucht auch die Beziehung zwischen Staatsverschuldung und Inflation und analysiert die keynesianische und neoklassische Sichtweise auf die Ursachen von Inflation.
- Die Entwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspakts aus dem Vertrag von Maastricht
- Die Funktionsweise des Sanktionsmechanismus im SWP
- Der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Inflation
- Argumente für und gegen eine Beibehaltung des ursprünglichen SWP
- Die Neuregelungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Aktualität und Bedeutung des SWP, die in der Arbeit im Vordergrund steht. Kapitel 2 beleuchtet den historischen Ursprung des Paktes im Vertrag von Maastricht und den daraus resultierenden Konvergenzkriterien. Außerdem wird die Entstehung des SWP aus dem „Stabilitätspakt für Europa“ dargestellt und seine Sanktionsmechanismen näher betrachtet. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Ermittlung der Staatsverschuldung und ihrer Verbindung zur Inflationsrate. Es werden die keynesianische und neoklassische Theorie zur Inflation gegenübergestellt.
Die Kapitel 4 und 5 stellen die wichtigsten Argumente für und gegen die Beibehaltung des ursprünglichen SWP dar. Im Mittelpunkt steht die Diskussion über die strenge Auslegung des Paktes sowie die Notwendigkeit einer Modifikation des Regelwerks. Schließlich präsentiert Kapitel 6 die im März 2005 beschlossenen Neuregelungen des Paktes, die aus den kontroversen Debatten hervorgingen. Die Schlussbetrachtung bietet eine abschließende Beurteilung des SWP und seiner Änderungen.
Schlüsselwörter
Stabilitäts- und Wachstumspakt, Vertrag von Maastricht, Konvergenzkriterien, Staatsverschuldung, Inflation, keynesianische Theorie, neoklassische Theorie, Geldwertstabilität, Sanktionsmechanismus, Neuregelungen, prozyklische Fiskalpolitik
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP)?
Der SWP ist ein Regelwerk der EU-Staaten zur Sicherstellung stabiler Staatsfinanzen in der Eurozone, basierend auf den Kriterien des Vertrags von Maastricht.
Welche Konvergenzkriterien legt der Vertrag von Maastricht fest?
Zu den wichtigsten Kriterien gehören eine maximale Neuverschuldung von 3 % des BIP und ein Gesamtschuldenstand von höchstens 60 % des BIP.
Warum geriet der Pakt im Jahr 2003 in eine Krise?
Das Defizitverfahren gegen Deutschland und Frankreich wurde ausgesetzt, obwohl beide Länder die Defizitgrenzen überschritten hatten, was die Glaubwürdigkeit des Paktes schwächte.
Was wurde bei der Reform des SWP im März 2005 geändert?
Die Reform brachte mehr Flexibilität bei der Bewertung von Defiziten und berücksichtigte länderspezifische Umstände sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Staatsverschuldung und Inflation?
Eine hohe Staatsverschuldung kann zu inflationären Tendenzen führen, wobei Keynesianer und Neoklassiker unterschiedliche Theorien über die genauen Ursachen und Folgen vertreten.
Was ist eine „prozyklische Fiskalpolitik“?
Kritiker warnten, dass der ursprüngliche Pakt Staaten dazu zwang, in einer Rezession zu sparen, was den wirtschaftlichen Abschwung weiter verstärken könnte.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2005, Der Stabilitäts- und Wachstumspakt in der Krise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62853