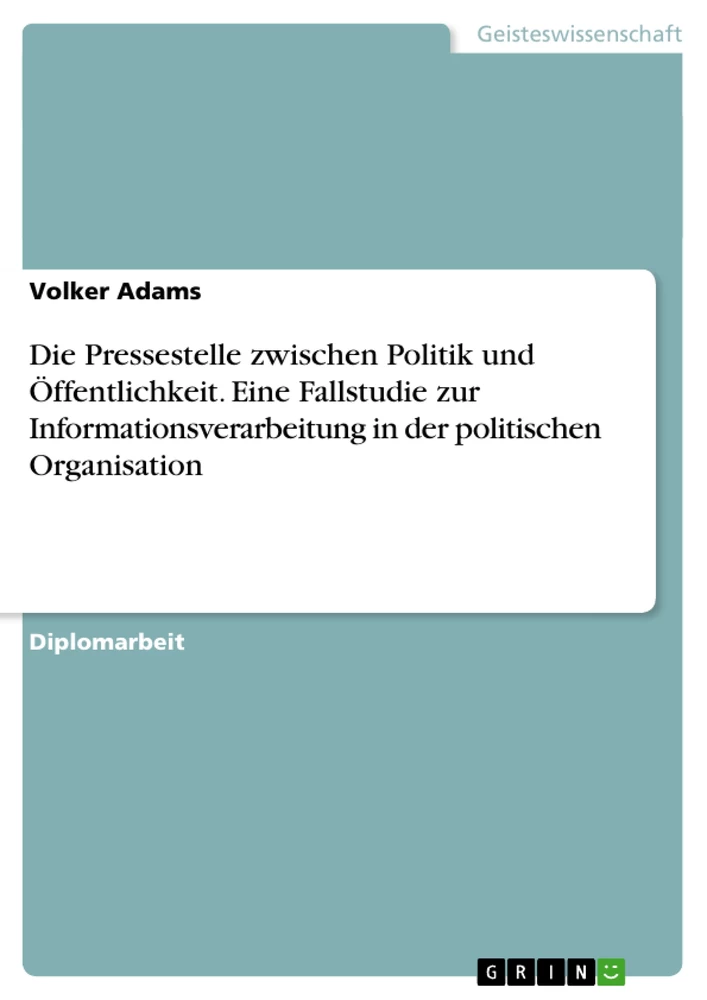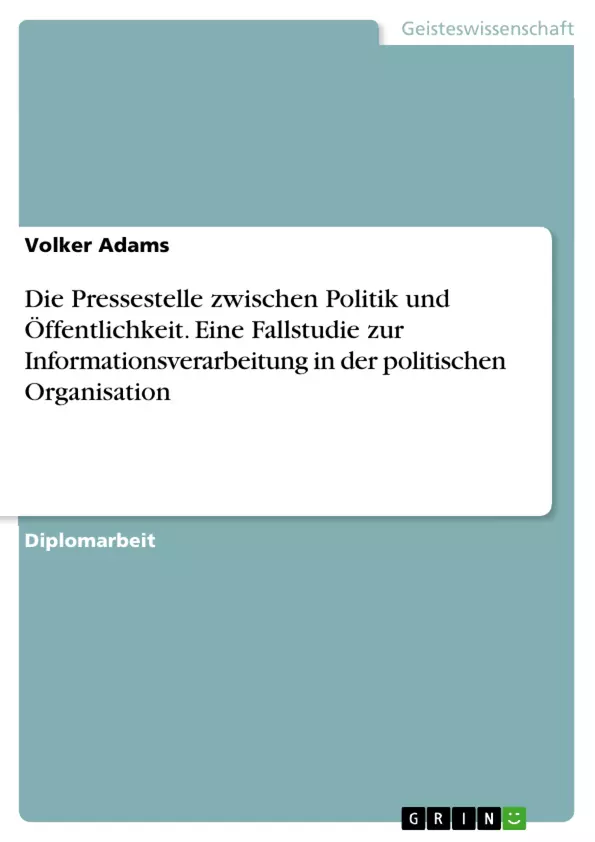"The `packaging of politics´ is evident in the operation of many political institutions and processes, although the activities of political parties during general elections offer perhaps the clearest example. Parties have recruited small armies of media advisors to develop strategies for promoting electorally favourable media images of their leaders and key policies"
(Franklin 1994, S.6).
Im Zuge der organisatorischen Expansion treten neben einer steigenden Mitgliedschaftszahl gewichtige qualitative Veränderungen innerhalb der politischen Partei auf. Die Entwicklung führt dahin, daß sie nicht mehr als einfaches, überschaubares Ganzes existieren, sondern sich eine Unterteilung in Anhängerschaft, unterschiedliche Ebenen der Parteiführung, Flügeln und Richtungen beobachten läßt. So hat sie sich zum einen als Partei selbst, aber auch bezüglich ihrer Teile, nämlich der Mitgliedschaft und deren Beziehung zueinander, gewandelt (vgl. Willke 1996, S.135) Der Größenzuwachs führt zwangsläufig zu Einschränkungen der Möglichkeiten der Relationierung bestimmter Mitgliederbeziehungen. Es ist innerhalb einer großen Organisation nicht mehr allen Mitgliedern möglich, zu allen anderen Mitgliedern in Beziehung zu treten.
Auffällig ist dabei vor allem die verstärkt auftretende interne Differenzierung der Arbeitsbereiche der politischen Organisation. Diese Tendenz zur fortschreitenden Segmentierung ist gekennzeichnet durch die Entstehung neuer Referate und Arbeitskreise, die sich (ausschließlich) mit bestimmten, spezifizierten Themengebieten auseinandersetzen. Nun hat sich im Laufe der Zeit innerhalb der politischen Partei ein Subsystem herausgebildet, in das von unterschiedlichster Seite die größten Hoffnungen und Erwartungen gesetzt werden: die Pressestelle.
Vor allem politischer Parteien scheinen davon auszugehen, daß eine Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit die Organisation ihrem Ziel näher bringt, Öffentlichkeit für sich zu gewinnen (vgl. Jansen / Ruberto 1997, S.36). Als Indiz hierfür kann das stetige Vordringen von politischer PR in sämtliche Bereiche der Politik dienen. PR hat, ohne Zweifel, einen festen Platz in pluralistisch organisierten Demokratien gefunden (vgl. Ronneberger 1989, S.149).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung des systemtheoretischen Rahmens
- System-Umwelt Problematik
- Systemgrenzen
- Verhältnis zwischen Politik, Massenmedien und Öffentlichkeit
- Das Funktionssystem der Politik
- Das Funktionssystem der Massenmedien
- Die Funktion von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung für Politik und Massenmedien
- Öffentlichkeit und öffentliche Meinung
- Die Bedeutung von öffentlicher Meinung für das politische System
- Öffentlichkeit und Massenmedien
- Die Funktion der Massenmedien für die politische Kommunikation
- Organisation
- Interaktion und Organisation
- Organisation und Entscheidung
- Grenzstellen
- Unsicherheitsabsorption
- Adaption
- Problemstellung
- Formale Organisation
- Informale Organisation
- Rollenverflechtung
- Methoden zur Bewältigung des Rollenkonflikts
- Presse-Partei-Paralellismus
- Zwischenfazit
- Empirische Analyse
- Auswahlverfahren
- Erhebung
- Problembewältigungsmechanismen innerhalb der politischen Pressestelle
- Verschiebung auf andere Ebenen der Organisation
- Freiräume durch Intransparenz
- Generierung des Bewußtseins für massenmediale Anforderungen innerhalb der Fraktion
- Rücksprache / Dialog innerhalb der Fraktion
- „Unter 3“ - Ein Code
- „Miteinander auf ein Bier gehen“ - der persönliche Kontakt zu Medienvertretern
- Die Pressestellen
- „Kreativität und versicherungsfremde Leistungen“
- „Kontakte statt Meldungen!“
- „Die Pressestelle als Koordinator“
- „Suche nach Anschluß“
- Vergleich der Strategien zur Problembewältigung innerhalb der unterschiedlichen Pressestellen
- Tabellarische Darstellung des Vergleichs der Strategien zur Problembewältigung innerhalb der unterschiedlichen Pressestellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der politischen Pressestelle im Kontext der politischen Organisation. Der Fokus liegt auf dem Prozess der Informationsverarbeitung und den damit verbundenen Herausforderungen.
- Das Spannungsfeld zwischen Politik und Massenmedien und die daraus resultierenden Anforderungen an die Pressestelle
- Die Rolle der formalen und informellen Organisation innerhalb der Pressestelle
- Die Bedeutung von informalen Handlungskomplexen zur Bewältigung von Konflikten
- Die Analyse von Problembewältigungsmechanismen innerhalb der Pressestelle
- Der Vergleich der Strategien zur Problembewältigung in verschiedenen Pressestellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema der politischen Pressestelle ein und verdeutlicht die zunehmende Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit in der heutigen Zeit.
- Begründung des systemtheoretischen Rahmens: Hier wird die systemtheoretische Perspektive als theoretisches Fundament für die Arbeit erläutert.
- System-Umwelt Problematik: Die Arbeit analysiert die Abgrenzung der politischen Pressestelle als System von der Umwelt, also der politischen Organisation und den Massenmedien.
- Verhältnis zwischen Politik, Massenmedien und Öffentlichkeit: In diesem Kapitel werden die Funktionssysteme der Politik und der Massenmedien sowie das Verhältnis von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung im Kontext der politischen Kommunikation beleuchtet.
- Organisation: Das Kapitel befasst sich mit der Organisation der politischen Pressestelle, insbesondere mit der Unterscheidung zwischen formalen und informellen Strukturen und der Rolle der Grenzstellen.
- Problemstellung: Es werden die spezifischen Herausforderungen der Pressestelle im Spannungsfeld zwischen den Anforderungen der Politik und den Erwartungen der Massenmedien analysiert.
- Zwischenfazit: Dieses Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der bisherigen Analyse zusammen.
- Empirische Analyse: Der empirische Teil der Arbeit stellt die Methodik und die Ergebnisse der Untersuchung dar.
- Problembewältigungsmechanismen innerhalb der politischen Pressestelle: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Strategien, mit denen die Pressestelle Konflikte und Herausforderungen bewältigt.
- Die Pressestellen: Es werden verschiedene Pressestellen vorgestellt und ihre unterschiedlichen Strategien im Umgang mit den Herausforderungen ihrer Arbeit veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie politische Pressestelle, systemtheoretischer Ansatz, Informationsverarbeitung, Grenzstelle, formale und informale Organisation, Problembewältigung, Konfliktmanagement, Medienkommunikation, politische Kommunikation, Öffentlichkeit, öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat die Pressestelle in einer politischen Organisation?
Die Pressestelle fungiert als Subsystem und Grenzstelle, das die Kommunikation zwischen der internen Parteiorganisation, den Massenmedien und der Öffentlichkeit koordiniert und professionalisiert.
Was bedeutet der Begriff „Packaging of Politics“?
Er beschreibt die gezielte Aufbereitung politischer Inhalte durch Medienberater, um vorteilhafte Bilder von Führungspersönlichkeiten und Programmen in der Öffentlichkeit zu erzeugen.
Warum kommt es in großen Parteien zu interner Differenzierung?
Mit steigender Mitgliederzahl wird die Organisation unübersichtlicher. Es bilden sich spezialisierte Referate und Arbeitskreise, um komplexe Themengebiete effizient zu bearbeiten.
Wie bewältigen Pressestellen Rollenkonflikte zwischen Politik und Medien?
Zu den Mechanismen gehören informelle Kontakte („auf ein Bier gehen“), die Nutzung von Codes wie „Unter 3“ (Hintergrundinformationen ohne Namensnennung) und die interne Rücksprache innerhalb der Fraktion.
Welche Rolle spielt die Systemtheorie in dieser Untersuchung?
Die Systemtheorie dient als Rahmen, um die Abgrenzung der Pressestelle gegenüber ihrer Umwelt (Politik und Medien) sowie die Prozesse der Informationsverarbeitung und Unsicherheitsabsorption zu analysieren.
- Arbeit zitieren
- Volker Adams (Autor:in), 2002, Die Pressestelle zwischen Politik und Öffentlichkeit. Eine Fallstudie zur Informationsverarbeitung in der politischen Organisation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6289