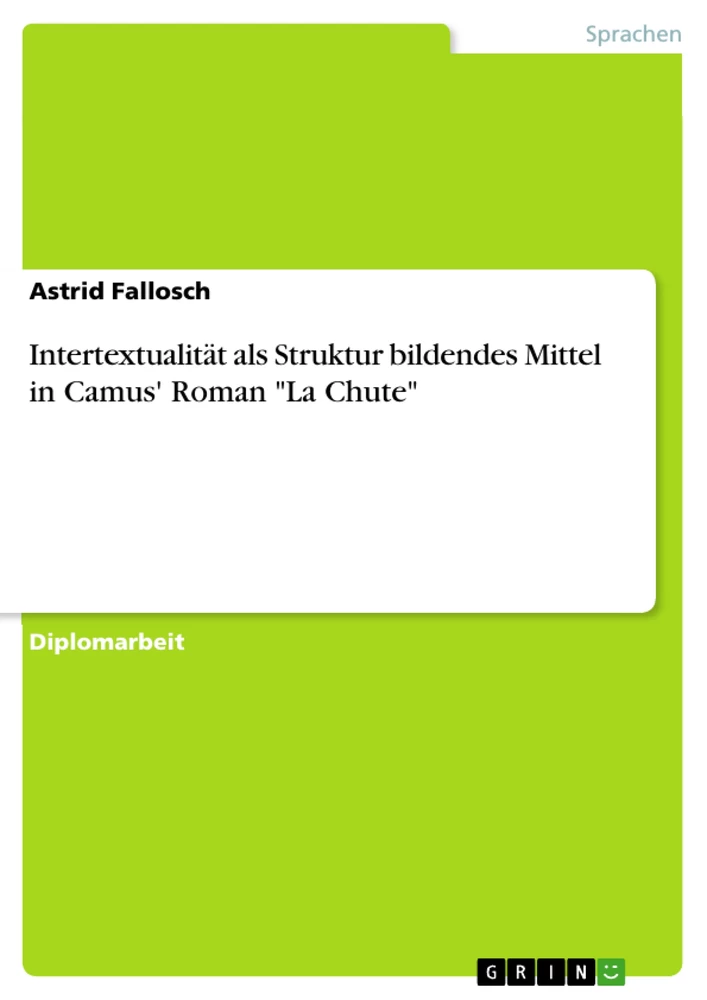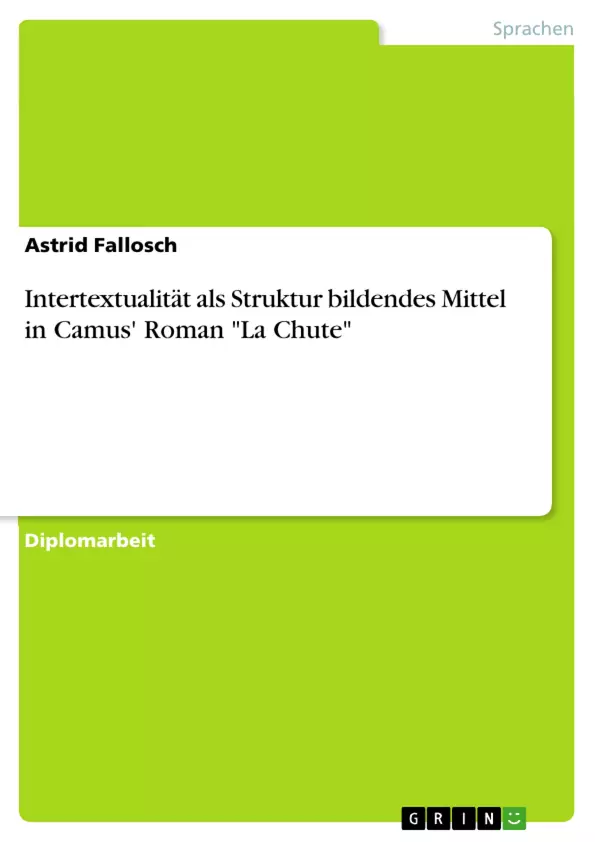Die vorliegende Arbeit liefert eine Analyse von Albert Camus’ Roman La Chute, in dem sie auf das theoretische Modell der Intertextualität zurückgreift. Intertextualität setzt die Existenz von mindestens zwei Texten, die in einer besonderen Beziehung zu einander stehen, voraus. Das außergewöhnliche Werk Camus’ ist von Zitaten, Bezügen und Anspielungen auf andere Schriften bzw. Autoren durchzogen. Bei näherer Betrachtung werden auch implizite Bezüge von Camus’ Text auf andere Texte erkennbar, die sowohl Verflechtungen mit fremden Werken als auch mit seinen eigenen herstellen. Die aktive Lektüre von La Chute lässt keinen Zweifel an der Hypothese, dass Intertextualität ein wesentliches Element literarischer Texte ist.1
Des Phänomens der Vernetzung von Texten nimmt sich das literaturwissenschaftliche Modell der Intertextualität an, welches u. a. auf die bulgarische Literaturwissenschafterin Julia Kristeva zurückgeführt werden kann. Intertextualität besteht aus Transformation und Assimilation mehrerer Texte mit dem Ziel, eine neue Bedeutung zu generieren. Die Eigenschaften der Vernetzung von Texten ist es, sinnhafte bzw. Sinn stiftende Beziehungen und Verbindungen zwischen mehreren Texten aufzubauen. Deren Funktion ist es, Gedankengüter zwischen den Werken frei zirkulieren zu lassen. (Vgl. Cabakulu 2002, S. 24f) Dieses Fließen von Ideen zwischen Camus’ WerkLa Chuteund mannigfachen anderen Texten unterschiedlicher Gattungen und unterschiedlichster Epochen ist Gegenstand dieser Diplomarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Forschungsleitende Fragen und Gliederung der Arbeit
- 1.2 Methodische Vorgehensweise und Ziel der Arbeit
- 2 Theoretische Annäherung an den Begriff „Intertextualität“
- 2.1 Begriffsbestimmung und Definitionen
- 2.2 Kategorien und Kriterien der Intertextualität
- 2.3 Funktionen und Formen der Intertextualität
- 2.3.1 Funktionen der Intertextualität
- 2.3.2 Formen der Intertextualität
- 3 ALBERT CAMUS: LA CHUTE
- 3.1 Der französische Existentialismus und seine wichtigsten Vertreter
- 3.1.1 Jean-Paul Sartre
- 3.1.2 Albert Camus
- 3.2 Der Roman La Chute
- 3.2.1 Inhalt von La Chute
- 3.2.2 Aufbau und Erzählform von La Chute
- 3.2.3 Der Protagonist Clamence
- 4 Intertextualität in La Chute
- 4.1 Intertextuelle Verknüpfungen
- 4.1.1 Der Titel La Chute
- 4.1.2 Der Name „Jean Baptiste Clamence“ und die Bibel
- 4.1.3 Der Handlungsort: Amsterdam und Dantes Hölle
- 4.1.4 Die Psychologie des Protagonisten Clamence - Sartre und Nietzsche
- 4.1.5 Der Beruf des Protagonisten: der „juge-pénitent“ und Descartes
- 4.1.6 Die Erzählform in La Chute und Dostojewskijs Schuld und Sühne und Aufzeichnungen aus dem Kellerloch
- 4.1.7 Intertexte zu weiteren Werken
- 4.2 Intratextuelle Verknüpfungen
- 4.2.1 Carnets II und Carnets III
- 4.2.2 Le Mythe de Sisyphe
- 4.2.3 L'Homme révolté
- 5 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert Albert Camus' Roman "La Chute" unter Verwendung des theoretischen Modells der Intertextualität. Ziel ist es, die vielfältigen intertextuellen Bezüge im Roman aufzuzeigen und deren Bedeutung für das Verständnis des Werkes zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet, wie Camus durch die Einarbeitung von Zitaten, Anspielungen und impliziten Verweisen auf andere Texte (und seine eigenen Werke) die Struktur und Bedeutung seines Romans gestaltet.
- Die Definition und verschiedenen Ausprägungen von Intertextualität
- Die Analyse der intertextuellen Verknüpfungen in "La Chute"
- Der Einfluss anderer Autoren und Werke auf Camus' Roman
- Die Rolle der Intertextualität für die Struktur und Bedeutung von "La Chute"
- Die Untersuchung intratextueller Bezüge innerhalb von Camus' Gesamtwerk
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung der Intertextualität in Albert Camus' Roman "La Chute" vor. Sie beschreibt den Ansatz der Arbeit, der die Analyse der intertextuellen Verflechtungen im Roman zum Ziel hat, und skizziert die methodische Vorgehensweise. Die Einleitung betont die zentrale Rolle der Intertextualität als strukturbildendes Element und hebt die Komplexität des Begriffs hervor, der in der Arbeit genauer untersucht werden soll.
2 Theoretische Annäherung an den Begriff „Intertextualität“: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem theoretischen Konzept der Intertextualität. Es werden verschiedene Definitionen und Ausprägungen des Begriffs diskutiert, Kategorien und Kriterien der Intertextualität erläutert sowie deren Funktionen und Formen untersucht. Dieses Kapitel legt die theoretische Grundlage für die anschließende Analyse von Camus' Werk.
3 ALBERT CAMUS: LA CHUTE: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über Albert Camus' Leben und Werk, mit besonderem Fokus auf den französischen Existentialismus und dessen wichtigsten Vertreter, darunter Jean-Paul Sartre. Es bietet eine detaillierte Einführung in den Roman "La Chute" selbst, einschließlich seines Inhalts, Aufbaus, Erzählform und der zentralen Figur Clamence. Dieses Kapitel dient als fundierte Basis für die anschließende intertextuelle Analyse.
4 Intertextualität in La Chute: Der Kern der Arbeit, dieses Kapitel analysiert die vielfältigen intertextuellen Verknüpfungen in "La Chute". Es untersucht sowohl explizite als auch implizite Bezüge zu anderen Werken und Autoren, beleuchtet die Bedeutung des Titels, die Rolle der Figur Clamence im Kontext anderer literarischer Figuren, und analysiert die Beziehung zwischen dem Schauplatz Amsterdam und literarischen Vorbildern. Das Kapitel differenziert zwischen intertextuellen und intratextuellen Bezügen und beleuchtet den Einfluss von Camus' anderen Werken auf "La Chute".
Schlüsselwörter
Intertextualität, Albert Camus, La Chute, Existentialismus, Jean-Paul Sartre, Literaturanalyse, strukturelle Analyse, literarische Bezüge, Intratextualität, Amsterdam, Bibel, Dantes Hölle.
Häufig gestellte Fragen zu der Diplomarbeit: Intertextualität in Albert Camus' "La Chute"
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert Albert Camus' Roman "La Chute" unter dem Aspekt der Intertextualität. Sie untersucht die vielfältigen Bezüge zu anderen Texten und Werken, sowohl explizit als auch implizit, und deren Bedeutung für das Verständnis des Romans.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Bedeutung der Intertextualität in "La Chute". Die Arbeit erforscht, wie Camus durch intertextuelle Verknüpfungen die Struktur und Bedeutung seines Romans gestaltet. Es werden explizite und implizite Bezüge zu anderen Autoren und Werken analysiert.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verwendet das theoretische Modell der Intertextualität als analytisches Werkzeug. Sie analysiert sowohl intertextuelle (Bezüge zu anderen Werken) als auch intratextuelle (Bezüge innerhalb von Camus' Gesamtwerk) Verknüpfungen. Die Analyse umfasst die Untersuchung des Titels, der Charaktere, der Handlungsorte und der Erzählform im Kontext anderer literarischer Werke.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung), Kapitel 2 (Theoretische Annäherung an den Begriff „Intertextualität“), Kapitel 3 (Albert Camus: La Chute - Einführung in den Roman und den Existentialismus), Kapitel 4 (Intertextualität in La Chute - Analyse der inter- und intratextuellen Verknüpfungen) und Kapitel 5 (Schlussfolgerung).
Welche Autoren und Werke werden neben Camus' "La Chute" behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf eine Vielzahl von Autoren und Werken, darunter Jean-Paul Sartre, Dostojewski (Schuld und Sühne, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch), Dante (Hölle), Descartes und Nietzsche. Es werden auch Bezüge zu anderen Werken von Camus selbst (z.B. Carnets, Le Mythe de Sisyphe, L'Homme révolté) untersucht.
Welche Aspekte der Intertextualität werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Intertextualität, darunter die Definition und Ausprägungen des Begriffs, die Funktionen und Formen von Intertextualität, explizite und implizite Bezüge, und den Einfluss der Intertextualität auf die Struktur und Bedeutung von "La Chute".
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Bedeutung der Intertextualität für das Verständnis von Camus' "La Chute". Es wird gezeigt, wie die intertextuellen Verknüpfungen das Werk strukturieren und seine Bedeutung vertiefen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Intertextualität, Albert Camus, La Chute, Existentialismus, Jean-Paul Sartre, Literaturanalyse, strukturelle Analyse, literarische Bezüge, Intratextualität, Amsterdam, Bibel, Dantes Hölle.
- Citation du texte
- Astrid Fallosch (Auteur), 2005, Intertextualität als Struktur bildendes Mittel in Camus' Roman "La Chute", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62928