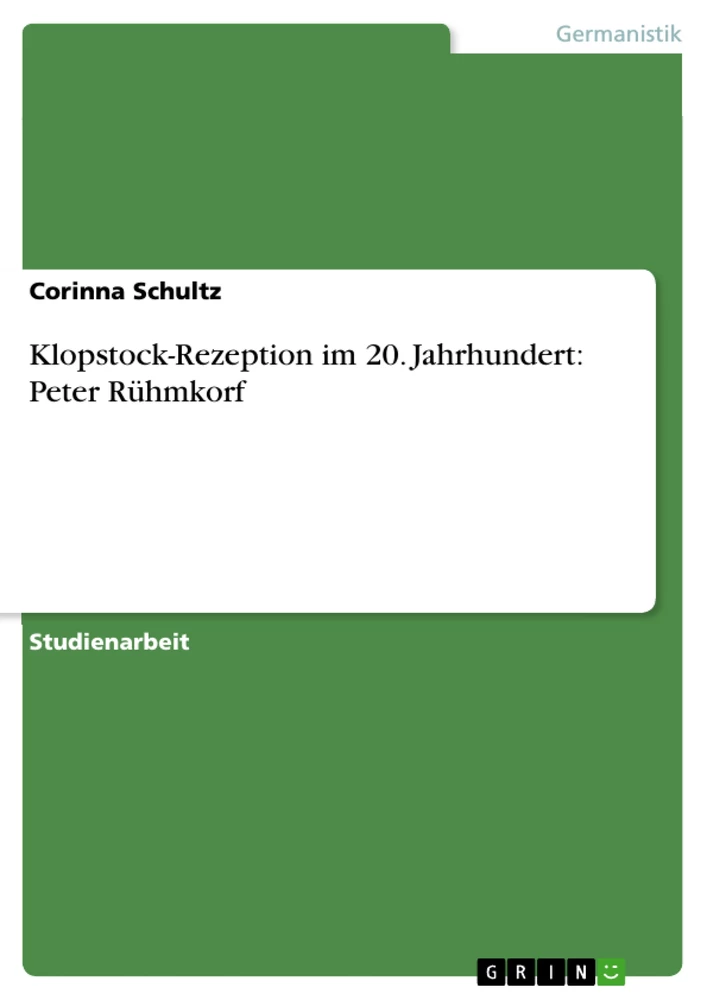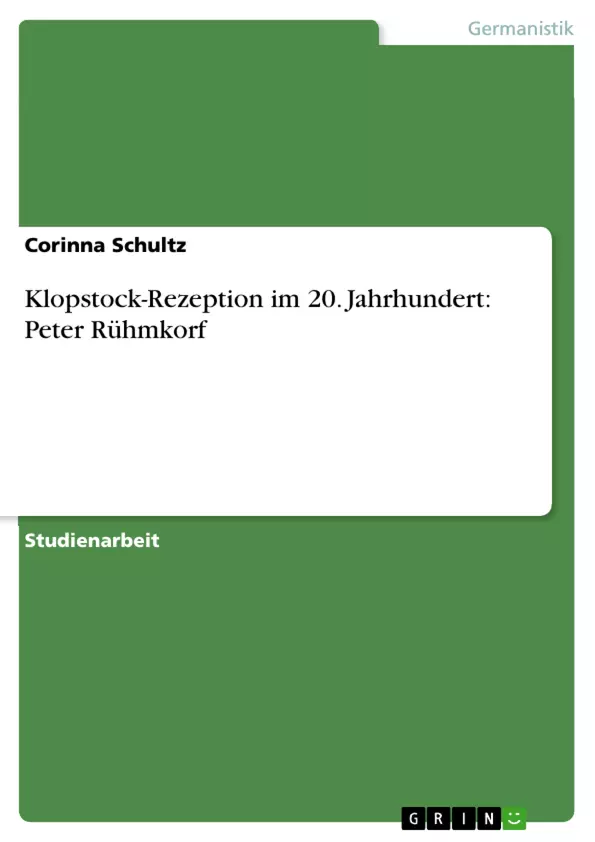Wenn man heute Werke Klopstocks käuflich erwerben möchte, sich deswegen beispielsweise beim einem der marktführenden Buchhandel wie www.amazon.de einloggt und „Klopstock“ als Suchbegriff eingibt, erhält man 119 Treffer. Der Verlag Reclam bietet zwei Bändchen an, die lediglich eine Auswahl von Oden und die ersten drei Gesänge des „Messias“ enthalten. Neben Sekundärschriften findet man anschließend überteuerte Werkausgaben oder den enttäuschenden Satz „Führen wir nicht oder nicht mehr“. Da bleibt nur noch die Bibliothek. Bei dieser Variante muss man allerdings der im Moment einzige Leser sein, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Es bleibt die Frage, warum sich kein Verleger die Mühe macht, eine wenigstens die wichtigsten Texte vollständig enthaltende Studienausgabe herauszugeben. Selbst die dichterische Rezeption Klopstocks ist nicht breit angelegt. Im 20. Jahrhundert setzen sich nur einzelne Dichter, dafür aber intensiv, mit seinem Werk auseinander. Dabei gilt es den ersten und ältesten, deutschen Klassiker, neu zu lesen und den bedeutungsvollen Gehalt seines Werkes wieder zu entdecken. Aber was veranlasst nun Peter Rühmkorf „sich in einem Atemzug mit [einem] Autor zu nennen, [der] als „verstaubt“ [gilt] und nur noch im akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb auf philologisches und historisches Interesse [stößt]?“
Meine Hauptthese besteht darin, dass, dadurch dass Rühmkorf zahlreiche literarische Gemeinsamkeiten aufdeckt zwischen dem vergangenen 18. Jahrhundert und dem gegenwärtigeren 20. Jahrhundert, Klopstocks Leben und Werk sehr modern anmutet und zu Unrecht geringe Aufmerksamkeit erhält.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ,,Walther von der Vogelweide, Klopstock und ich.“
- Textbesprechung: „Friedrich Gottlieb Klopstock. Ein empfindsamer Revolutionär“
- Klärung der Aufgabe und Funktion des Textes von Peter Rühmkorf
- Vergleich der Dichtersituation im 18. Jahrhundert mit der im 20. Jahrhundert
- Vergleich der beiden Dichter in ihrem praktischen Schaffen
- Schlussbetrachtung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Rezeption Klopstocks im 20. Jahrhundert am Beispiel von Peter Rühmkorf zu untersuchen. Dabei soll die besondere Bedeutung des Werkes von Klopstock für Rühmkorf herausgearbeitet werden, um so ein besseres Verständnis des Werkes von Rühmkorf selbst zu ermöglichen. Die Arbeit möchte zeigen, wie Klopstock als "verstaubt" geltender Dichter im 20. Jahrhundert neu gelesen werden kann und welche Relevanz sein Werk für die Gegenwart besitzt.
- Rühmkorfs Interpretation von Klopstock und seine Relevanz für das 20. Jahrhundert
- Vergleich der Dichtersituation im 18. Jahrhundert mit der im 20. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Klopstocks Werk für die deutsche Literatur und seine Relevanz für die Gegenwart
- Die Rolle des Dichters in der Gesellschaft
- Die Aktualität von Klopstocks Ideen und Themen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage, warum Klopstock im 20. Jahrhundert so wenig Beachtung findet, obwohl er einer der bedeutendsten deutschen Dichter ist. Sie stellt die These auf, dass Rühmkorf durch die Aufdeckung von literarischen Gemeinsamkeiten zwischen dem 18. Jahrhundert und der Gegenwart Klopstocks Werk neu entdeckt hat.
- „Walther von der Vogelweide, Klopstock und ich.“: Dieses Kapitel behandelt die Textsammlung „Walther von der Vogelweide, Klopstock und ich“ von Peter Rühmkorf. Es wird die Bedeutung von Klopstock für Rühmkorf dargestellt und wie Rühmkorf die Tradition Klopstocks in seinem eigenen Werk weiterführt.
- Textbesprechung: „Friedrich Gottlieb Klopstock. Ein empfindsamer Revolutionär“: In diesem Kapitel wird der Essay „Friedrich Gottlieb Klopstock. Ein empfindsamer Revolutionär“ von Rühmkorf besprochen. Rühmkorf präsentiert Klopstock als Gesellschaftsprodukt, das durch die soziale Lage seiner Zeit geprägt wurde.
- Klärung der Aufgabe und Funktion des Textes von Peter Rühmkorf: Dieses Kapitel untersucht die Funktion und Aufgabe des Textes von Rühmkorf. Es soll geklärt werden, warum Rühmkorf sich mit Klopstock auseinandersetzt und welche Bedeutung Klopstock für seine eigene Arbeit hat.
- Vergleich der Dichtersituation im 18. Jahrhundert mit der im 20. Jahrhundert: Hier wird die Frage gestellt, inwiefern sich die Rolle des Dichters im 18. Jahrhundert von der im 20. Jahrhundert unterscheidet.
- Vergleich der beiden Dichter in ihrem praktischen Schaffen: Dieses Kapitel untersucht, ob und inwiefern sich Rühmkorf in seinem eigenen Schaffen an Klopstock orientiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Klopstock-Rezeption, Peter Rühmkorf, 18. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Dichter, Lyrik, Empfindsamkeit, Revolution, Tradition, Modernität. Die Arbeit befasst sich mit der Aktualität von Klopstocks Ideen und Themen und untersucht, wie Rühmkorf Klopstock neu interpretiert und dessen Werk für die Gegenwart relevant macht.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Friedrich Gottlieb Klopstock im 20. Jahrhundert wahrgenommen?
Klopstock galt lange als "verstaubt" und wurde hauptsächlich im akademischen Kontext rezipiert. Peter Rühmkorf entdeckte jedoch die Modernität in seinem Werk neu.
Was verbindet Peter Rühmkorf mit Klopstock?
Rühmkorf identifizierte zahlreiche literarische und soziale Gemeinsamkeiten zwischen der Dichtersituation des 18. und des 20. Jahrhunderts.
Warum bezeichnet Rühmkorf Klopstock als "empfindsamen Revolutionär"?
Weil Klopstock durch seine Lyrik und seine soziale Haltung die Rolle des Dichters in der Gesellschaft radikal veränderte und Emotionen politisch auflud.
Gibt es heute noch vollständige Ausgaben von Klopstocks Werken?
Die Arbeit kritisiert, dass Klopstock im Buchhandel unterrepräsentiert ist und oft nur Auswahlbände (z.B. bei Reclam) verfügbar sind, was den Zugang zu seinem Gesamtwerk erschwert.
Welche Rolle spielt die Tradition in Rühmkorfs Werk?
Rühmkorf nutzt die Tradition (neben Klopstock auch Walther von der Vogelweide), um seine eigene Position als moderner Dichter zu reflektieren und zu legitimieren.
- Citation du texte
- Corinna Schultz (Auteur), 2006, Klopstock-Rezeption im 20. Jahrhundert: Peter Rühmkorf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63021