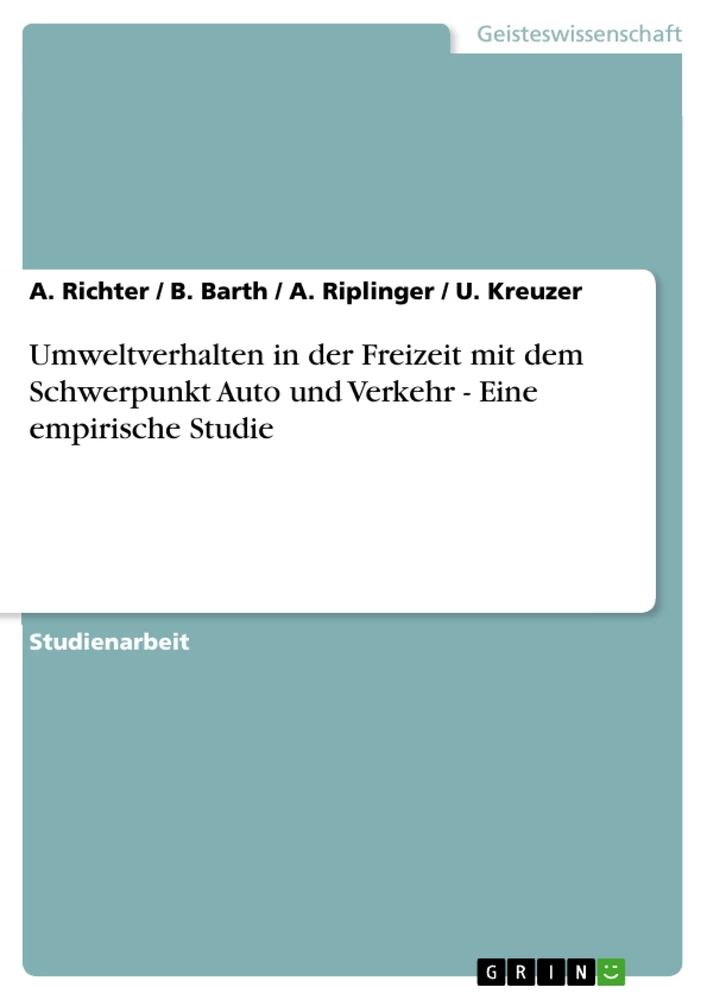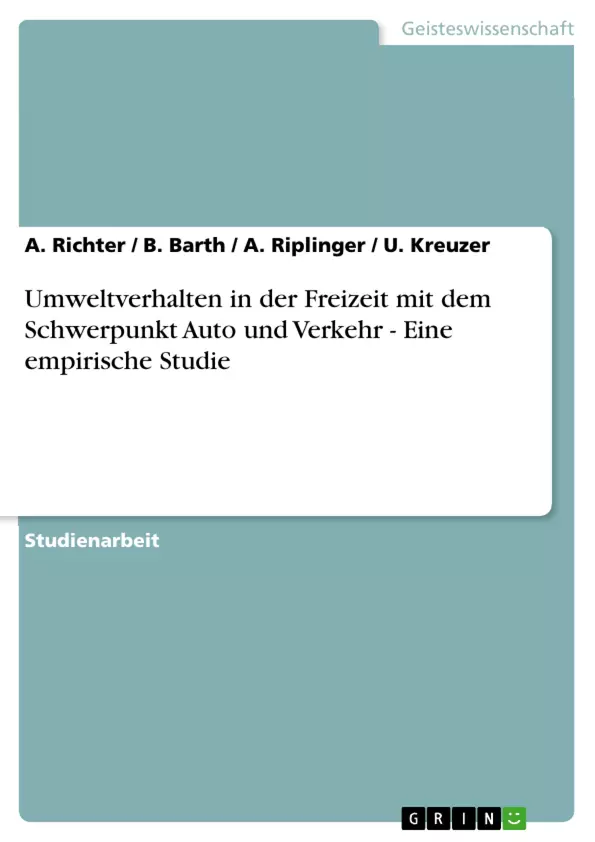Welches Ergebnis soll am Ende der Arbeit stehen? Eine triviale Antwort wird es hierfür wohl nicht geben, jedoch aber valides Datenmaterial. Wie sozial erwünscht haben die Probanden geantwortet und zwischen welchen Faktoren ergeben sich Zusammenhänge? Wo gibt es Widersprüche, an die die Wissenschaft anknüpfen kann? Diese Teilfragen zu beantworten und näher zu erläutern soll Ziel dieser Arbeit sein.
Weitere Teilziele dieser Arbeit sind die Klärung einiger Unterfragen, die sich auf dem Weg zur Forschungsfrage als wichtig herauskristallisiert haben. Welchen Einfluss hat das Umweltbewusstsein auf die Wahl des Verkehrsmittels? Damit ist gemeint, ob sich die Befragten bei der Wahl des Verkehrsmittels Gedanken über dessen Einfluss auf die Umwelt machen. Welche Faktoren beeinflussen die Wahl des Verkehrmittels? Wie ist die Wahrnehmung der Alternativen zum Auto, damit ist gemeint welches Image haben das Fahrrad, die öffentlichen Verkehrsmittel und die deutsche Bahn? Wie verhält es sich mit der Akzeptanz eines „Tempolimits 120“ auf deutschen Autobahnen oder einer „Stadtmaut“ wie es sie bereits in einigen Weltstädten gibt? Sind sich die Menschen wirklich bewusst darüber, wie schädlich Autofahren ist? Sind die Menschen informiert darüber wie es um die Umwelt steht und wie viel Geld sind die Befragten auch in Zukunft bereit zu zahlen, um weiterhin Autofahren zu können?
Wir haben uns in der Arbeit zum Ziel gesetzt am Ende der Arbeit eine Verbindung von Theorie und Praxis herstellen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise
- 2 Grundlegende Bestandteile und Begriffe
- 2.1 Umweltverhalten, Freizeit und Mobilität
- 2.1.1 Umweltverhalten
- 2.1.2 Freizeit und Mobilität
- 2.2 Auto, Verkehr und Umweltbelastung
- 2.2.1 Das Auto
- 2.2.2 Verkehr und Umweltbelastung
- 3 Theorie
- 3.1 Empirische Sozialforschung
- 3.1.1 Qualitative Sozialforschung
- 3.1.2 Quantitative Sozialforschung
- 3.1.3 Methoden empirischer Sozialforschung
- 3.2 Theoretisches Konzept
- 3.2.1 Modell des „Lebensraums“ nach Lewin
- 3.2.2 Theoretischer Ansatz nach Barker – Behavior Setting
- 3.2.3 Environmental Psychology – Ökopsychologie nach Ittelson
- 4 Fragebogen und Auswertung
- 4.1 Unser Fragebogen
- 4.2 Hypothese 1 - Einstellung zur Umwelt
- 4.3 Hypothese 2 – Alternativen zum Auto
- 4.4 Hypothese 3 – Einstellung zum Auto
- 4.5 Erklärungsversuche mit Hilfe des theoretischen Konzepts
- 4.6 Probleme bei der Konzeption und Auswertung des Fragebogens
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Umweltverhalten in der Freizeit, fokussiert auf die Nutzung des Autos und dessen Auswirkungen. Ziel ist es, die Einstellungen und Verhaltensweisen von Personen bezüglich Auto und alternativer Verkehrsmittel in ihrer Freizeit zu analysieren. Die Studie basiert auf einer empirischen Untersuchung mithilfe eines Fragebogens.
- Umweltverhalten im Kontext von Freizeitaktivitäten
- Einstellungen gegenüber dem Auto als Verkehrsmittel
- Alternativen zum Auto in der Freizeit
- Auswirkungen der Autonutzung auf die Umwelt
- Anwendung theoretischer Konzepte der Umweltpsychologie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Umweltverhaltens in der Freizeit mit Schwerpunkt auf den Autoverkehr ein. Sie skizziert die Problemstellung, die durch den hohen Pkw-Bestand und dessen Auswirkungen auf die Umwelt entsteht. Die Arbeit zielt darauf ab, Einstellungen und Verhaltensweisen bezüglich der Autonutzung in der Freizeit zu untersuchen und mögliche Handlungsoptionen aufzuzeigen. Die steigende Zahl an Autos und die damit verbundenen Umweltprobleme wie Lärmbelastung, Flächenverbrauch und Ressourcenverschwendung werden als Ausgangspunkt für die Studie genannt. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Einstellung zum Auto und die Nutzung alternativer Verkehrsmittel das Umweltverhalten beeinflussen.
2 Grundlegende Bestandteile und Begriffe: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Umweltverhalten, Freizeit, Mobilität, Auto und deren jeweilige Zusammenhänge und Auswirkungen auf die Umwelt. Es legt die Grundlage für das Verständnis der verwendeten Konzepte und analysiert die Beziehung zwischen individueller Mobilität und Umweltbelastung. Der Begriff des Umweltverhaltens wird eingegrenzt, während Freizeit und Mobilität als relevante Faktoren für die Autonutzung im Kontext der Studie definiert werden. Die detaillierte Erläuterung des Autos als Umweltbelastungsfaktor und die Diskussion des Verkehrsaufkommens schaffen ein fundiertes Verständnis des zu untersuchenden Problems.
3 Theorie: Kapitel 3 beschreibt den theoretischen Rahmen der Arbeit, indem es die empirische Sozialforschung, insbesondere qualitative und quantitative Methoden, erläutert und relevante theoretische Ansätze vorstellt. Hier werden verschiedene Modelle zur Erklärung von Umweltverhalten, wie das Lebensraummodell von Lewin, der Behavior-Setting-Ansatz von Barker und die Ökopsychologie nach Ittelson, vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit auf die Forschungsfrage hin untersucht. Das Kapitel bildet die wissenschaftliche Grundlage für die Auswertung der empirischen Daten und die Interpretation der Ergebnisse. Die Beschreibung verschiedener Forschungsmethoden ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis des methodischen Vorgehens der Arbeit.
4 Fragebogen und Auswertung: In diesem Kapitel wird die Methodik der empirischen Studie detailliert dargestellt. Der verwendete Fragebogen wird erläutert und die Hypothesen zur Einstellung zur Umwelt, zu Alternativen zum Auto und zur Einstellung zum Auto selbst werden vorgestellt. Die Auswertung der Daten und die Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse werden im Kontext der im vorherigen Kapitel dargestellten theoretischen Konzepte interpretiert. Schwierigkeiten bei der Konzeption und Auswertung werden offen angesprochen, und die Grenzen der Studie werden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Umweltverhalten, Freizeit, Auto, Verkehr, Mobilität, Umweltbelastung, empirische Sozialforschung, Fragebogen, Einstellungen, Alternativen, Umweltpsychologie, theoretische Konzepte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Umweltverhalten in der Freizeit
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Umweltverhalten von Personen in ihrer Freizeit, mit besonderem Fokus auf die Nutzung des Autos und dessen Auswirkungen auf die Umwelt. Es wird analysiert, wie Einstellungen und Verhaltensweisen bezüglich Auto und alternativer Verkehrsmittel das Umweltverhalten beeinflussen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Einstellungen und Verhaltensweisen von Personen bezüglich der Autonutzung in ihrer Freizeit zu analysieren. Sie untersucht die Nutzung alternativer Verkehrsmittel und deren Zusammenhang mit dem Umweltbewusstsein. Die Studie basiert auf einer empirischen Untersuchung mit einem Fragebogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Umweltverhalten im Kontext von Freizeitaktivitäten, Einstellungen gegenüber dem Auto als Verkehrsmittel, Alternativen zum Auto in der Freizeit, Auswirkungen der Autonutzung auf die Umwelt und die Anwendung theoretischer Konzepte der Umweltpsychologie.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine empirische Forschungsmethode mit einem eigens entwickelten Fragebogen. Die Auswertung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener theoretischer Konzepte der Umweltpsychologie (z.B. Lebensraummodell nach Lewin, Behavior-Setting-Ansatz nach Barker, Ökopsychologie nach Ittelson). Sowohl qualitative als auch quantitative Methoden der Sozialforschung werden erwähnt.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene theoretische Konzepte der Umweltpsychologie, darunter das Lebensraummodell nach Lewin, der Behavior-Setting-Ansatz nach Barker und die Ökopsychologie nach Ittelson. Diese Konzepte helfen, das Umweltverhalten im Kontext von Freizeit und Mobilität zu verstehen und die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zu interpretieren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Vorgehensweise), Grundlegende Bestandteile und Begriffe (Definitionen wichtiger Konzepte), Theorie (empirische Sozialforschung und relevante theoretische Ansätze), Fragebogen und Auswertung (Methodik, Hypothesen, Ergebnisse, Interpretation), und Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welche Hypothesen wurden untersucht?
Die Arbeit formuliert Hypothesen zu den Einstellungen zur Umwelt, zu Alternativen zum Auto und zur Einstellung zum Auto selbst. Die Ergebnisse der Fragebogen-Auswertung werden im Hinblick auf diese Hypothesen interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Umweltverhalten, Freizeit, Auto, Verkehr, Mobilität, Umweltbelastung, empirische Sozialforschung, Fragebogen, Einstellungen, Alternativen, Umweltpsychologie, theoretische Konzepte.
Welche Probleme wurden bei der Konzeption und Auswertung des Fragebogens festgestellt?
Die Arbeit diskutiert offen Probleme, die bei der Konzeption und Auswertung des Fragebogens aufgetreten sind, und benennt die Grenzen der Studie.
Wo finde ich die detaillierten Ergebnisse der Studie?
Die detaillierten Ergebnisse der Studie, inklusive der Auswertung des Fragebogens und der Interpretation der Daten im Kontext der theoretischen Konzepte, sind im Kapitel "Fragebogen und Auswertung" der Seminararbeit zu finden.
- Quote paper
- A. Richter (Author), B. Barth (Author), A. Riplinger (Author), U. Kreuzer (Author), 2005, Umweltverhalten in der Freizeit mit dem Schwerpunkt Auto und Verkehr - Eine empirische Studie , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63079