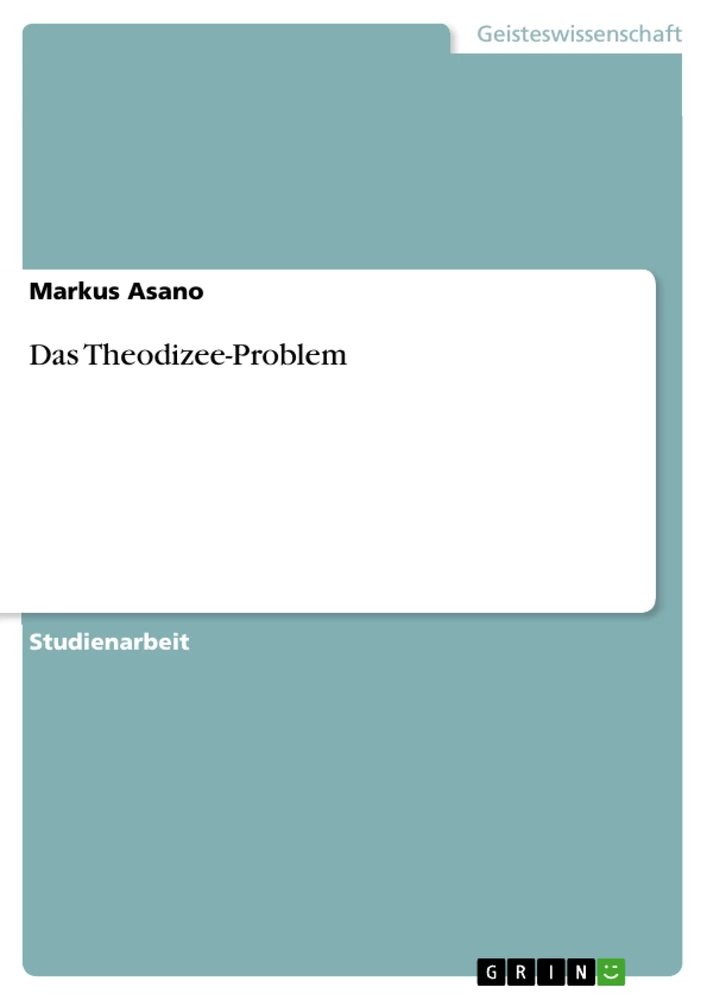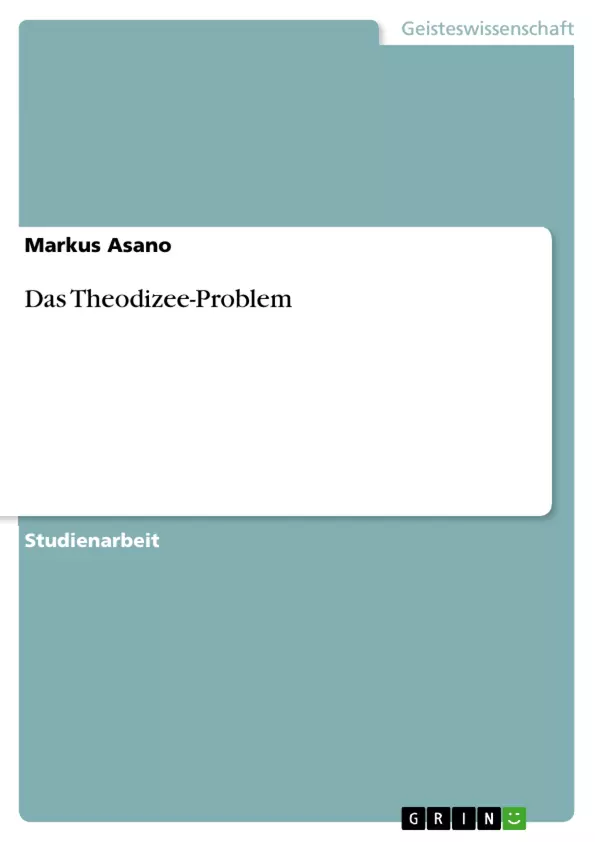1. Vorwort
Wie kann man an Gott glauben, wenn man das gewaltige Ausmaß an Verbrechen, Naturkatastrophen, Kriegen, - schlicht das gesamte Elend des menschlichen Lebens ins Auge faßt? Für viele ist das der ausschlaggebende Punkt, für sich mit Gott abzuschließen, seine Existenz zu verneinen. Noch prekärer wird es, wenn Gott -wie im Theismus - als vollkommen gut, vollkommen mächtig, allwissend gedacht wird.
Einen Versuch, Gott angesichts der Übel in der Welt zu rechtfertigen nennt man Theodizee. Das Wort Theodizee setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen: Zum einen aus „theos“ (Gott); zum anderen aus dem Wort „dike“; auf deutsch: Recht. Übersetzt heißt Theodizee also „Gott rechtfertigen“. Der Begriff der „Theodizee“ stammt von Leibniz, dessen Rechtfertigungsversuch Gottes zu den bekannteren der Philosophiegeschichte gehört. Aber schon lange vor Leibniz wurde das Thema diskutiert; es zieht sich wie ein Faden durch die Philosophiegeschichte des Abendlandes. Besondere Beachtung findet das Thema allerdings erst in der Neuzeit, als sich die Vernunft vom Glauben emanzipiert. Peter Welsen nennt in seinem Artikel „Gott und die Übel der Welt“ zwei historische Ereignisse, die das Problem des Übels und die Frage nach der Rechtfertigung Gottes deutlich werden lassen: Zum einen „der Dreißigjährige Krieg [1618-.48], in dessen Verlauf das Heilige Römische Reich Deutscher Nation die Hälfte seiner Bevölkerung einbüßte, sowie das Erdbeben, das 1755 Lissabon heimsuchte und innerhalb kürzester Zeit sechzigtausend Menschen in den Tod riß.“1 Aufgrund jener Geschehnisse gewann die Frage, ob Gottes Güte mit den Übeln vereinbar sein kann, oder ob Er überhaupt die Macht besitzt, sie zu verhindern, an Aktualität.
In meiner Arbeit möchte ich die geläufigsten Möglichkeiten zur Lösung des Problems aufzeigen und deren Konsistenz diskutieren: Auf der einen Seite besteht nämlich die Möglichkeit zu argumentieren, daß Gott hinreichende, moralische Gründe besitzt, das Übel nicht zu verhindern; auf der anderen Seite wird versucht, das Problem zu umgehen,
indem man die Attribute Gottes modifiziert oder die Sichtweise auf das Übel ändert bzw. es leugnet. In meiner Darstellung möchte ich mich im Wesentlichen an Mackies Veröffentlichung „Das Problem des Übels“ aus dem Buch „Wunder des Theismus“ halten, und an David Humes Überlegungen, die er im zehnten und elften Kapitel der „Dialoge über natürliche Religion“ anstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Überblick
- Der theistische Gottesbegriff
- Exposition des Problems
- Das Theodizeeproblem aus analytischer Sicht
- Lösungsversuche
- Die Rechtfertigung des Übels
- Das Leid als Mittel zum Guten oder aus dem Guten folgt das Leid
- Die Welt ist besser mit Übeln
- Verteidigung mit Hilfe der Willensfreiheit
- Umgehung des Problems
- Gottes Existenz a priori annehmen
- Aufgeben oder Modifizieren einer Prämisse
- Aufgeben eines Gottesattributs
- Leugnung des Übels
- Die menschliche Vernunft ist zu begrenzt
- Die Rechtfertigung des Übels
- Resümee
- Schlußbetrachtung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Theodizee-Problem, welches sich mit der Frage nach der Vereinbarkeit von Gottes Güte und Allmacht mit dem Leid in der Welt beschäftigt. Der Fokus liegt darauf, verschiedene Lösungsansätze zu untersuchen und deren Konsistenz zu diskutieren.
- Die drei zentralen Attribute des theistischen Gottesbegriffs: Allwissenheit, Allmacht und Allgüte.
- Die Problematik, die aus der Existenz von Leid in der Welt entsteht, wenn man diese Attribute Gottes annimmt.
- Die verschiedenen Lösungsansätze, die entweder die Existenz von Leid rechtfertigen oder das Problem durch Modifizierung von Gottesattributen oder der Sichtweise auf das Übel umgehen.
- Die philosophischen Argumente und Kontroversen, die sich im Kontext des Theodizee-Problems ergeben.
- Die Rolle der menschlichen Vernunft in der Auseinandersetzung mit dem Theodizee-Problem.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in das Thema ein, indem es die Frage nach der Vereinbarkeit von Gottes Existenz mit dem Leid in der Welt aufwirft und die Bedeutung des Theodizee-Problems erläutert.
Der Abschnitt "Überblick" definiert den theistischen Gottesbegriff, beschreibt die drei Attribute Gottes (Allwissenheit, Allmacht, Allgüte) und stellt das Theodizee-Problem anhand der Frage nach der Vereinbarkeit von Gottes Eigenschaften mit dem Leid in der Welt dar.
Der Abschnitt "Lösungsversuche" untersucht verschiedene Ansätze, um das Theodizee-Problem zu lösen. Ein Ansatz liegt in der Rechtfertigung des Übels, indem man argumentiert, dass Gott hinreichende, moralische Gründe für das Zulassen von Leid hat. Ein anderer Ansatz besteht in der Umgehung des Problems, indem man die Attribute Gottes modifiziert oder die Sichtweise auf das Übel ändert bzw. es leugnet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind Theodizee, Gottesbeweise, Übel, Leid, Allwissenheit, Allmacht, Allgüte, Willensfreiheit, Rechtfertigung, anthropomorpher Gott, Mackie, Hume, Epikur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Theodizee-Problem?
Es ist die Frage, wie die Existenz eines allmächtigen, allgütigen und allwissenden Gottes mit dem Leiden und Übel in der Welt vereinbart werden kann.
Wer prägte den Begriff "Theodizee"?
Der Begriff wurde von Gottfried Wilhelm Leibniz eingeführt und bedeutet wörtlich "Rechtfertigung Gottes".
Wie lautet das Argument der Willensfreiheit?
Es besagt, dass Gott den Menschen Freiheit gewährt hat, was notwendigerweise die Möglichkeit einschließt, sich für das Böse zu entscheiden. Das Übel ist somit eine Folge menschlicher Freiheit.
Welche Lösungsansätze gibt es für das Problem des Leids?
Ansätze sind die Rechtfertigung des Übels als Mittel zum Guten, die Modifizierung von Gottesattributen (z.B. Gott ist nicht allmächtig) oder die Leugnung des Übels als bloßer Mangel an Gutem.
Welche Rolle spielt David Hume in der Debatte?
Hume kritisiert in seinen "Dialogen über natürliche Religion" die klassischen Rechtfertigungsversuche und zeigt die logischen Widersprüche des Theismus auf.
Warum wurde das Problem in der Neuzeit so aktuell?
Ereignisse wie das Erdbeben von Lissabon (1755) erschütterten das Vertrauen in eine göttliche Weltordnung und führten zu einer Emanzipation der Vernunft vom Glauben.
- Quote paper
- Markus Asano (Author), 2002, Das Theodizee-Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63087