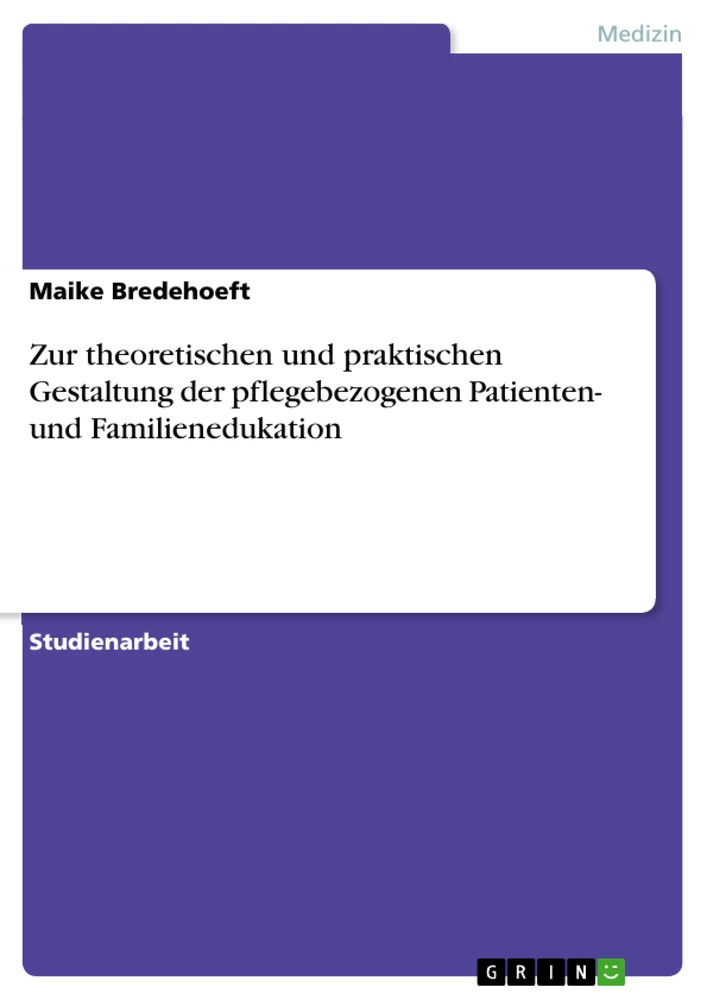Das Pflegewesen in Deutschland befindet sich im Umbruch: Zum einen steigen die Professionalisierungsbemühungen und zum anderen finden seit einigen Jahren Reformierungen des Gesundheitswesens statt, die allen voran mit der verbindlichen Einführung der DRG’s 2003, den damit verbundenen frühzeitigen Krankenhausentlassungen sowie der Verschiebung von stationären Leistungen in den ambulanten Sektor eine erhebliche Veränderung für den Pflegesektor bedeuten. Zudem dominieren stetig mehr chronisch degenerative Erkrankungen, die häufig komplexe Problemlagen für die Betoffenen mit sich bringen. Diese neue Situation stellen sowohl die Betroffenen selbst als auch alle anderen an der Pflege beteiligten Personen vor neuen Herausforderungen. So wird von Patienten und deren pflegenden Angehörigen zunehmend eine Entwicklung von Selbststrategien im Umgang mit körperlichen und psychischen Defiziten gefordert, während von beruflich Pflegenden langsam aber sicher eine Unterstützung bei der Bewältigung erwartet wird. Außerdem müssen sich Pflegekräfte mit der neuen Situation vertraut machen, dass die Betroffenen eine größtmögliche Unabhängigkeit erreichen wollen, eigene Entscheidungen treffen und selbst Experten bzgl. der Bewältigung ihrer Lebenssituation werden wollen (Abt-Zegelin, 1999; Kleinet al.,2001; Müller-Mundtet al.,2000; Statmeyer, 2005; Thomas & Wirnitzer, 2001).
Es ergibt sich also die Frage, wie die Pflege diesen Anforderungen gerecht werden kann. Eine diesbezügliche Methode im Rahmen der pflegerischen Beratung stellt das Konzept der pflegebezogenen Patienten- und Familienedukation dar, welches in der vorliegenden Arbeit näher erläutert werden soll. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, den Bezug von allgemeinen beratungstheoretischen Überlegungen zur Patienten- und Familienedukation herzustellen, um somit die inhaltlichen Aspekte dieser noch recht unbekannten Methodik im deutschen Pflegewesen im Hinblick auf die Anwendbarkeit in der pflegerischen Praxis zu durchleuchten. Das Subziel besteht darin, aus den daraus resultierenden Kenntnissen eigene kritische Überlegungen anzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorüberlegungen zur Patienten- und Familienedukation
- 2.1 Beratung in der Pflege- Definitionsansatz, Ziele und Problemaufriss
- 2.2 Beratungstheoretische Ansätze
- 2.3 Zur Rolle von Alltag und Lebenswelt
- 3. Pflegebezogene Patienten- und Familienedukation- theoretisches Gerüst
- 3.1 Historie und wissenschaftlicher Kontext
- 3.2 Definition und Zielsetzung
- 3.2.1 Informationen
- 3.2.2 Schulung
- 3.2.3 Beratung
- 3.3 Zur Qualifikation von edukativ Pflegenden
- 4. Pflegebezogene Patienten- und Familienedukation in der Praxis
- 4.1 Vom PIZ zum Netzwerk der Patienten- und Familienedukation
- 4.2 Das Modellprojekt des Kreiskrankenhauses München-Neuperlach
- 4.3. Das häusliche Setting
- 4.4 (Qualifikations-) Defizite und Aufgaben für das Pflegemanagement
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Gestaltung der pflegebezogenen Patienten- und Familienedukation. Sie analysiert die Relevanz dieses Konzepts im Kontext des sich wandelnden deutschen Pflegewesens und beleuchtet die Verbindung von allgemeinen Beratungstheoretischen Überlegungen zu Patienten- und Familienedukation. Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Methodik in der pflegerischen Praxis und leitet daraus eigene kritische Überlegungen ab.
- Entwicklung von Selbststrategien im Umgang mit körperlichen und psychischen Defiziten bei Patienten und deren pflegenden Angehörigen
- Rolle der pflegebezogenen Patienten- und Familienedukation als Methode im Rahmen der pflegerischen Beratung
- Anwendung und Umsetzung des Konzepts in der Praxis
- Herausforderungen und Aufgaben für das Pflegemanagement
- Analyse der aktuellen Situation im deutschen Pflegewesen und deren Auswirkungen auf die Patienten- und Familienedukation
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Bedeutung der Beratung in der Pflege als Ausgangspunkt für die Patienten- und Familienedukation. Es werden Definitionsansätze, Ziele und Problemaufrisse der pflegerischen Beratung diskutiert und Beratungstheoretische Ansätze vorgestellt. Weiterhin wird die Rolle des Alltags und der Lebenswelt von Patienten im Beratungsprozess beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit dem theoretischen Gerüst der Patienten- und Familienedukation. Es werden die historische Entwicklung und der wissenschaftliche Kontext des Konzepts, sowie die Definition und Zielsetzung von Patienten- und Familienedukation mit ihren verschiedenen Komponenten (Informationen, Schulung, Beratung) erläutert. Zusätzlich wird die Qualifikation von edukativ Pflegenden beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der praktischen Umsetzung der Patienten- und Familienedukation. Es werden verschiedene Aktivitäten und Projekte vorgestellt, darunter das Netzwerk der Patienten- und Familienedukation und das Modellprojekt des Kreiskrankenhauses München-Neuperlach. Außerdem werden die Schwierigkeiten bei der Umsetzung in der Praxis, sowie der häusliche Setting und Defizite und Aufgaben für das Pflegemanagement beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Patienten- und Familienedukation, Pflegeberatung, Beratungstheoretische Ansätze, Selbststrategien, chronisch degenerative Erkrankungen, Ressourcen, Kompetenzen, Qualifikation von edukativ Pflegenden, Pflegemanagement, Praxisanwendung, Modellprojekt, häusliche Pflege, Defizite, Aufgaben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist pflegebezogene Patienten- und Familienedukation?
Es handelt sich um eine Methode der pflegerischen Beratung, die darauf abzielt, Patienten und ihre Angehörigen durch Information, Schulung und Beratung zu befähigen, Selbststrategien im Umgang mit Krankheiten und Defiziten zu entwickeln.
Warum gewinnt dieses Konzept in Deutschland an Bedeutung?
Gründe sind die Professionalisierung der Pflege, die Einführung der DRGs (Fallpauschalen) mit kürzeren Krankenhausaufenthalten sowie die Zunahme chronisch-degenerativer Erkrankungen, die eine häusliche Bewältigung erfordern.
Welche drei Hauptkomponenten umfasst die Edukation?
Die Patienten- und Familienedukation setzt sich aus den drei Säulen Informationen, Schulung und Beratung zusammen.
Welche Praxisbeispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit nennt unter anderem das Netzwerk der Patienten- und Familienedukation sowie ein spezifisches Modellprojekt des Kreiskrankenhauses München-Neuperlach.
Welche Herausforderungen ergeben sich für das Pflegemanagement?
Das Pflegemanagement muss Qualifikationsdefizite bei den Mitarbeitern ausgleichen, da edukative Aufgaben eine spezifische Ausbildung und eine Neuausrichtung der pflegerischen Rolle erfordern.
- Arbeit zitieren
- Maike Bredehoeft (Autor:in), 2006, Zur theoretischen und praktischen Gestaltung der pflegebezogenen Patienten- und Familienedukation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63099