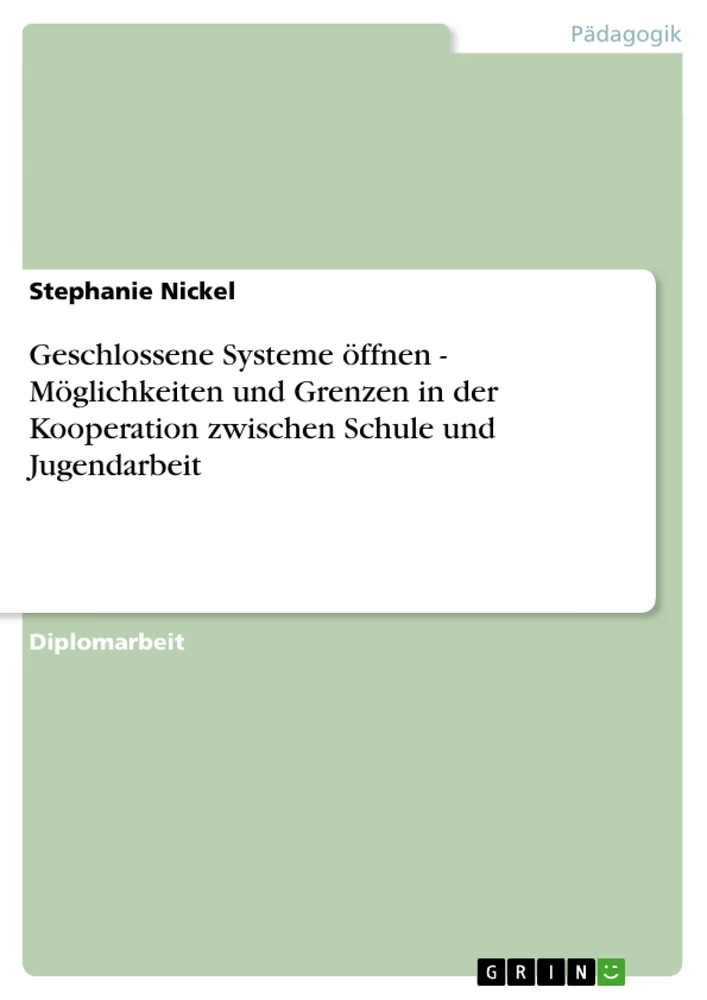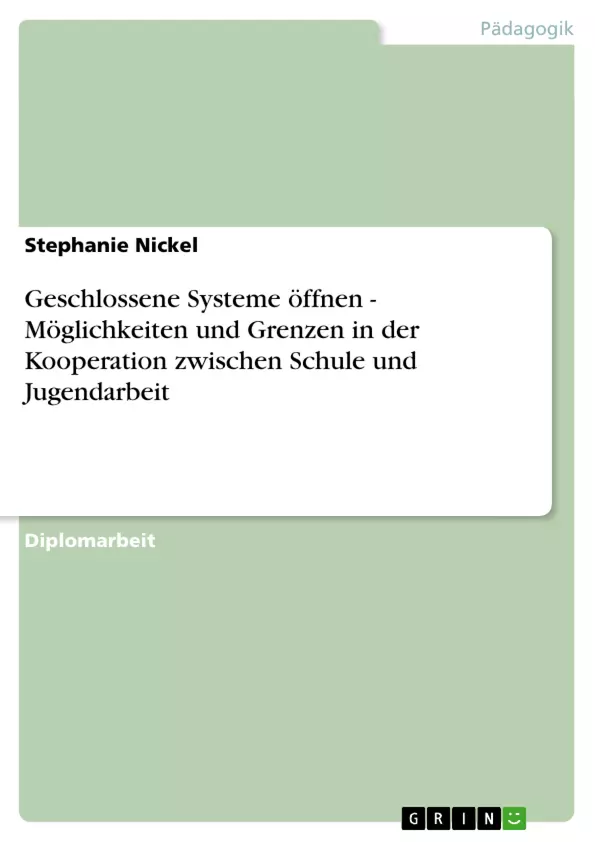Mit dem Beginn meiner Leitung des Schülercafés einer Teil Offenen Tür (TOT) in Aachen, konnte ich mir persönlich ein klares Bild über die Möglichkeiten und Grenzen in der Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit verschaffen. Das Schülercafé entstand als Kooperationsprojekt zwischen der TOT der evangelischen Kirchengemeinde und der benachbarten Gemeinschaftshauptschule. Durch meine praktische Tätigkeit im Schülercafé wurde mir sehr schnell bewusst, dass diese Kooperation von Offenheit und Akzeptanz begleitet wurde und somit zum Gelingen des Projektes maßgeblich beitrug. Leider musste ich feststellen, dass sich andere Kooperationsprojekte in der Praxis nicht immer durch partnerschaftliche Zusammenarbeit auszeichnen. Aufgrund dessen beschloss ich, mich im Rahmen meiner Diplomarbeit intensiv mit den Möglichkeiten und Grenzen einer Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit auseinander zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ein Problemaufriss
- 1.2 Fragestellungen und Zielsetzung
- 2 Begriffsbestimmung
- 2.1 Was ist ein System?
- 2.2 Was ist eine Schule?
- 2.2.1 Schule als soziales System
- 2.3 Was ist Jugendarbeit?
- 2.3.1 Jugendarbeit als soziales System
- 3 Historische und gesellschaftliche Aspekte zum Verhältnis von Schule und Jugendarbeit
- 3.1 Differenzierung von Schule und Jugendarbeit
- 3.2 Zum Verhältnis von Schule und Jugendarbeit seit den 70er Jahren
- 3.3 Folgen der postmodernen Gesellschaft
- 3.3.1 Die veränderte Jugend
- 3.3.2 Veränderungen für das System Schule
- 3.3.3 Veränderungen für das System Jugendarbeit
- 3.3.4 Zur Notwendigkeit einer Kooperation der beiden Systeme
- 4 Öffnung der Systeme – der Weg zur lernenden Organisation
- 4.1 Was ist eine Lernende Organisation?
- 4.1.1 Organisatorisches Lernen
- 4.1.2 Wie eine Organisation lernt
- 4.1.3 Die fünf Disziplinen auf dem Weg zur Lernenden Organisation
- 4.1.4 Vorteile einer Lernenden Organisation
- 4.2 Schule und Jugendarbeit als Lernende Organisation?
- 5 Mit mehr Kooperation gemeinsam neue Herausforderungen bestehen!
- 5.1 Rechtliche Grundlagen für eine Kooperation
- 5.1.1 Länderregelung
- 5.1.2 Bundesregelung
- 5.1.3 Resümee
- 5.2 Gemeinsame Handlungsmöglichkeiten von Schule und Jugendarbeit
- 5.2.1 Existieren Schnittmengen für eine Zusammenarbeit?
- 5.2.2 Schnittmengen für eine Zusammenarbeit suchen
- 5.2.3 Beispiele für gemeinsame Handlungsmöglichkeiten
- 5.3 Jugendarbeit und Schule – vom Unterschied profitieren beide
- 5.3.1 Jugendarbeit verfügt über Lebensräume – Schule benötigt Lebensräume
- 5.3.2 Schule verfügt über Konzepte – Jugendarbeit benötigt Konzepte
- 5.4 Stolpersteine – was macht die Kooperation so schwierig?
- 5.4.1 Zwei unterschiedliche Systeme kommen zusammen
- 5.4.2 Typische Stolpersteine
- 5.5 Bedingungen für eine gelingende Zusammenarbeit
- 5.5.1 Checkliste zur Planung eines gemeinsamen Projektes
- 5.5.2 Hilfsmittel der strukturellen Absicherung
- 5.5.3 Ein gelungenes Beispiel der Zusammenarbeit
- 5.6 Kooperation – zum Wohl der Kinder und Jugendlichen
- 5.7 Modelle aus der Praxis
- 5.7.1 Schulsozialarbeit
- 5.7.2 Schülercafé
- 5.7.3 Tage der Orientierung
- 5.7.4 Jugendberufshilfe
- 5.7.5 Schulorientierte Jugendarbeit
- 5.7.6 Stadtteilbezogene Jugendarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen einer verstärkten Zusammenarbeit aufzuzeigen und konkrete Handlungsempfehlungen für eine gelingende Kooperation zu entwickeln.
- Begriffsbestimmung und Systemanalyse von Schule und Jugendarbeit
- Historische Entwicklung und gesellschaftliche Veränderungen im Verhältnis von Schule und Jugendarbeit
- Das Konzept der lernenden Organisation im Kontext von Schule und Jugendarbeit
- Rechtliche Grundlagen und praktische Handlungsmöglichkeiten der Kooperation
- Herausforderungen und Bedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert das Problemfeld mangelnder Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit und formuliert die Forschungsfragen und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas für die soziale Arbeit herausgestellt und der Forschungsansatz erläutert.
2 Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „System“, „Schule“ und „Jugendarbeit“. Es beschreibt Schule und Jugendarbeit als soziale Systeme mit ihren jeweiligen Strukturen, Funktionen und Zielen. Die Abgrenzung der beiden Systeme und ihre jeweiligen spezifischen Charakteristika werden detailliert dargestellt. Die Grundlage für die Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation wird hier gelegt.
3 Historische und gesellschaftliche Aspekte zum Verhältnis von Schule und Jugendarbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Verhältnisses von Schule und Jugendarbeit und analysiert die Einflüsse gesellschaftlicher Veränderungen, insbesondere der Postmoderne, auf beide Systeme. Es werden die Entwicklungen in der Jugendarbeit und im Schulsystem parallel betrachtet, um die Herausforderungen zu identifizieren, welche die Notwendigkeit einer verstärkten Kooperation hervorrufen.
4 Öffnung der Systeme – der Weg zur lernenden Organisation: Dieses Kapitel beschreibt das Konzept der lernenden Organisation und analysiert, inwiefern Schule und Jugendarbeit als lernende Organisationen verstanden und gestaltet werden können. Die fünf Disziplinen des organisationalen Lernens werden vorgestellt und auf die beiden Systeme angewendet. Es wird untersucht, wie die Öffnung der Systeme zu einer verbesserten Kooperation beitragen kann.
5 Mit mehr Kooperation gemeinsam neue Herausforderungen bestehen!: Dieser zentrale Abschnitt widmet sich den Möglichkeiten und Herausforderungen einer verstärkten Kooperation. Es werden rechtliche Grundlagen beleuchtet und konkrete Handlungsansätze für die Zusammenarbeit entwickelt. Beispiele aus der Praxis werden präsentiert, Stolpersteine der Kooperation benannt, und Bedingungen für eine gelingende Zusammenarbeit formuliert. Es wird der Mehrwert einer Kooperation für Kinder und Jugendliche deutlich gemacht.
Schlüsselwörter
Schule, Jugendarbeit, Kooperation, soziale Systeme, lernende Organisation, organisationales Lernen, gesellschaftliche Veränderungen, Rechtliche Grundlagen, Handlungsstrategien, Kinder und Jugendliche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit. Sie analysiert die beiden Systeme, ihre historische Entwicklung, die Einflüsse gesellschaftlicher Veränderungen und beleuchtet rechtliche Grundlagen und praktische Handlungsansätze für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Im Fokus stehen Herausforderungen, Chancen und konkrete Empfehlungen für eine gelingende Kooperation zum Wohle der Kinder und Jugendlichen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenschwerpunkte: Begriffsbestimmung und Systemanalyse von Schule und Jugendarbeit; historische Entwicklung und gesellschaftliche Veränderungen im Verhältnis der beiden Systeme; das Konzept der lernenden Organisation im Kontext von Schule und Jugendarbeit; rechtliche Grundlagen und praktische Handlungsmöglichkeiten der Kooperation; Herausforderungen und Bedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit; sowie konkrete Beispiele aus der Praxis (z.B. Schulsozialarbeit, Schülercafé).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung mit Problembeschreibung und Forschungsfragen; Begriffsbestimmung von Schule und Jugendarbeit als soziale Systeme; historische und gesellschaftliche Aspekte des Verhältnisses beider Systeme; das Konzept der lernenden Organisation im Kontext von Schule und Jugendarbeit; und Möglichkeiten und Herausforderungen einer verstärkten Kooperation mit konkreten Handlungsempfehlungen und Praxisbeispielen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen und Chancen einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendarbeit aufzuzeigen und konkrete Handlungsempfehlungen für eine gelingende Kooperation zu entwickeln. Es soll der Mehrwert einer Kooperation für Kinder und Jugendliche deutlich gemacht werden.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Schule, Jugendarbeit, Kooperation, soziale Systeme, lernende Organisation, organisatorisches Lernen, gesellschaftliche Veränderungen, rechtliche Grundlagen, Handlungsstrategien, Kinder und Jugendliche.
Welche konkreten Beispiele für eine Zusammenarbeit werden genannt?
Die Arbeit nennt verschiedene Praxisbeispiele für eine erfolgreiche Kooperation, darunter Schulsozialarbeit, Schülercafés, Tage der Orientierung, Jugendberufshilfe, schulorientierte und stadtteilbezogene Jugendarbeit.
Welche Herausforderungen und Stolpersteine einer Kooperation werden angesprochen?
Die Arbeit benennt typische Stolpersteine wie die unterschiedlichen Strukturen und Ziele der beiden Systeme. Es werden konkrete Herausforderungen und mögliche Lösungen für eine gelingende Zusammenarbeit diskutiert.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die relevanten rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Länderebene, die eine Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit ermöglichen oder beeinflussen.
Was versteht die Arbeit unter einer „lernenden Organisation“?
Die Arbeit erklärt das Konzept der lernenden Organisation und untersucht, inwiefern Schule und Jugendarbeit als lernende Organisationen gestaltet werden können. Die fünf Disziplinen des organisationalen Lernens werden im Kontext der Kooperation angewendet.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendarbeit befassen, insbesondere für Pädagogen, Sozialarbeiter, Mitarbeiter in der Jugendarbeit und für politische Entscheidungsträger im Bildungsbereich.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Soz.Päd/Soz.Arb. Stephanie Nickel (Autor:in), 2006, Geschlossene Systeme öffnen - Möglichkeiten und Grenzen in der Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63127