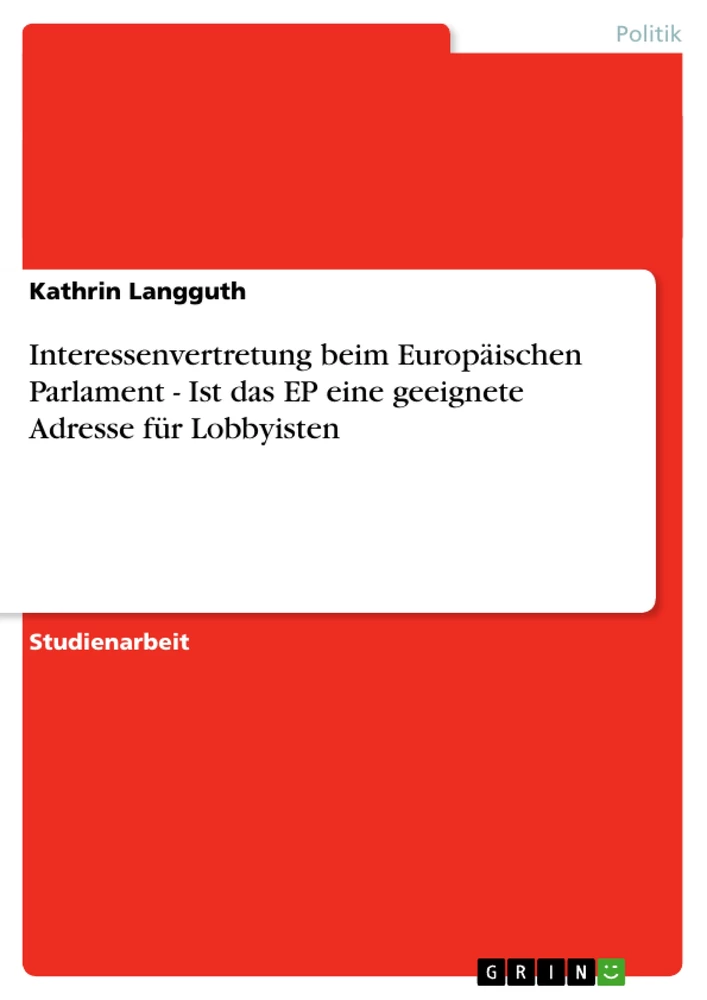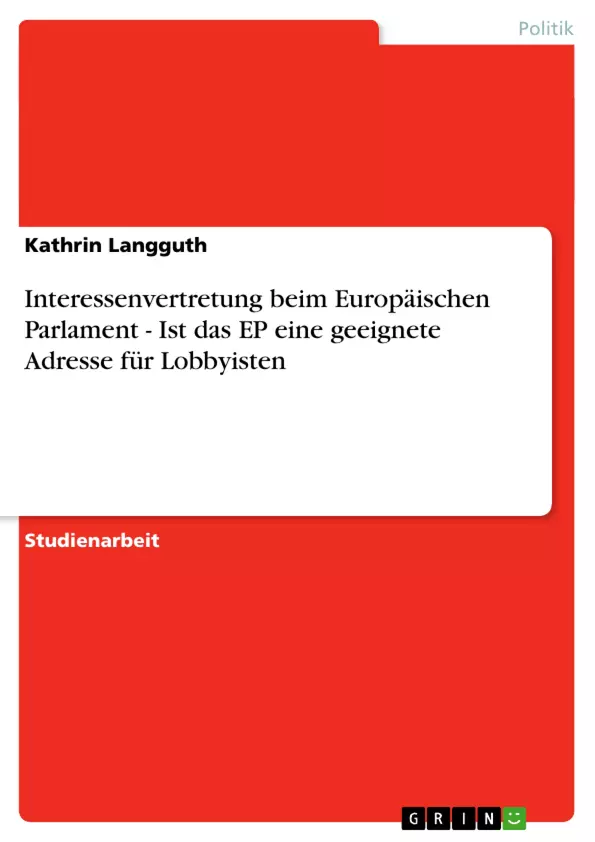Wird im politischen Diskurs von Interessenvermittlung und Lobbying gesprochen, so wird dies als elementarer Bestandteil der Willensbildung in pluralistischen Demokratien gesehen. In der öffentlichen Wahrnehmung herrscht dagegen ein zum Teil negatives Bild vom Lobbying vor, da es häufig in Zusammenhang mit Bestechungen und Spendenskandalen gebracht wird. Hierbei variiert die Meinung über Lobbying innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. In Großbritannien bspw. gehört der Lobbyismus zum normalen politischen Alltag, wogegen diese Form der Interessenvertretung in Lateinischen Ländern oder auch Deutschland eher kritisch beobachtet wird (Kohler-Koch 1997, 11). Dabei bedeutet der Begriff ‚Lobbying’ an und für sich nichts weiter als „der Versuch der Beeinflussung von Entscheidungsträgern durch Dritte“ (Fischer 1997, 35).
Auf europäischer Ebene kommt dem Lobbyismus, bedingt durch das Mehrebenensystem der Europäischen Union, eine ganz besondere Rolle zu. Neben der Mischung von intergovernementalen und supranationalen Elementen ist es vor allem die Verteilung von Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen, die charakteristisch für die Struktur des Europäischen Systems ist. Dadurch haben Interessenvertreter die Möglichkeit, über unterschiedlichste Kanäle, Institutionen und Ansprechpartner ihre jeweiligen Anliegen zu artikulieren. Diese Fülle an Verantwortlichkeiten und Anlaufstellen lassen zeitweise Vorbehalte aufkommen, die eine effiziente Interessenvertretung in dieser ‚Lobbykratie’ bezweifeln. Gleichzeitig liegt in dieser Kritik aber auch der Vorteil der Europäischen Mehrebenestruktur, denn jeder Interessenvertreter hat die Chance, einen passenden Ansprechpartner zu finden. Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, für welche Interessengruppen die Lobbyarbeit beim Europäischen Parlament besonders attraktiv ist. Hierbei steht vor allem die eventuelle Bevorzugung wirtschaftlicher Interessen gegenüber zivilgesellschaftlicher Interessen im Fokus der Untersuchung. Bezüglich der Abgrenzung zivilgesellschaftlicher Interessengruppen gibt es in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedlichste Auffassungen. So werden teilweise alle freiwilligen Assoziationen zwischen Familie, Staat und Markt in diesen Bereich mInteressenvertretung beim Europäischen Parlament Kathrin Langguth gezählt, darunter Genossenschaften, Wohlfahrtsverbände, Parteien, Stiftungen, Gewerkschaften und soziale Bewegungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Europäische Parlament im Institutionengefüge der Europäischen Union
- 3 Rahmenbedingungen für die Lobbyarbeit beim Europäischen Parlament
- 3.1 Implikationen für die Lobbyarbeit aus dem Entscheidungsprozess
- 3.2 Anzahl und Art der Lobbyisten in Brüssel
- 3.3 Regulierung des Lobbyismus beim Europäischen Parlament
- 4 Lobbyarbeit beim Europäischen Parlament
- 4.1 Beweggründe des Europäischen Parlamentes für die Zusammenarbeit mit Interessenvertretern
- 4.1.1 Das Selbstverständnis des Europäischen Parlamentes
- 4.1.2 Politische und strategische Gründe für den offenen Umgang mit Interessenvertretern
- 4.1.3 Streben nach mehr Legitimation
- 4.1.4 Informationsbedarf des Europäischen Parlamentes
- 4.2 Interessenvertretung in den einzelnen Einrichtungen des Europäischen Parlamentes
- 4.2.1 Parlament
- 4.2.2 Ausschüsse
- 4.2.3 Plenum
- 4.2.4 Parlamentarier
- 4.2.5 Intergoups
- 4.1 Beweggründe des Europäischen Parlamentes für die Zusammenarbeit mit Interessenvertretern
- 5 Die Lobbyakteure beim Europäischen Parlament
- 5.1 Eingliederung nach Ressourcen der Akteure
- 5.2 Eingliederung nach Anzahl der Stakeholder der Akteure
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Interessengruppen von der Lobbyarbeit beim Europäischen Parlament besonders profitieren. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob wirtschaftliche Interessen gegenüber zivilgesellschaftlichen Interessen bevorzugt werden. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des Europäischen Parlamentes im Institutionengefüge der Europäischen Union und leitet daraus Implikationen für die Lobbyarbeit ab.
- Bedeutung des Europäischen Parlaments im Entscheidungsprozess der Europäischen Union
- Rahmenbedingungen für die Lobbyarbeit beim Europäischen Parlament, insbesondere die wachsende Zahl an Lobbyisten
- Gründe des Europäischen Parlamentes für die Zusammenarbeit mit Interessenvertretern
- Konkrete Beteiligungsmöglichkeiten von Interessenvertretern im Europäischen Parlament, seinen Entscheidungsgremien und bei Mitgliedern
- Analyse der Akteurskonstellationen, die Lobbyarbeit beim Europäischen Parlament betreiben
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Rolle des Lobbyismus im politischen Diskurs und zeigt die unterschiedliche Wahrnehmung des Lobbyismus in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten auf. Kapitel 2 analysiert die Bedeutung des Europäischen Parlamentes im Institutionengefüge der Europäischen Union und beleuchtet seinen Bedeutungszuwachs im Europäischen Entscheidungsprozess.
Kapitel 3 untersucht die Rahmenbedingungen für die Lobbyarbeit beim Europäischen Parlament. Dabei werden die Implikationen des Entscheidungsprozesses für die Lobbyarbeit sowie die Anzahl und Art der Lobbyisten in Brüssel betrachtet.
Kapitel 4 widmet sich der detaillierten Analyse der Lobbymöglichkeiten beim Europäischen Parlament. Es werden die Gründe des Europäischen Parlamentes für die Zusammenarbeit mit Lobbyisten, die konkreten Beteiligungsmöglichkeiten von Interessenvertretern und deren Zugang, Inklusion und Transparenz untersucht.
Kapitel 5 analysiert die Akteurskonstellationen, die Lobbyarbeit beim Europäischen Parlament betreiben, um die Frage zu beantworten, für welche Akteure die Lobbyarbeit besonders attraktiv ist.
Schlüsselwörter
Lobbyismus, Interessenvertretung, Europäisches Parlament, Europäische Union, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, politische Entscheidungsprozesse, Zugang, Inklusion, Transparenz.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Europäische Parlament ein attraktives Ziel für Lobbyisten?
Ja, aufgrund seines wachsenden Einflusses im EU-Entscheidungsprozess ist das EP eine zentrale Anlaufstelle für Interessenvertreter aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft geworden.
Werden wirtschaftliche Interessen im EP bevorzugt?
Die Arbeit untersucht genau dieses Spannungsfeld und analysiert, ob ressourcenstarke Wirtschaftsverbände einen besseren Zugang zu Abgeordneten haben als zivilgesellschaftliche Gruppen.
Warum arbeitet das Europäische Parlament mit Interessenvertretern zusammen?
Das Parlament nutzt Lobbyisten als Informationsquelle für technisches Expertenwissen und strebt durch den Austausch eine höhere politische Legitimation seiner Entscheidungen an.
Wo genau findet Lobbying im Europäischen Parlament statt?
Zentrale Orte sind die parlamentarischen Ausschüsse, die Fraktionen, Intergroups sowie die direkten Büros der einzelnen Parlamentarier.
Wie wird Lobbyismus beim Europäischen Parlament reguliert?
Es existieren Regelungen zur Registrierung und Transparenz, die sicherstellen sollen, dass die Einflussnahme nachvollziehbar bleibt und ethische Standards gewahrt werden.
- Quote paper
- Kathrin Langguth (Author), 2006, Interessenvertretung beim Europäischen Parlament - Ist das EP eine geeignete Adresse für Lobbyisten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63133