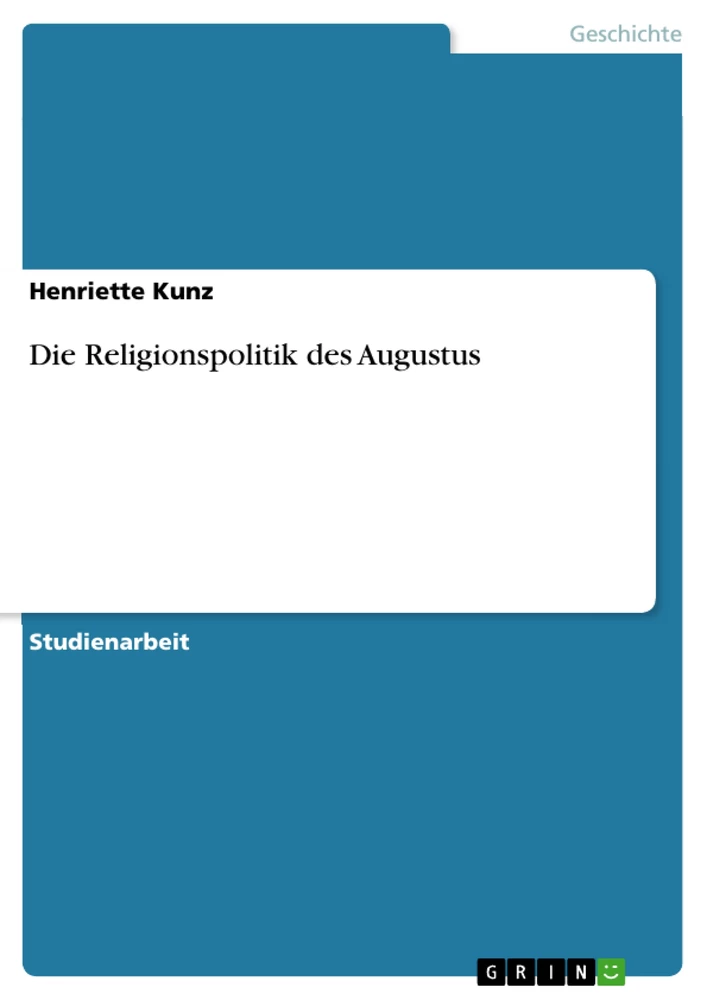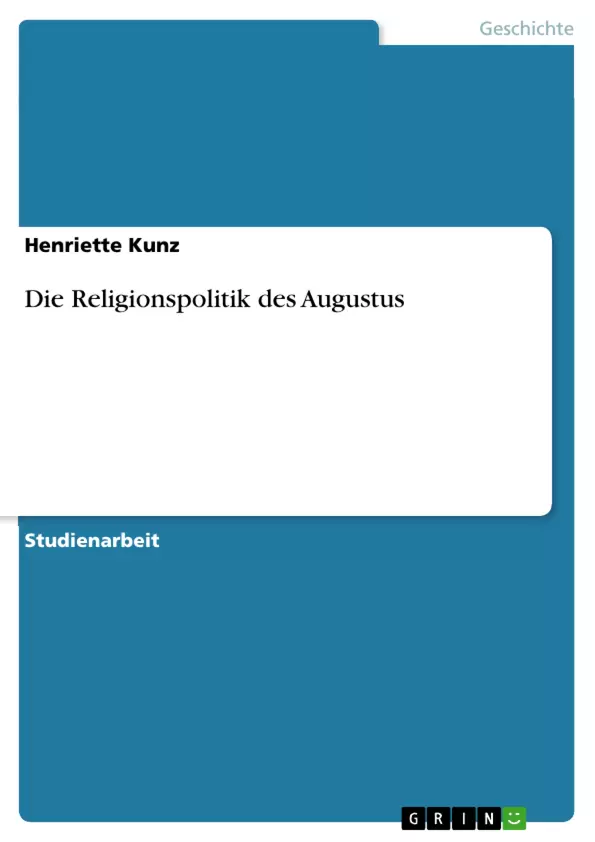Geprägt durch Bürgerkriege und Orientierungslosigkeit war die Zeit, die diesem Ereignis vorausging, für viele Zeitgenossen eine einschneidende Negativerfahrung. Als ein bedeutendes Element wurde dabei der Verfall, der sich in der späten Republik bezüglich der römischen Staatreligion beobachten lässt, angesehen, denn die politische Katastrophe führte man größtenteils auf den Zorn der Götter zurück, dem man sich hilflos ausgeliefert fühlte. Jener wiederum fand in der damaligen Meinung seine Ursache in der inkorrekten Befolgung des religiösen Rituals und dem Missbrauch der sakralen Ämter zu rein machtpolitischen Zwecken.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das persönliche Verhältnis Augustus' zur Religion
- III. Die Religionspolitik des Augustus
- III. 1. Die Anknüpfung an Caesar und die mythologisch-genealogischen Grundlagen
- III. 2. Apollo und die Verdrängung des kapitolinischen Kultes.
- III. 3. Die Restauration und Neuinterpretation der alten Tradition...
- V. Quellen- und Literaturverzeichnis
- 1. Quellen
- 2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Religionspolitik des römischen Kaisers Augustus und untersucht, wie diese die politische Ordnung des Principats stabilisierte und gleichzeitig traditionelle religiöse Strukturen bewahrte. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Augustus die römische Religion als Instrument zur Legitimation seiner Herrschaft nutzte und zugleich an die traditionellen Werte und Rituale anknüpfte.
- Die Restauration und Neuinterpretation der römischen Staatsreligion
- Augustus' persönliches Verhältnis zur Religion und seine Rolle als Pontifex Maximus
- Die Integration des Kaiserkults in die bestehende religiöse Ordnung
- Die Bedeutung der mythologisch-genealogischen Grundlagen für die Legitimation des Principats
- Die Rolle des Apollo und die Verdrängung des kapitolinischen Kultes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die politische und gesellschaftliche Situation im späten Römischen Reich, die von Bürgerkriegen und Orientierungslosigkeit geprägt war. Der Verfall der römischen Staatsreligion und die damit verbundene Angst vor dem Zorn der Götter werden als wichtige Faktoren für die instabile politische Situation dargestellt. Der Sieg des jungen Octavian über Marcus Antonius und Kleopatra im Jahre 31 v. Chr. bei Actium wird als ein Hoffnungsschimmer für einen möglichen, dauerhaften Frieden und eine klare politische Richtung betrachtet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem persönlichen Verhältnis Augustus' zur römischen Religion und untersucht seine Haltung gegenüber der traditionellen Staatsreligion. Dabei werden verschiedene Quellen herangezogen, um ein Bild von Augustus' religiösen Ansichten und seiner Rolle als Pontifex Maximus zu zeichnen.
Das dritte Kapitel behandelt die zentralen Aspekte der Augusteischen Religionspolitik, wobei die mythologisch-genealogischen Grundlagen, die Bevorzugung des Apollo sowie die Wiederherstellung und die Neuinterpretation der alten Traditionen im Fokus stehen. Es wird untersucht, wie Augustus die traditionelle römische Religion nutzte, um seine Herrschaft zu legitimieren und gleichzeitig eine neue, stabile politische Ordnung zu schaffen.
Schlüsselwörter
Augustus, Religionspolitik, Römische Religion, Staatsreligion, Kaiserkult, Tradition, Neuinterpretation, Legitimation, Pontifex Maximus, Apollo, Verdrängung, Restauration, Mythologie, Genealogie, Actium, Bürgerkriege, Pax Deorum.
- Arbeit zitieren
- Henriette Kunz (Autor:in), 2006, Die Religionspolitik des Augustus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63216