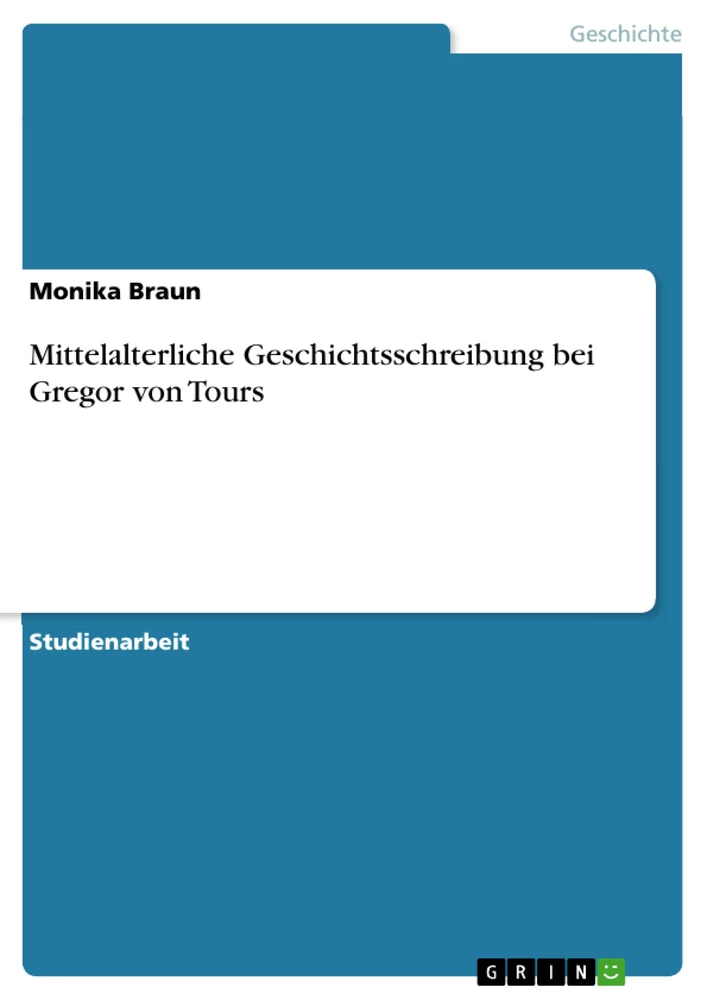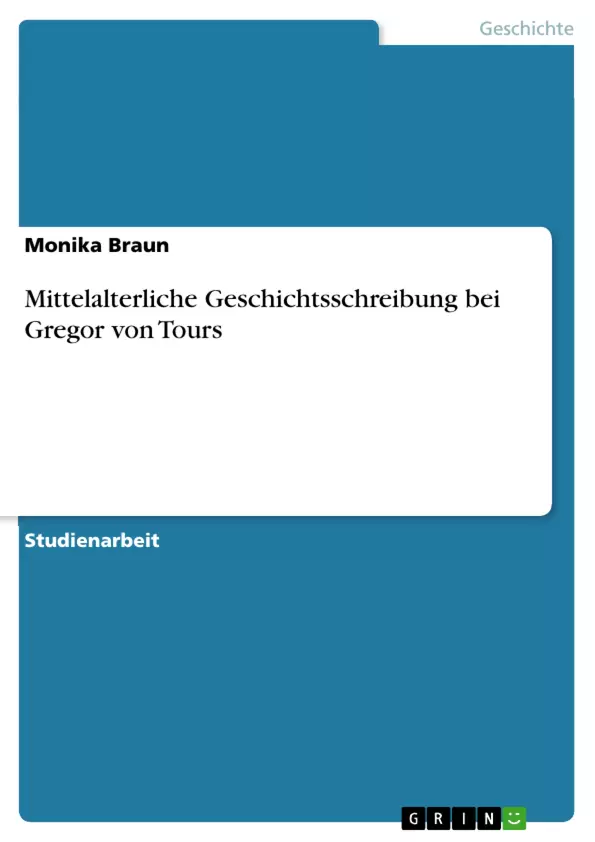Gregor von Tours wurde am 30. November 538 oder 539 in Clermont geboren. 1 Sein eigentlicher Name war Georgius Florentius. Er gehörte einer Familie des romanischen Senatorenadels an und war schon der Abstammung nach für ein hohes Amt in Staat oder Kirche prädestiniert. Viele seiner Vorfahren und Verwandten waren Bischöfe, so war z. B. sein Onkel Bischof von Clermont 2 . Nach dem Tod des Vaters wuchs Gregor bei ihm auf. Als Jugendlicher leistete er während einer schweren Krankheit den Schwur, im Falle seiner Genesung Geistlicher zu werden. 573 wurde er schließlich, als Nachfolger seines Cousins Eufronius, Bischof von Tours. Inmitten der fränkischen Bürgerkriege waren die ersten zwölf Jahre seines Episkopats von politischen Unruhen geprägt. König Chilperich hatte durch die gewaltsame Eroberung der Stadt 575 seinen Neffen Childebert seines Erbes beraubt. Gregor hielt Childebert 3 die Treue und verteidigte die Unabhängigkeit der Kirche, insbesondere das politische Asylrecht der Martinsbasilika, gegenüber der weltlichen Obrigkeit. In Folge dessen geriet er in den Verdacht, gegen Chilperich zu konspirieren. 580 musste er sich vor der Synode von Berny verantworten, wo er sich allerdings durch einen Eid von allen Verdächtigungen freisprechen konnte. So gelang es ihm, das Vertrauen des Königs zurückzugewinnen und wurde sogar sein Berater in theologischen Fragen. 4 Es war Gregor ein persönliches Anliegen, als Geschichtsschreiber von den Verhältnissen seiner Zeit Zeugnis abzulegen. Neben seinen hagiographischen Werken arbeitete er während seiner gesamten Amtszeit an den Libri historiarum decem (Zehn Bücher Geschichten), die im Nachhinein auch „Frankengeschichte“ genannt werden. 5 Sie enden im Jahre 594, in dem auch Gregors Leben zu Ende ging. Als Todesdatum geht man vom 17. November 594 aus. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mittelalterliche Geschichtsschreibung und Gregors Konzeption der Libri historiarum decem
- Geschichtsschreibung im 6. Jahrhundert
- Form und Aufbau der Libri historiarum decem
- Geschichte als Heilsgeschichte bei Gregor von Tours
- Die Frage nach dem ersten Frankenkönig: Ein Beispiel für Gregors Gestaltungswillen
- Schluss: Gregors Darstellungsinteresse – Der göttliche Heilsplan in der Geschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion und Form mittelalterlicher Geschichtsschreibung anhand der „Libri historiarum decem“ von Gregor von Tours. Das Hauptziel besteht darin, Gregors Intentionen und die Gestaltungsmittel seiner Geschichtsschreibung zu analysieren und im Kontext der mittelalterlichen Geschichtsschreibung zu verorten.
- Mittelalterliche Geschichtsschreibung als zweckorientiertes Unterfangen
- Gregors Konzeption von Geschichte als Heilsgeschichte
- Analyse von Gregors Gestaltungswillen und seiner Auswahl historischer Ereignisse
- Die Rolle des Publikums und der historischen Wahrheit in Gregors Werk
- Der Einfluss theologischer und politischer Aspekte auf die Geschichtsschreibung Gregors
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Gregor von Tours, sein Leben und seine Bedeutung als Geschichtsschreiber vor. Sie führt in die Thematik der Arbeit ein und skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf die Analyse der „Libri historiarum decem“ im Hinblick auf Funktion und Form mittelalterlicher Geschichtsschreibung konzentriert. Besonders wird der Verzicht auf eine detaillierte Darstellung der politischen Ereignisse hervorgehoben, um den Fokus auf die historiographische Arbeitsweise des Autors zu legen.
Mittelalterliche Geschichtsschreibung und Gregors Konzeption der Libri historiarum decem: Dieses Kapitel untersucht die Merkmale mittelalterlicher Geschichtsschreibung im Allgemeinen und im 6. Jahrhundert im Besonderen. Es beleuchtet die Zweckorientierung mittelalterlicher Geschichtsschreibung, die auf verschiedene Absichten wie rechtliche, ethische und politische Zielsetzungen zurückzuführen ist. Der Einfluss theologischer Fragen auf Gregors Geschichtsschreibung wird als ein zentraler Aspekt hervorgehoben. Weiterhin wird der begrenzte Rezipientenkreis mittelalterlicher Historiographie diskutiert und der Unterschied zwischen dem mittelalterlichen und dem modernen Verständnis von „geschichtlicher Wahrheit“ angedeutet.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Geschichtsschreibung, Gregor von Tours, Libri historiarum decem, Frankengeschichte, Heilsgeschichte, Historiographie, 6. Jahrhundert, Gallien, Gestaltungswillen, politische Intentionen, theologische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen zu: Gregor von Tours und seine "Libri historiarum decem"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die "Libri historiarum decem" von Gregor von Tours, um die Funktion und Form mittelalterlicher Geschichtsschreibung zu untersuchen. Der Fokus liegt auf Gregors Intentionen, seinen Gestaltungsmitteln und der Einordnung seines Werkes in den Kontext der mittelalterlichen Geschichtsschreibung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie mittelalterliche Geschichtsschreibung als zweckorientiertes Unterfangen, Gregors Konzeption von Geschichte als Heilsgeschichte, die Analyse seines Gestaltungswillens und seiner Auswahl historischer Ereignisse, die Rolle des Publikums und der historischen Wahrheit in Gregors Werk sowie den Einfluss theologischer und politischer Aspekte auf seine Geschichtsschreibung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über mittelalterliche Geschichtsschreibung und Gregors Konzeption der "Libri historiarum decem", ein Kapitel zur Frage nach dem ersten Frankenkönig als Beispiel für Gregors Gestaltungswillen und einen Schluss, der sich mit Gregors Darstellungsinteresse und dem göttlichen Heilsplan in der Geschichte befasst. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Aspekte mittelalterlicher Geschichtsschreibung werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Zweckorientierung mittelalterlicher Geschichtsschreibung (rechtliche, ethische, politische Zielsetzungen), den Einfluss theologischer Fragen, den begrenzten Rezipientenkreis und den Unterschied zwischen mittelalterlichem und modernem Verständnis von "geschichtlicher Wahrheit". Sie betrachtet auch die Geschichtsschreibung des 6. Jahrhunderts im Besonderen.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse von Gregors Intentionen und Gestaltungsmitteln in seinen "Libri historiarum decem" und deren Einordnung in den Kontext der mittelalterlichen Geschichtsschreibung. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die historiographische Arbeitsweise Gregors und verzichtet auf eine detaillierte Darstellung der politischen Ereignisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mittelalterliche Geschichtsschreibung, Gregor von Tours, Libri historiarum decem, Frankengeschichte, Heilsgeschichte, Historiographie, 6. Jahrhundert, Gallien, Gestaltungswillen, politische Intentionen, theologische Aspekte.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt Gregor von Tours, sein Leben und seine Bedeutung als Geschichtsschreiber vor. Sie führt in die Thematik der Arbeit ein und skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf die Analyse der "Libri historiarum decem" im Hinblick auf Funktion und Form mittelalterlicher Geschichtsschreibung konzentriert. Der Verzicht auf eine detaillierte Darstellung der politischen Ereignisse wird hervorgehoben.
Was wird im Kapitel über mittelalterliche Geschichtsschreibung behandelt?
Dieses Kapitel untersucht Merkmale mittelalterlicher Geschichtsschreibung im Allgemeinen und im 6. Jahrhundert im Besonderen. Es beleuchtet die Zweckorientierung, den Einfluss theologischer Fragen auf Gregors Geschichtsschreibung, den begrenzten Rezipientenkreis und den Unterschied zwischen mittelalterlichem und modernem Verständnis von „geschichtlicher Wahrheit“.
- Arbeit zitieren
- Monika Braun (Autor:in), 2001, Mittelalterliche Geschichtsschreibung bei Gregor von Tours, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63223