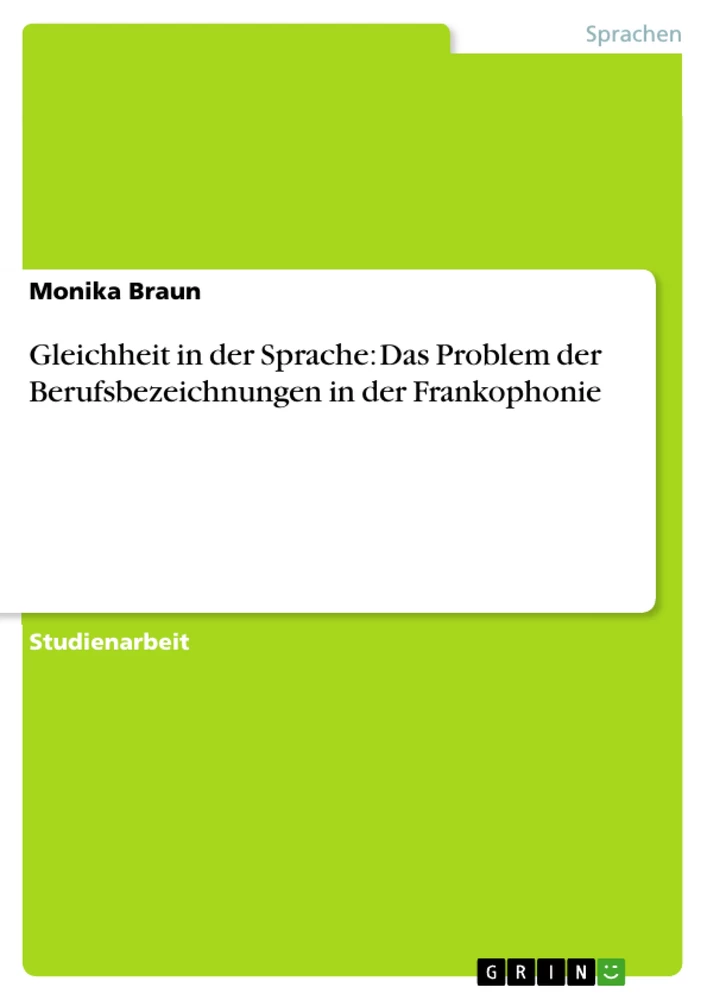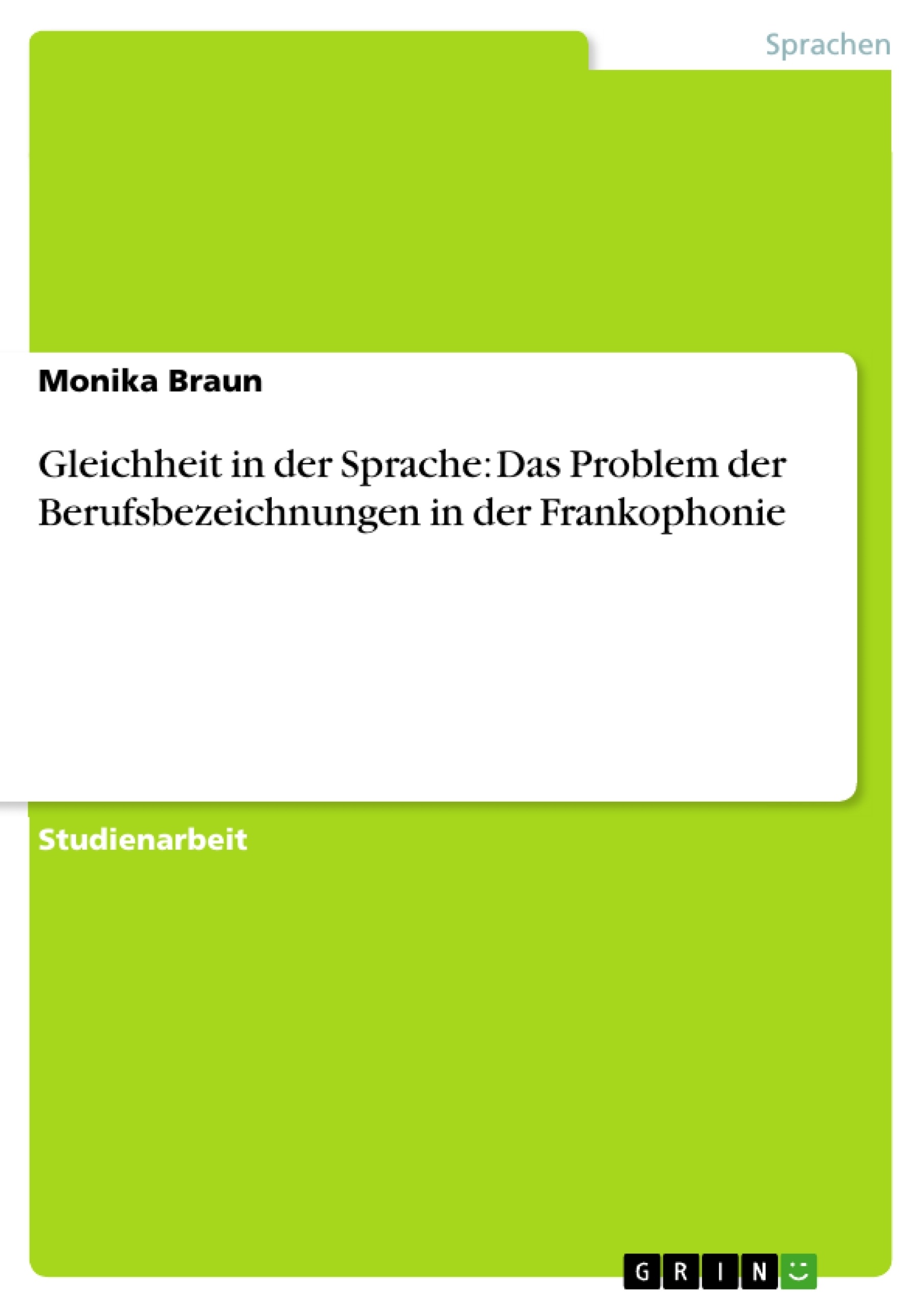Während meines Studienjahres in Frankreich wohnte ich neben einer Familie mit einer ungefähr sechsjährigen Tochter. Diese hatte eines Tages in der Schule ihre erste ärztliche Untersuchung. Am folgenden Nachmittag begegnete ich ihr mit der Frage: „Et alors, qu’est-ce qu’il t’a dit, le docteur?“ worauf mir das Mädchen schlicht ant-wortete: „Ce n’était pas un docteur, c’était une femme!“ Wie alle romanischen Sprachen hat die französische Sprache zwei grammatikalische Genera: das weibliche und das männliche. In den geschlechtsneutralen Sprachen (z.B. Türksprachen, Englisch etc.) gibt es keine Nominalklassen, alle Substantiva sind also gleichwertig. In französischen Grammatik- und Wörterbüchern scheint das Maskulinum als Grundform und das Femininum gleichsam als dessen Abänderungung. Ähnlich wie in der Genesis von Adam und Eva berichtet, war also zuerst die männliche Form da, aus der das Weibliche hervorging, ja sozusagen abgezweigt wurde. Die französische Sprache ist also nicht geschlechtlich neutral. Dieser Um-stand bringt es mit sich, dass mit dem grammatischen Geschlecht eines Wortes oft auch eine Konstruktion von Geschlecht transportiert wird, die aus Traditionen und gesellschaftlichen Normen entstand. Dieses Konzept von Geschlecht als Ergebnis von Tradition und Wertevorstellung in einer Gesellschaft nennt man Gender. 1 Inwiefern Sprache dieses Konzept transportiert, ist Gegenstand der feministischen Linguistik und Gender-Linguistik. In der vorliegenden Arbeit geht es im Kern um eine spezielle Art von Wörtern im Französischen, die die Vorstellungen von Geschlechterrollen widerspiegeln: die Berufsbezeichnungen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Gender in der Linguistik
- Genderkategorien
- Ungleichheiten von Gender und Genus
- Inversion des Genus
- Generische Genera
- Das generische Maskulin
- Generisches Maskulin und Feminin
- Das Problem der Berufsbezeichnungen
- Académie francaise vs. Institut national de la langue française
- Schwierigkeiten im Gebrauch
- Geschlechtsneutrale Sprache in der Frankophonie
- Belgien
- Frankreich
- Luxemburg
- Quebec
- Die französische Schweiz
- Afrika
- Die Stellung der Frau in der Gesellschaft in Afrika
- Die Stellung der Frau in Mali
- Das Bildungssystem in Mali
- Musow – eine Frauenzeitschrift aus Mali
- Geschlechtlichkeit der Sprache in Musow
- Versuche einer geschlechtsneutralen Schreibweise
- Das männliche Genus als Allgemeinform
- Die männliche Form als Berufsbezeichnung für eine bestimmte Frau
- Mischform: weibliche Form als Berufsbezeichnung für eine bestimmte Frau / männliche Form der Berufsbezeichnung als Allgemeinform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik geschlechtsbezogener Ungleichheiten in der französischen Sprache, insbesondere im Kontext von Berufsbezeichnungen. Sie analysiert die Beziehung zwischen grammatischem Genus und sozial konstruiertem Gender und beleuchtet die Debatte um geschlechtsneutrale Sprache in verschiedenen frankophonen Regionen.
- Der Zusammenhang zwischen grammatischem Genus und Gender im Französischen
- Die Herausforderungen der Feminisierung von Berufsbezeichnungen
- Die unterschiedlichen Ansätze zur geschlechtsneutralen Sprache in der Frankophonie
- Die Rolle der Frau in der Gesellschaft französischsprachiger afrikanischer Länder
- Sprachliche Repräsentation von Gender in einer malischen Frauenzeitschrift
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung beginnt mit einer Anekdote, die den Unterschied zwischen grammatischem Geschlecht und sozialem Geschlecht im Französischen veranschaulicht. Sie führt den Begriff Gender ein und erklärt seine Bedeutung im Kontext der Linguistik. Die Arbeit konzentriert sich auf die Reflexion von Geschlechterrollen in Berufsbezeichnungen und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
Ungleichheiten von Gender und Genus: Dieses Kapitel beleuchtet die Diskrepanz zwischen grammatischem Genus und biologischem Geschlecht im Französischen. Es analysiert Phänomene wie die Inversion des Genus und die Verwendung generischer Genera, wobei das generische Maskulinum und dessen Problematik im Fokus stehen. Die Kapitel unterstreicht die Bedeutung des Verhältnisses zwischen grammatischem Geschlecht und gesellschaftlichen Konstrukten von Geschlecht.
Das Problem der Berufsbezeichnungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der kontroversen Debatte um die Feminisierung von Berufsbezeichnungen im Französischen. Es vergleicht die Positionen der Académie française und des Institut national de la langue française und beschreibt die Schwierigkeiten im praktischen Sprachgebrauch. Der Abschnitt beleuchtet verschiedene Ansätze zur geschlechtsneutralen Sprache in unterschiedlichen frankophonen Regionen (Belgien, Frankreich, Luxemburg, Quebec, die französische Schweiz).
Afrika: Dieses Kapitel untersucht die Stellung der Frau in der Gesellschaft französischsprachiger afrikanischer Länder, insbesondere in Mali. Es beleuchtet die Geschichte der Frauen in Bezug auf die Kolonisierung und analysiert das malische Bildungssystem im Kontext der Geschlechterrollen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frauenzeitschrift "Musow" als Beispiel für die sprachliche Repräsentation von Gender in diesem Kontext.
Geschlechtlichkeit der Sprache in Musow: Dieses Kapitel analysiert exemplarisch, wie mit Geschlechtlichkeit in der Sprache in der malischen Frauenzeitschrift "Musow" umgegangen wird. Es untersucht verschiedene Versuche einer geschlechtsneutralen Schreibweise und beleuchtet die Verwendung des männlichen Genus als Allgemeinform, sowie die Verwendung der männlichen Form als Berufsbezeichnung für Frauen, inklusive der Mischformen.
Schlüsselwörter
Gender, Genus, französische Sprache, Berufsbezeichnungen, Geschlechterrollen, Frankophonie, geschlechtsneutrale Sprache, Feminisierung, Afrika, Mali, Musow, feministische Linguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschlechtsbezogene Ungleichheiten in der französischen Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Problematik geschlechtsbezogener Ungleichheiten in der französischen Sprache, insbesondere im Kontext von Berufsbezeichnungen. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen grammatischem Genus und sozial konstruiertem Gender und beleuchtet die Debatte um geschlechtsneutrale Sprache in verschiedenen frankophonen Regionen, mit einem Fokus auf Afrika (speziell Mali) und der Frauenzeitschrift "Musow".
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Gender und Genus im Französischen, Ungleichheiten zwischen grammatischem Genus und sozialem Geschlecht, die Inversion des Genus und generische Genera (insbesondere das generische Maskulinum), die Herausforderungen der Feminisierung von Berufsbezeichnungen, unterschiedliche Ansätze zur geschlechtsneutralen Sprache in der Frankophonie (Belgien, Frankreich, Luxemburg, Quebec, Schweiz), die Rolle der Frau in der Gesellschaft französischsprachiger afrikanischer Länder (mit Schwerpunkt Mali), das malische Bildungssystem und die sprachliche Repräsentation von Gender in der malischen Frauenzeitschrift "Musow".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zu Ungleichheiten von Gender und Genus, ein Kapitel zum Problem der Berufsbezeichnungen, ein Kapitel zu Afrika (mit Fokus auf Mali und "Musow") und ein Kapitel zur Geschlechtlichkeit der Sprache in "Musow". Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel ausführlicher beschrieben.
Wie wird der Zusammenhang zwischen grammatischem Genus und Gender dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Diskrepanz zwischen grammatischem Genus und biologischem Geschlecht im Französischen und untersucht, wie diese Diskrepanz gesellschaftliche Geschlechterrollen widerspiegelt und in der Sprache zum Ausdruck kommt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Verwendung des generischen Maskulinums und dessen Problematik gewidmet.
Welche Positionen zur geschlechtsneutralen Sprache werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Positionen der Académie française und des Institut national de la langue française zur Feminisierung von Berufsbezeichnungen und beschreibt die Schwierigkeiten im praktischen Sprachgebrauch. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze zur geschlechtsneutralen Sprache in verschiedenen frankophonen Regionen.
Welche Rolle spielt die Frauenzeitschrift "Musow"?
"Musow", eine malische Frauenzeitschrift, dient als Fallbeispiel zur Analyse der sprachlichen Repräsentation von Gender in einem afrikanischen Kontext. Die Arbeit untersucht, wie in "Musow" mit Geschlechtlichkeit in der Sprache umgegangen wird, inklusive Versuche einer geschlechtsneutralen Schreibweise und der Verwendung männlicher und weiblicher Formen in Berufsbezeichnungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Gender, Genus, französische Sprache, Berufsbezeichnungen, Geschlechterrollen, Frankophonie, geschlechtsneutrale Sprache, Feminisierung, Afrika, Mali, Musow, feministische Linguistik.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler*innen, Studierende und alle Interessierten gedacht, die sich mit Gender-Linguistik, französischer Sprache und der Rolle von Sprache in der gesellschaftlichen Konstruktion von Geschlecht auseinandersetzen.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Die detaillierten Kapitelzusammenfassungen finden sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" des Dokuments.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Problematik geschlechtsbezogener Ungleichheiten in der französischen Sprache zu untersuchen und die Debatte um geschlechtsneutrale Sprache zu beleuchten. Sie analysiert die Beziehung zwischen grammatischem Genus und sozial konstruiertem Gender und betrachtet die sprachliche Repräsentation von Gender in verschiedenen Kontexten.
- Arbeit zitieren
- Monika Braun (Autor:in), 2006, Gleichheit in der Sprache: Das Problem der Berufsbezeichnungen in der Frankophonie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63226