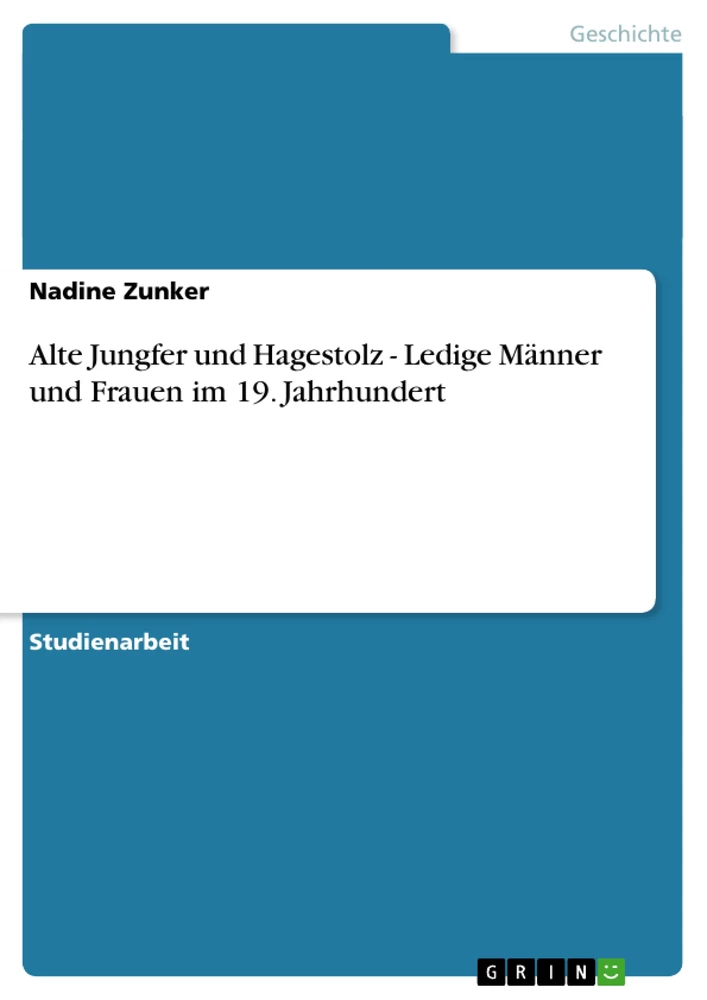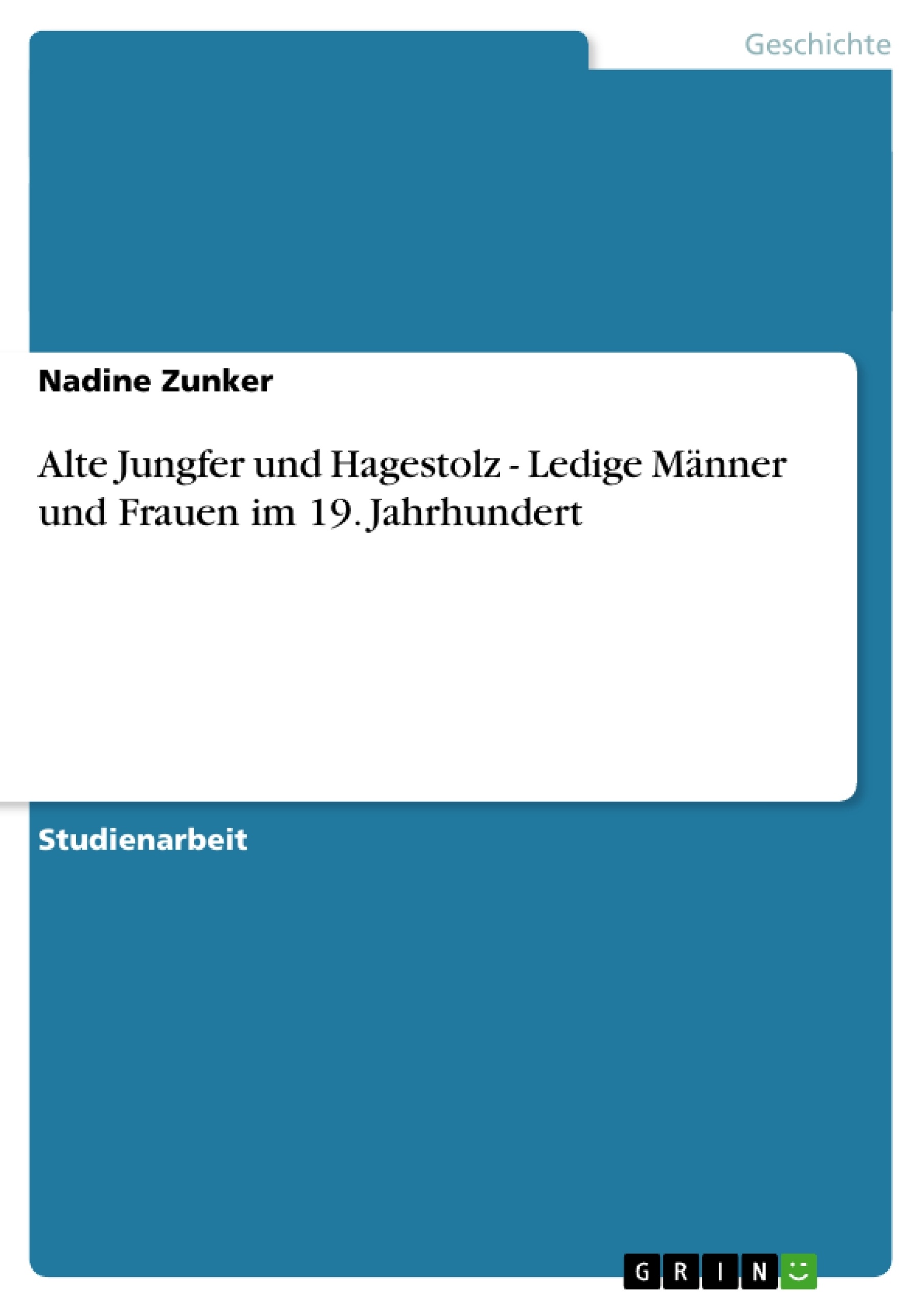1984 sang Herbert Grönemeyer „ [...]Männer geben Geborgenheit, Männer weinen
heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit, [...], Männer kaufen Frauen, Männer
stehen ständig unter Strom, [...], Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar
stark, Männer können alles, [...], Männer führen Kriege, [...], Männer sind furchtbar
schlau, Männer bauen Raketen, Männer machen alles ganz genau [...].“ und
schaffte mit seinem Lied „Männer“ den musikalischen Durchbruch. Der Göttinger
Sänger beschreibt dabei in seinem Song ein Bild der Männlichkeit, in dem sich jeder
vermeintlich wahre Mann wiederfinden kann.
Fast zwanzig Jahre später erscheint das Buch „Warum Männer nicht zuhören und
Frauen schlecht einparken“ von Barbara und Allan Pease. Sie schreiben den
einzelnen Geschlechtern bestimmte Eigenschaften zu und sind dabei, laut
Untertitel, der Ansicht, dass dies naturgegeben sei.
In der Gesellschaft herrschen also ganz genaue Vorstellungen über Männlichkeit
und Weiblichkeit vor und nicht nur die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich mit
Fragen wie, was denn nun ein „wahrer“ Mann bzw. eine „wahre“ Frau ist, sondern
auch die wissenschaftliche Forschung hat diese und ähnliche Fragen zum
Gegenstand zahlreicher Diskussionen gemacht.
Schaut man in die Vergangenheit, so wird einem sehr schnell bewusst, dass die
Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit Konstruktionen und somit auch
veränderbar sind und schnell wird klar, dass in Publikationen, wie in der von Allan
und Barbara Pease nur Klischees und Vorurteile beschrieben werden, was sicherlich
den Ein oder Anderen amüsiert, aber nicht der Realität entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Exkurs: Die Entstehung des Zwei-Geschlechter-Modells
- 3. Die Normvorstellungen im 19. Jahrhundert
- 3.1 Die ideale Frau und der ideale Mann des 19. Jahrhunderts
- 3.2 Ehe und Familie als Ideal
- 4. Abseits der Norm: Ledige Männer und Frauen
- 4.1 Die Lebens- und Arbeitswirklichkeit von Ledigen im 19. Jahrhundert
- 4.1.1 Ledige Männer und Frauen auf dem Land
- 4.1.2 Ledige Frauen in der Stadt: Dienstmädchen
- 4.1.3 Ledige Arbeiter und Arbeiterinnen
- 4.1.4 Ledige Männer und Frauen aus dem Bürgertum
- 4.1.5 Ledige Männer und Frauen im höheren Alter
- 4.2 Das private Leben von Ledigen im 19. Jahrhundert
- 4.2.1 Wohnen
- 4.2.2 Mahlzeiten
- 4.2.3 Sexualität
- 4.2.4 Kinderfrage
- 4.3 Diskriminierung von Ledigen: Die alten Jungfer und der Hagestolz
- 4.3.1 Ursprung und Gebrauch der Begriffe „alte Jungfer“ und „Hagestolz“
- 4.3.2 Das Stereotyp der „alten Jungfer“
- 4.3.3 Das Stereotyp des „Hagestolzes“
- 4.1 Die Lebens- und Arbeitswirklichkeit von Ledigen im 19. Jahrhundert
- 5. Unterrichtsvorschlag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit im 19. Jahrhundert und beleuchtet das Leben lediger Männer und Frauen als Abweichung von diesen Normen. Sie analysiert die Konstruktion von Geschlecht und deren Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit unverheirateter Personen. Ein Unterrichtsvorschlag zeigt schließlich die praktische Anwendung dieses Themas im geschichtsdidaktischen Kontext.
- Die Konstruktion von Geschlecht im 19. Jahrhundert
- Die gesellschaftlichen Normen und Ideale der Ehe und Familie
- Die Lebensrealität lediger Männer und Frauen
- Diskriminierung und Stereotypisierung von Ledigen
- Geschlechtergeschichtlicher Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie auf die gesellschaftlich vorherrschenden Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit eingeht und die historische Veränderbarkeit dieser Konstruktionen betont. Sie hebt die Bedeutung der Einbeziehung weiblicher Perspektiven in die Geschichtsschreibung hervor und benennt das Ziel, einen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler herzustellen. Die Arbeit fokussiert auf das Leben lediger Männer und Frauen im 19. Jahrhundert als Beispiel für eine Abweichung von der Norm.
2. Exkurs: Die Entstehung des Zwei-Geschlechter-Modells: Dieser Exkurs beleuchtet die Entstehung des Zwei-Geschlechter-Modells als historisch relativ junge Erscheinung. Er vergleicht es mit dem früheren Ein-Geschlecht-Modell, in dem Mann und Frau als spiegelbildliche Variationen desselben Geschlechts betrachtet wurden. Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien zur Entstehung der heutigen Geschlechterdifferenzierung, die mit gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungen in Verbindung gebracht werden. Der Fokus liegt auf dem Wandel von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft und den Auswirkungen auf die Konstruktion von Geschlecht.
3. Die Normvorstellungen im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die im 19. Jahrhundert vorherrschenden Normen und Werte, die sowohl das Ideal der Frau als auch des Mannes definierten. Es analysiert die zentrale Rolle von Ehe und Familie als gesellschaftliches Ideal und die daraus resultierenden Erwartungen und Zwänge für Individuen. Der Abschnitt legt die Grundlage für das Verständnis des Kapitels über ledige Männer und Frauen, indem er die Norm aufzeigt, von der diese abweichen.
4. Abseits der Norm: Ledige Männer und Frauen: Das zentrale Kapitel der Arbeit analysiert die Lebenswirklichkeit lediger Männer und Frauen im 19. Jahrhundert. Es unterteilt die Bevölkerung nach gesellschaftlichen Schichten (Land, Stadt, Arbeiter, Bürgertum) und untersucht die jeweiligen Arbeits- und Lebensbedingungen. Der Abschnitt über das private Leben beleuchtet die Themen Wohnen, Mahlzeiten, Sexualität und die Kinderfrage. Schließlich wird die Diskriminierung lediger Personen und die Entstehung von Stereotypen wie „alte Jungfer“ und „Hagestolz“ detailliert untersucht und deren soziale und kulturelle Bedeutung erörtert.
Schlüsselwörter
Geschlecht, Männlichkeit, Weiblichkeit, 19. Jahrhundert, Ledige, Normen, Ideale, Ehe, Familie, Diskriminierung, Stereotype, Alte Jungfer, Hagestolz, Geschlechtergeschichte, Geschichtsdidaktik, Zwei-Geschlechter-Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Gesellschaftliche Normen und das Leben Lediger im 19. Jahrhundert
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text untersucht die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit im 19. Jahrhundert und konzentriert sich dabei besonders auf das Leben lediger Männer und Frauen als Abweichung von diesen Normen. Er analysiert die Konstruktion von Geschlecht und deren Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit unverheirateter Personen. Ein Unterrichtsvorschlag rundet den Text ab.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Konstruktion von Geschlecht im 19. Jahrhundert, die gesellschaftlichen Normen und Ideale der Ehe und Familie, die Lebensrealität lediger Männer und Frauen (einschließlich ihrer Arbeitsbedingungen und ihres Privatlebens), die Diskriminierung und Stereotypisierung von Ledigen (z.B. „alte Jungfer“, „Hagestolz“) sowie Aspekte der Geschlechtergeschichtsschreibung und geschichtsdidaktische Überlegungen für den Unterricht.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, einen Exkurs zur Entstehung des Zwei-Geschlechter-Modells, ein Kapitel zu den Normvorstellungen des 19. Jahrhunderts, ein zentrales Kapitel über das Leben lediger Männer und Frauen (unterteilt nach sozialen Schichten und Aspekten des Privatlebens), und abschließend einen Unterrichtsvorschlag. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern die Orientierung. Schlüsselwörter werden ebenfalls genannt.
Was ist das Ziel des Textes?
Das Ziel des Textes ist es, die gesellschaftlichen Normen und deren Einfluss auf das Leben lediger Personen im 19. Jahrhundert zu analysieren. Er möchte die Lebenswirklichkeit dieser oft übersehenen Gruppe sichtbar machen und gleichzeitig didaktische Ansätze für den Geschichtsunterricht aufzeigen, um die Perspektive lediger Männer und Frauen einzubeziehen.
Welche sozialen Gruppen werden betrachtet?
Der Text betrachtet ledige Männer und Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten des 19. Jahrhunderts: Landbevölkerung, Stadtbevölkerung, Arbeiter, Bürgertum und auch im höheren Alter lebende Ledige. Die Analyse umfasst sowohl ihre Arbeitsbedingungen als auch ihr Privatleben (Wohnen, Ernährung, Sexualität und die Kinderfrage).
Wie werden Stereotype behandelt?
Der Text untersucht die Diskriminierung lediger Personen und die Entstehung von Stereotypen wie „alte Jungfer“ und „Hagestolz“. Er beleuchtet den Ursprung und Gebrauch dieser Begriffe und analysiert die soziale und kulturelle Bedeutung dieser Stereotypen.
Welche Bedeutung hat der Exkurs über das Zwei-Geschlechter-Modell?
Der Exkurs erläutert die Entstehung des Zwei-Geschlechter-Modells als historisch relativ junge Erscheinung und vergleicht es mit früheren Modellen. Er liefert einen wichtigen Kontext, um die im 19. Jahrhundert vorherrschenden Geschlechtervorstellungen besser zu verstehen.
Wie ist der Text für den Unterricht konzipiert?
Der Text beinhaltet einen expliziten Unterrichtsvorschlag, der die praktische Anwendung des Themas im geschichtsdidaktischen Kontext zeigt. Er zielt darauf ab, die Lebenswirklichkeit lediger Männer und Frauen im 19. Jahrhundert in den Geschichtsunterricht zu integrieren und die Schüler*innen mit einer oft vernachlässigten Perspektive vertraut zu machen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Geschlecht, Männlichkeit, Weiblichkeit, 19. Jahrhundert, Ledige, Normen, Ideale, Ehe, Familie, Diskriminierung, Stereotype, Alte Jungfer, Hagestolz, Geschlechtergeschichte, Geschichtsdidaktik, Zwei-Geschlechter-Modell.
- Citation du texte
- Nadine Zunker (Auteur), 2005, Alte Jungfer und Hagestolz - Ledige Männer und Frauen im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63264