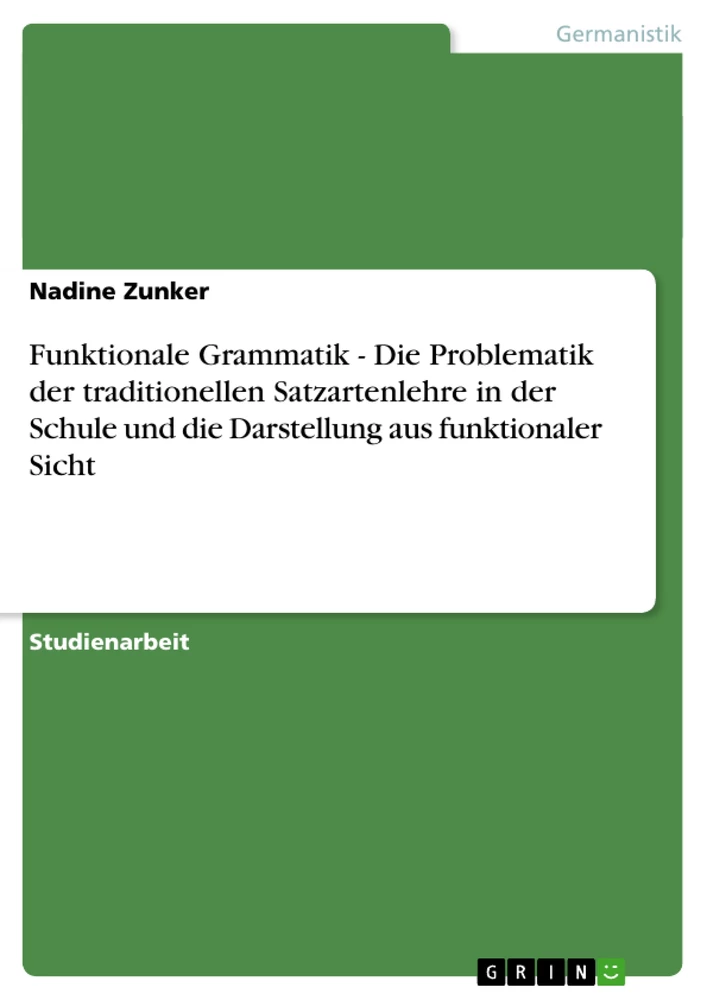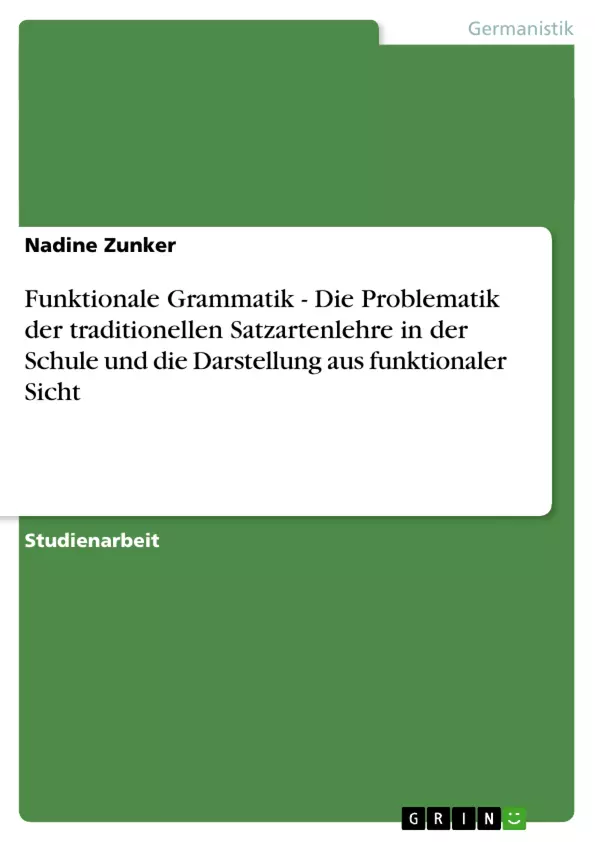Grammatikunterricht - Wozu und wie? Kein anderer Lern- und Arbeitsbereich des
muttersprachlichen Deutschunterrichts muss sich immer wieder diesen oder ähnlichen Fragen
stellen und ist mit Attributen wie unbeliebt, schwer verständlich und langweilig gekennzeichnet.
Nichtsdestotrotz hält sich dieser immer wieder heftig umstrittene und in Frage gestellter
Arbeitsbereich im schulischen Muttersprachenunterricht hartnäckig und ist fest im Bildungsplan
etabliert.
Daran können auch Untersuchungsergebnisse, wie die der von Hubert Ivo und Eva Neuland 1991
durchgeführten empirischen Studie über grammatisches Wissen nichts ändern.
In dieser bestätigten die Befragten Unbeliebtheit und Ineffizienz der Schulgrammatik
folgendermaßen: „Die Befragten wissen wenig von der Grammatik ihrer Muttersprache, mögen sie
nicht sonderlich und erinnern sich nicht gern an ihren Grammatikunterricht, halten aber daran fest,
dass Grammatikunterricht sein muss, und geben hierfür unterschiedliche Gründe an, [...].“ und da
„das in der Schule vermittelte grammatische Wissen in sich nicht frei von Irreführungen,
Widersprüchen und Fehlerhaftigkeit ist, [...].“, verwundert es kaum, dass der Grammatikunterricht
sich wenig Beliebtheit erfreut und zu Unsicherheiten sowie Verwirrungen führt.
Sprachdidaktiker hingegen nutzen derartige Umfrageergebnisse und Erkenntnisse, um den nach
wie vor in den Schulen mehrheitlich gelehrten, systematischen Grammatikunterricht in Frage zu
stellen und verweisen auf neue methodische Perspektiven (situativer, integrativer, textorientierter
Grammatikunterricht oder Grammatik-Werkstatt), die zu den erstrebten Zielen führen sollen.
Eine weitere dieser neuen Sichtweisen auf den Bereich der Sprachreflexion stellt eine
vielversprechende Alternative zum systematischen Grammatikunterricht dar: die sogenannte
funktionale Grammatik.
Eine funktionale Sicht auf unsere Sprache ermöglicht den Schülern und Schülerinnen zu erfahren,
wozu wir diese Sprache haben und was wir mit ihr erreichen bzw. tun können.
Diese Erkenntnis führt zu einer Veränderung hinsichtlich der Motivation, weswegen sich der
Grammatikunterricht nicht mehr länger „mit dem Vorwurf des Formalismus konfrontiert“ sehen
muss und die Beschäftigung mit Sprache weitaus mehr ist als der bloße Erwerb toten Wissens über
Sprache. Grammatik wird nämlich nun das Mittel, um Sprachbewusstsein und Sprachverständnis
zu verbessern und zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die traditionelle Satzartenvermittlung in der Schule
- Darstellung der Satzarten im Duden
- Der Aussagesatz (Deklarativsatz)
- Der Fragesatz (Interrogativsatz)
- Der Aufforderungssatz (Imperativsatz)
- Darstellung der Satzarten in Sprachbüchern der Sekundarstufe I
- Beispiel 1: Deutsch - Wege zum sichern Sprachgebrauch
- Beispiel 2: Wortstark - Themen und Werkstätten für den Deutschunterricht
- Darstellung der Satzarten im Duden
- Die Satzarten aus funktionaler Sicht
- Verbzweitsätze und ihre illokutive Qualität
- Verberstsätze und ihre illokutive Qualität
- Verbletztsätze und ihre illokutive Qualität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der traditionellen und funktionalen Sichtweise auf die Satzartenlehre im Deutschunterricht. Ziel ist es, die Problematik der traditionellen Satzartenvermittlung in der Schule aufzuzeigen und eine alternative, funktionale Perspektive zu präsentieren.
- Traditionelle Vermittlung von Satzarten in der Schule
- Darstellung der Satzarten in der Duden-Grammatik
- Kritik an der traditionellen Satzartenlehre
- Funktionale Sichtweise auf Satzarten
- Illokutive Qualität von Satztypen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Relevanz und die Schwierigkeiten des Grammatikunterrichts in der Schule. Die Autorin kritisiert die traditionelle Grammatikvermittlung und führt die funktionale Grammatik als vielversprechende Alternative ein. Das zweite Kapitel analysiert die Darstellung der Satzarten in der Duden-Grammatik und in gängigen Schulbüchern der Sekundarstufe I. Die Autorin hebt dabei die Schwierigkeiten und Unsicherheiten hervor, die durch die traditionelle Vermittlungsweise entstehen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der funktionalen Sichtweise auf die Satzarten, die den Fokus auf den Zweck und die illokutive Qualität von Sätzen legt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Satzartenlehre, Grammatikunterricht, traditionelle Grammatik, funktionale Grammatik, illokutive Qualität, Deklarativsatz, Interrogativsatz, Imperativsatz, Sprachbewusstsein, Sprachverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen traditioneller und funktionaler Grammatik?
Die traditionelle Grammatik lehrt formale Regeln und Strukturen, während die funktionale Grammatik untersucht, wozu wir Sprache verwenden und welche Absichten (Illokutionen) wir mit bestimmten Satzarten verfolgen.
Warum gilt Grammatikunterricht oft als unbeliebt?
Viele Schüler empfinden ihn als trocken und formalistisch, da oft "totes Wissen" vermittelt wird, ohne den direkten Nutzen für die eigene Sprachverwendung aufzuzeigen.
Was bedeutet "illokutive Qualität" von Sätzen?
Es beschreibt die Absicht, die ein Sprecher mit einem Satz verfolgt, zum Beispiel eine Information geben (Aussage), eine Frage stellen oder eine Aufforderung äußern.
Wie kann funktionale Grammatik das Sprachbewusstsein fördern?
Indem Schüler lernen, wie Sprache wirkt und wie sie durch die Wahl bestimmter Satzstrukturen ihre Kommunikation gezielt steuern können.
Welche Satzarten werden klassischerweise unterschieden?
Traditionell unterscheidet man vor allem den Aussagesatz (Deklarativsatz), den Fragesatz (Interrogativsatz) und den Aufforderungssatz (Imperativsatz).
- Arbeit zitieren
- Nadine Zunker (Autor:in), 2006, Funktionale Grammatik - Die Problematik der traditionellen Satzartenlehre in der Schule und die Darstellung aus funktionaler Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63268