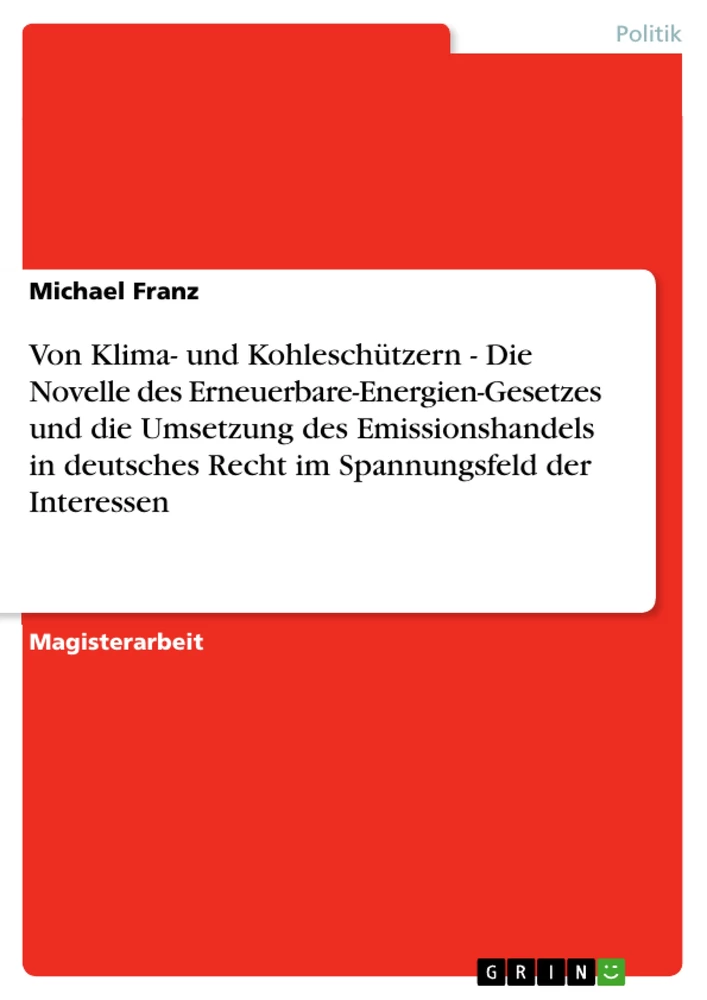Der anthropogene, das heißt menschengemachte Klimawandel und der resultierende dringende Handlungsbedarf sind mittlerweile kaum mehr umstritten. Seit Beginn der Industrialisierung sind die atmosphärischen Konzentrationen der Treibhausgase stark gestiegen. Der Anteil von Kohlendioxid, welches 60% der durch die klimawirksamen Gase anthropogenen Ursprungs verursachten Störung ausmacht, hat mit etwa 380 parts per million den höchsten Wert seit 700.000 Jahren erreicht. Die Hauptquelle der Emissionen ist die Energieversorgung auf Basis der fossilen Brennstoffe Kohle, Erdgas und Erdöl. In Deutschland sind mehr als 90% der Emissionen des wichtigsten Treibhausgases Kohlendioxid energiebedingt, etwa 45% entstehen allein in der Energiewirtschaft.
Hinsichtlich der prinzipiellen Notwendigkeit, Klimaschutz zu betreiben, besteht mittlerweile ein Grundkonsens in der deutschen Politik. Die deutsche Klimapolitik nimmt sich der Problematik mit einem „Mix aus Maßnahmen und Instrumenten“ an, darunter die ökologische Steuerreform, die Förderung erneuerbarer Energien sowie der Kraft-Wärme- Kopplung, Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, Bildungs- und Forschungsförderung, der Emissionshandel sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Zwei zentrale Instrumente wurden in den Jahren 2003 und 2004 novelliert oder erstmals in deutsches Recht umgesetzt: das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) und das europäische Emissionshandelssystem.
Das EEG ist ein Instrument zur Förderung erneuerbarer Energien. Es basiert auf einer Abnahme- und Vergütungspflicht und entfaltet seine Steuerungswirkung über Festpreise: Netzbetreiber müssen von den Anlagenbetreibern eingespeisten EE-Strom abnehmen und zu gesetzlich festgelegten Preisen vergüten. Das EEG von 2000 hat in Deutschland einen Boom erneuerbarer Energien ausgelöst. Die Branche setzte nach Angaben des Bundesumweltministeriums 2001 mehr als 6 Milliarden Euro um und beschäftigte etwa 120.000 Menschen. Im fünften Jahr nach der Einführung hatte das EEG den Marktanteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in Deutschland von 6,3% auf 10,2% gesteigert. Erneuerbare Energien substituieren fossile (und nukleare) Energieträger und haben 2004 circa 82 Mio. t CO2-Emissionen vermieden. Die Novellierung des EEG war bereits im Gesetz von 2000 angelegt. Sie wird in der vorliegenden Arbeit als erstes Fallbeispiel untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretischer Hintergrund - Der „Politische Markt”
- Akteure und Tauschbeziehungen
- Tauschgüter
- Konfliktlinien und Koalitionen
- Entscheidungen
- Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
- Hintergrundinformationen
- Das Stromeinspeisegesetz von 1990
- Das Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2000
- Die Anlässe für die Novellierung
- Die Entwicklung des Referentenentwurfs
- Ankündigung des Entwurfs und erste Positionierungen
- „Kleine Novelle“ - Die Härtefallregelung
- Der Referentenentwurf
- Bewertung
- Die Ressortabstimmung zwischen BMU und BMWa
- Der „Energiegipfel“ im Kanzleramt vom 14. August 2003
- Die Positionen der Anbieter zum Referentenentwurf
- Die Positionen der Nachfrager
- Die Eskalation des Konflikts im Laufe der Ressortabstimmung
- Das Photovoltaik-Vorschaltgesetz
- Vermittlung des Kanzleramts und Kabinettsvorlage
- Bewertung
- Das Gesetzgebungsverfahren
- Die Positionen der Anbieter zum Gesetzentwurf
- Die Positionen der Nachfrager
- Die Überarbeitung durch den Umweltausschuss
- Vermittlungsverfahren und endgültiger Beschluss
- Bewertung
- Zwischenergebnis – Konfliktlinien, Koalitionen und Konfliktverlauf
- Die Reformerkoalition
- Die „Status-Quo“-Koalition
- Sekundäre Konfliktlinien und Koalitionen
- Der Verlauf des Formulierungsprozesses
- Die Formulierung des deutschen Nationalen Allokationsplans für den europäischen Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten
- Hintergrundinformationen
- Internationale Klimapolitik und Emissionshandel
- Die Entwicklung der EU-Rahmenrichtlinie
- Die Vorgaben der EU-Emissionshandelsrichtlinie und die Systematik der Umsetzung in deutsches Recht
- Die Verhandlungen in der AGE bis zum BMU-Entwurf
- Der „Energiegipfel“ im Kanzleramt am 18. September 2003
- Diskussionen in der Arbeitsgruppe Emissionshandel und Vorlage des BMU-Entwurfs
- Bewertung
- Die Ressortabstimmung zwischen BMU und BMWa
- Die Positionen der Nachfrager zum BMU-Entwurf
- Die Positionen der Anbieter
- Die Eskalation des Konflikts im Verlauf des Ressortabstimmung
- Vermittlung des Kanzleramts und Vorlage des abgestimmten Entwurfs
- Bewertung
- Das Gesetzgebungsverfahren
- Die Positionen der Nachfrager zum abgestimmten Entwurf
- Die Positionen der Anbieter
- Die Überarbeitung durch den Umweltausschuss
- Vermittlungsverfahren und endgültiger Beschluss
- Bewertung
- Zwischenergebnis…
- Die Reformerkoalition
- Die „Status-Quo“-Koalition
- Sekundäre Konfliktlinien und Koalitionen
- Der Verlauf des Formulierungsprozesses
- Die Rolle der Interessenpolitik im deutschen Rechtsetzungsprozess
- Die Analyse von Konfliktlinien und Koalitionen zwischen verschiedenen Akteuren
- Die Auswirkungen der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf die Energiewirtschaft
- Die Herausforderungen der Umsetzung des Emissionshandels in Deutschland
- Der Einfluss von Lobbyismus und politischem Druck auf die Gesetzgebung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und die Umsetzung des Emissionshandels in deutsches Recht im Spannungsfeld der Interessen verschiedener Akteure. Sie beleuchtet den Formulierungsprozess beider Gesetze und untersucht, wie sich unterschiedliche Interessenlagen in konkreten Gesetzesformulierungen niederschlagen. Dabei wird der theoretische Rahmen des „Politischen Marktes“ als Analysemodell verwendet.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Forschungsfrage sowie die Methodik der Arbeit. Kapitel zwei stellt den theoretischen Hintergrund dar, indem es das Modell des „Politischen Marktes“ erläutert. Kapitel drei beleuchtet die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und analysiert den Formulierungsprozess, die Konfliktlinien und die beteiligten Akteure. Kapitel vier konzentriert sich auf die Formulierung des Nationalen Allokationsplans für den europäischen Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Erneuerbare Energien, Emissionshandel, Interessenpolitik, Gesetzgebungsprozess, „Politischer Markt“, Konfliktlinien, Koalitionen, Lobbyismus und Akteure der Energiewirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht diese Magisterarbeit im Kern?
Die Arbeit analysiert die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und die Umsetzung des Emissionshandels in Deutschland als Resultat politischer Interessenkonflikte.
Welches theoretische Modell wird verwendet?
Die Analyse nutzt das Modell des „Politischen Marktes“, um Akteure, Tauschbeziehungen und Entscheidungsprozesse zu erklären.
Welche Rolle spielt das EEG für den Klimaschutz?
Das EEG fördert erneuerbare Energien durch Abnahme- und Vergütungspflichten und hat laut Arbeit bereits 2004 zur Vermeidung von ca. 82 Mio. Tonnen CO2 beigetragen.
Was ist der Nationale Allokationsplan?
Es handelt sich um den Plan zur Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten im Rahmen des europäischen Emissionshandels, dessen Umsetzung in deutsches Recht hier untersucht wird.
Welche Akteure werden in der Arbeit betrachtet?
Untersucht werden die Positionen von Ministerien (BMU, BMWi), Industrieverbänden, Umweltgruppen und politischen Parteien sowie deren Koalitionen.
- Quote paper
- Michael Franz (Author), 2006, Von Klima- und Kohleschützern - Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und die Umsetzung des Emissionshandels in deutsches Recht im Spannungsfeld der Interessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63277