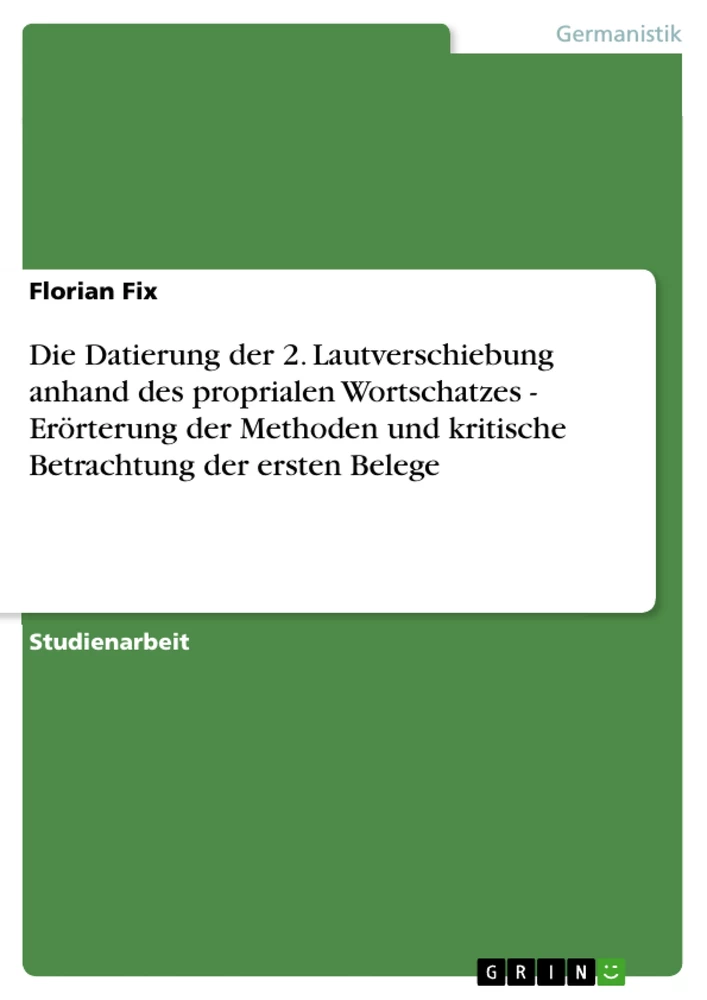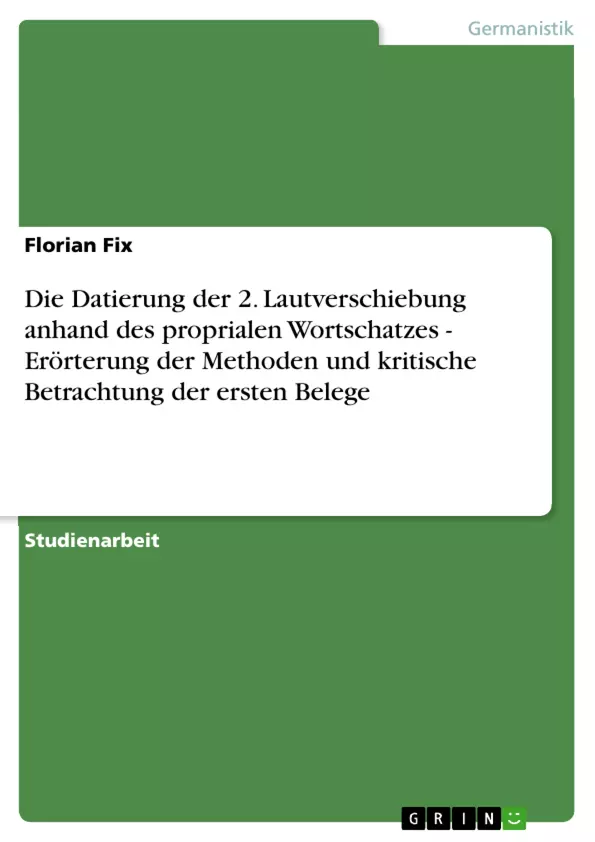In diesem Werk möchte ich mich eingehender mit den aktuellen Ergebnissen zur Datierung der 2. Lautverschiebung beschäftigen sowie die ersten Belege des proprialen Wortschatzes für den Lautwandel bei den oberdeutschen Stämmen detailliert darstellen.
Um dies zu leisten, soll zunächst ein Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung gegeben und verschiedene Methoden zur Erforschung der 2. Lautverschiebung aufgezeigt und diskutiert werden. An dieser Stelle sollen auch die ersten bekannten Belege für die durchgeführte 2. Lautverschiebung genannt und bezüglich ihrer Aussagefähigkeit kategorisiert werden.
Anschließend möchte ich anhand einer Referierung und Diskussion der Arbeiten Theodor Steches darstellen, auf welche Weise Personennamen zur Datierung der Lautverschiebung herangezogen werden können. Eine gesonderte Betrachtung soll dem kontrovers diskutierten, auch bei Steche erwähnten Namen Butilin anhängen.
Nachfolgend sollen die Methoden und hypothetischen Ergebnisse sowohl von Stefan Sonderegger, der Ortsnamen der deutschsprachigen Schweiz bezüglich der 2. Lautverschiebung untersucht, als auch von Wolfgang Haubrichs, welcher anhand von Ortsnamen die Lautverschiebung im Langobardischen zeitlich zu bestimmen versucht, dargestellt und einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.
Das Hauptaugenmerk dieser Hausarbeit soll – wie schon aus dem Titel ersichtlich ist – auf einer Diskussion der Methoden einerseits, ferner jedoch auf einer kritischen Betrachtung der für die Namensforschung relevanten frühen Quellen liegen. Zu diesem Zwecke soll zuerst über die St. Gallener Urkunden und das Salzburger Verbrüderungsbuch referiert, anschließend die dort verzeichneten Namen nach lautverschobenen Konsonanten durchsucht werden, um schließlich eine Deutung in Bezug auf die 2. Lautverschiebung geben zu können.
In allen Teilen der Hausarbeit soll immer wieder thematisiert werden, welche Problematik einer eindeutigen Datierung der 2. Lautverschiebung entgegensteht.
Um dies zu leisten, soll einschlägige Forschungsliteratur verwendet werden, im Besonderen werde ich mich auf die Arbeiten zur 2. Lautverschiebung von Judith Schwerdt beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Hauptteil
- 1. Stand und Methoden der Forschung
- 2. Die Datierung mithilfe von Personennamen
- 2.1 Die Datierung nach Theodor Steche
- 2.2 Der Name des Alemannenherzogs Butilin
- 3. Die Datierung mithilfe der Ortsnamen
- 3.1 Stefan Sonderegger
- 3.2 Wolfgang Haubrichs
- 4. Erörterung der ersten Belege aus dem Bereich des proprialen Wortschatzes
- 4.1 Die St. Gallener Urkunden
- 4.2 Das Salzburger Verbrüderungsbuch
- 4.2.1 Belege für verschobene Medien
- 4.2.2 Belege für die Tenuesverschiebung
- 4.2.3 Zusammenfassung
- C) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Datierung der zweiten Lautverschiebung im Deutschen anhand des proprialen Wortschatzes. Die Arbeit bewertet kritisch bestehende Methoden und analysiert die frühesten schriftlichen Belege. Das Ziel ist es, den aktuellen Forschungsstand darzustellen und die Herausforderungen bei der Datierung zu beleuchten.
- Methoden der Datierung der zweiten Lautverschiebung
- Analyse von Personennamen als Indikatoren für die Lautverschiebung
- Bewertung der Rolle von Ortsnamen in der Datierung
- Kritische Untersuchung der frühesten schriftlichen Belege (St. Gallener Urkunden, Salzburger Verbrüderungsbuch)
- Problematik einer eindeutigen Datierung der zweiten Lautverschiebung
Zusammenfassung der Kapitel
A) Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Fokus der Hausarbeit: die eingehende Beschäftigung mit aktuellen Ergebnissen zur Datierung der zweiten Lautverschiebung und die detaillierte Darstellung der ersten Belege des proprialen Wortschatzes für den Lautwandel bei den oberdeutschen Stämmen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der einen Überblick über den Forschungsstand, verschiedene Methoden, die Diskussion von Personennamen (inkl. des umstrittenen Namens Butilin), Ortsnamenanalysen von Sonderegger und Haubrichs, und schließlich eine kritische Betrachtung der St. Gallener Urkunden und des Salzburger Verbrüderungsbuches umfasst. Die Problematik einer eindeutigen Datierung wird als durchgängiges Thema angekündigt.
B) Hauptteil, Kapitel 1: Stand und Methoden der Forschung: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Datierung der zweiten Lautverschiebung. Es zeigt die Uneinigkeit in der Forschung bezüglich der anzuwendenden Methoden auf, wobei einige Forscher frühe schriftliche Zeugnisse heranziehen, während andere auf Vermutungen zurückgreifen. Schwerdt wird als Verfechterin einer quellenkritischen Methode zitiert, die ausschließlich auf frühe, philologisch geprüfte Belege setzt. Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen dieser Methode, insbesondere den geringen Umfang germanischer Texte aus dem Frühmittelalter und die Problematik der Interpretation von Kopien. Die Bedeutung des proprialen Wortschatzes wird hervorgehoben, da die meisten Texte der Zeit in Latein verfasst waren und somit nur Namen Rückschlüsse auf sprachliche Veränderungen zulassen. Die alemannische Runeninschrift von Stetten wird als möglicher erster Anhaltspunkt genannt.
B) Hauptteil, Kapitel 2: Die Datierung mithilfe von Personennamen: Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung von Personennamen zur Datierung der Lautverschiebung, insbesondere die Arbeit von Theodor Steche. Es wird detailliert auf den kontroversen Namen Butilin eingegangen. Der Abschnitt beleuchtet verschiedene Interpretationen und die Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Namen zu bestimmten Zeiträumen und der damit verbundenen Unsicherheit bei der Datierung.
B) Hauptteil, Kapitel 3: Die Datierung mithilfe der Ortsnamen: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert die Methoden von Stefan Sonderegger (deutschsprachige Schweiz) und Wolfgang Haubrichs (Langobardisch) zur Datierung der zweiten Lautverschiebung anhand von Ortsnamen. Die unterschiedlichen Ansätze und Ergebnisse werden vorgestellt und kritisch bewertet, wobei auf die methodischen Herausforderungen und die Interpretationsspielräume hingewiesen wird. Die Zusammenfassung vergleicht die Erkenntnisse aus der Analyse von Ortsnamen mit den Ergebnissen aus der Analyse von Personennamen.
B) Hauptteil, Kapitel 4: Erörterung der ersten Belege aus dem Bereich des proprialen Wortschatzes: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der St. Gallener Urkunden und des Salzburger Verbrüderungsbuches als frühe Quellen für die Untersuchung der zweiten Lautverschiebung. Es untersucht die in diesen Dokumenten enthaltenen Namen auf lautverschobene Konsonanten und interpretiert die Befunde im Kontext der Lautverschiebung. Die Kapitel diskutieren die Herausforderungen der Interpretation aufgrund der begrenzten Datenmenge und der Problematik der Quellenkritik bei der Datierung. Die Zusammenfassung fasst die gefundenen Belege und ihre Bedeutung für die Datierung zusammen.
Schlüsselwörter
Zweite Lautverschiebung, Datierung, Proprialer Wortschatz, Personennamen, Ortsnamen, St. Gallener Urkunden, Salzburger Verbrüderungsbuch, Theodor Steche, Stefan Sonderegger, Wolfgang Haubrichs, Quellenkritik, Lautwandel, Althochdeutsch, Oberdeutsche Stämme.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Datierung der zweiten Lautverschiebung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Datierung der zweiten Lautverschiebung im Deutschen anhand des proprialen Wortschatzes. Sie bewertet kritisch bestehende Methoden und analysiert die frühesten schriftlichen Belege, um den aktuellen Forschungsstand darzustellen und die Herausforderungen bei der Datierung zu beleuchten.
Welche Methoden der Datierung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Methoden zur Datierung der zweiten Lautverschiebung, darunter die Analyse von Personennamen (mit Fokus auf Theodor Steche und den umstrittenen Namen Butilin) und Ortsnamen (mit Analysen von Sonderegger und Haubrichs). Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Untersuchung der frühesten schriftlichen Belege, wie den St. Gallener Urkunden und dem Salzburger Verbrüderungsbuch.
Welche Rolle spielen Personennamen bei der Datierung?
Personennamen werden als Indikatoren für die Lautverschiebung analysiert. Die Arbeit diskutiert die Verwendung von Personennamen durch Theodor Steche und geht detailliert auf den kontroversen Namen Butilin ein, der verschiedene Interpretationen und Schwierigkeiten bei der Zuordnung zu bestimmten Zeiträumen aufzeigt.
Welche Rolle spielen Ortsnamen bei der Datierung?
Die Methoden von Stefan Sonderegger und Wolfgang Haubrichs zur Datierung anhand von Ortsnamen werden vorgestellt und kritisch bewertet. Die Arbeit vergleicht die Erkenntnisse aus der Analyse von Ortsnamen mit den Ergebnissen aus der Analyse von Personennamen und hebt die methodischen Herausforderungen und Interpretationsspielräume hervor.
Welche frühen schriftlichen Belege werden untersucht?
Die Hausarbeit analysiert die St. Gallener Urkunden und das Salzburger Verbrüderungsbuch als frühe Quellen für die Untersuchung der zweiten Lautverschiebung. Es werden die in diesen Dokumenten enthaltenen Namen auf lautverschobene Konsonanten untersucht und die Befunde im Kontext der Lautverschiebung interpretiert. Die Herausforderungen der Interpretation aufgrund der begrenzten Datenmenge und der Problematik der Quellenkritik werden diskutiert.
Welche Schwierigkeiten bestehen bei der Datierung der zweiten Lautverschiebung?
Die Arbeit hebt die Uneinigkeit in der Forschung bezüglich der anzuwendenden Methoden hervor. Es wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, frühe schriftliche Zeugnisse zu finden und zu interpretieren, sowie auf die Problematik der Interpretation von Kopien. Der geringe Umfang germanischer Texte aus dem Frühmittelalter und die Bedeutung des proprialen Wortschatzes als Hauptquelle für Rückschlüsse auf den Lautwandel werden ebenfalls diskutiert. Die Problematik einer eindeutigen Datierung zieht sich als durchgängiges Thema durch die gesamte Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die zentralen Themen der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Zweite Lautverschiebung, Datierung, Proprialer Wortschatz, Personennamen, Ortsnamen, St. Gallener Urkunden, Salzburger Verbrüderungsbuch, Theodor Steche, Stefan Sonderegger, Wolfgang Haubrichs, Quellenkritik, Lautwandel, Althochdeutsch, Oberdeutsche Stämme.
- Arbeit zitieren
- M A. Florian Fix (Autor:in), 2005, Die Datierung der 2. Lautverschiebung anhand des proprialen Wortschatzes - Erörterung der Methoden und kritische Betrachtung der ersten Belege, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63302