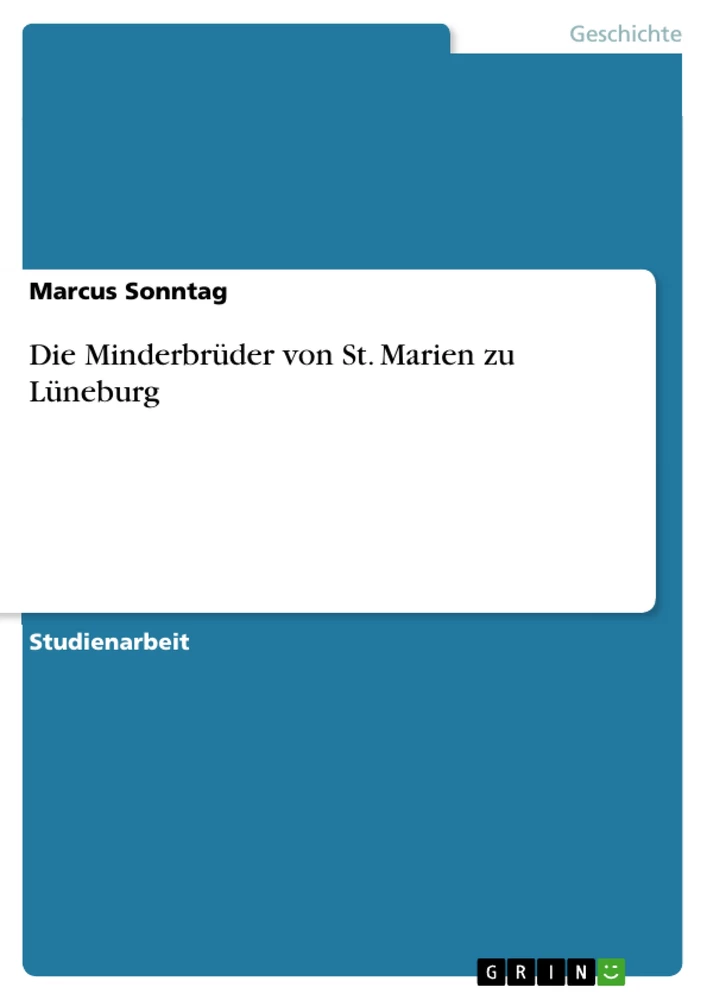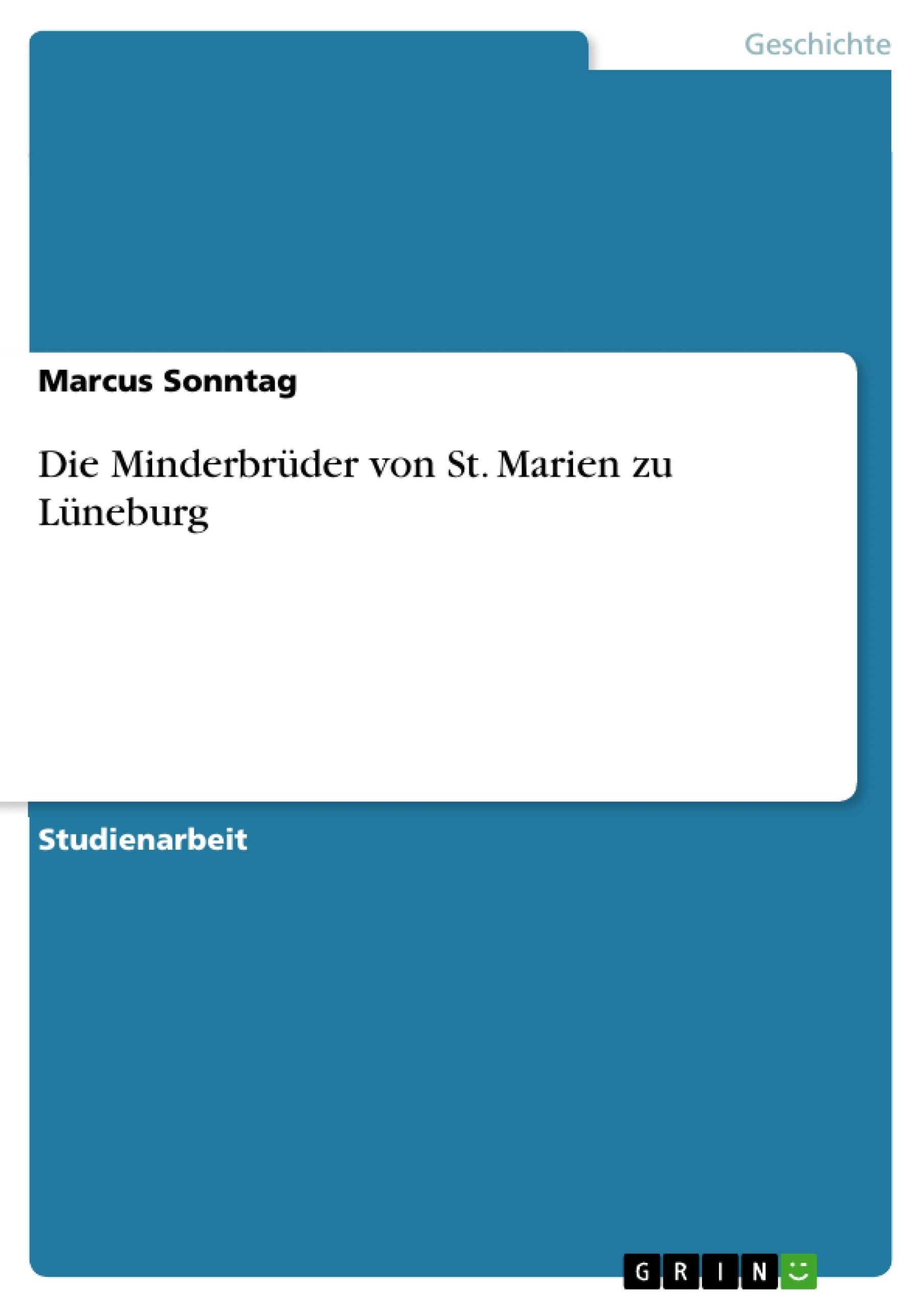Neben den etablierten Orden wie dem der Benediktiner oder der Zisterzienser entstand zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine radikale Ordensbewegung, die dem gängigen monastischen Leben entgegenstellte und sich auf die Lehren der Urkirche und ein Leben in absoluter Armut berief – die vita apostolica wurde zur obersten Prämisse erkoren. Das Leben als Armer unter Armen wurde als aufrichtigere und wahrhaftigere Bezeugung des Evangeliums verstanden. Als charismatischer Führer dieser Bettelordensbewegung ist vor allem Franz von Assisi zu nennen, der dem Orden der Franziskaner seinen späteren Namen gab.
Waren die Minoriten zunächst umherwandernde Mönche, die von Ort zu Ort zogen und die Menschen um Almosen und Obdach baten, so begannen sie sich bald an verschiedenen Orten niederzulassen und Konvente zu gründen. Die Expansion der Bettelorden wurde vor allem durch die Intensivierung der Geldwirtschaft und gewerblichen Produktion gefördert, die sich auch auf das rasche Wachstum der Städte und den Zuwachs an sozialer Mobilität auswirkten. Demnach sind die Bettelorden nicht nur als theologische Gruppierungen zu verstehen, sondern - da sich der Großteil der Mendikantenorden in der unmittelbaren Umgebung einer Gemeinde niederließ - auch als Teil der politischen, sozialen und geistigen Gesellschaft. Auch in Lüneburg ließen sich 1226 Minoriten nieder und gründeten das Barfüßerkloster zu St. Marien. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Geschichte des ehemaligen Franziskanerklosters St. Marien im Herzen des heutigen Lüneburgs. Betrachtet man das Stadtbild, so lässt sich der prominente Standort des Klosters in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Rathaus nicht verhehlen; ein Standort, der für ein Bettelordenskloster doch ungewöhnlich erscheint. Unter welchen Umständen kam es zur Ansiedlung der fratres minores an dieser exponierten Stelle und auf welche Weise kam der Orden, der sich der Armut verschrieben hatte zu einem Landbesitz, den der Lüneburger Stadthistoriker Reinecke als den besten Bauplatz der gesamten Stadt bezeichnete? Ebenso werden die sozialen Beziehungen zwischen den Minoriten und der Stadtgemeinschaft untersucht. Gab es Verbindungen zwischen dem Orden und dem bereits ansässigen Ordensklerus der Stadt und inwieweit waren die Minoriten mit der kommunalen Elite, aber auch mit der Unterschicht Lüneburgs in Kontakt? Abschließend werden auch die Umstände, unter denen es zur Reform und Aufhebung des Franziskanerkonvents kam, näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ansiedlung der Minderbrüder in Lüneburg
- Die Beziehungen der fratres minores zur Stadtgemeinschaft Lüneburgs
- Beziehungen zum Stadtklerus
- Beziehungen zur Bürgerschaft
- Die Reform des Marienklosters
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Geschichte des ehemaligen Franziskanerklosters St. Marien in Lüneburg. Sie untersucht die Umstände der Ansiedlung der Minderbrüder in der Stadt, ihre Beziehungen zur Stadtgemeinschaft sowie die Reform und Aufhebung des Klosters.
- Die Ansiedlung der Minderbrüder in Lüneburg und deren Hintergründe
- Die Beziehungen der Minderbrüder zum Stadtklerus und zur Bürgerschaft
- Der Einfluss der Minderbrüder auf die Entwicklung Lüneburgs
- Die Reform des Marienklosters und die Gründe dafür
- Die Bedeutung des Franziskanerklosters für die Stadtgeschichte Lüneburgs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Bedeutung von Klöstern und Mönchen im Mittelalter und stellt die Stadt Lüneburg als Standort des Franziskanerklosters St. Marien vor. Sie erläutert die Entstehung der Bettelordensbewegung und die Rolle der Franziskaner als Vertreter eines Lebens in Armut.
Das zweite Kapitel widmet sich der Ansiedlung der Minderbrüder in Lüneburg. Es beschreibt die Ausbreitung der Franziskanerbewegung in Deutschland und die ersten Kontakte des Ordens in Lüneburg. Die Umstände der Gründung des Klosters St. Marien im Jahr 1235 werden untersucht, wobei auch die Quellenlage berücksichtigt wird.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Franziskanern, einem Bettelorden, und deren Rolle in der mittelalterlichen Stadt Lüneburg. Schlüsselbegriffe sind die Ansiedlung der Minderbrüder, die Beziehungen des Ordens zur Stadtgemeinschaft, das Marienkloster, die Reform des Klosters, die Geschichte Lüneburgs im Mittelalter und die vita apostolica.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Minderbrüder in Lüneburg?
Die Minderbrüder waren Angehörige des Franziskanerordens, eines Bettelordens, der sich im 13. Jahrhundert in Lüneburg niederließ und das Kloster St. Marien gründete.
Was ist das Besondere am Standort des Marienklosters?
Obwohl Franziskaner der Armut verpflichtet waren, befand sich ihr Kloster an einem prominenten Standort direkt neben dem Rathaus, was für einen Bettelorden ungewöhnlich war.
Was bedeutet „vita apostolica“ für die Franziskaner?
Es bezeichnet ein Leben nach dem Vorbild der Urkirche in absoluter Armut und als „Armer unter Armen“, um das Evangelium wahrhaftig zu bezeugen.
Wie war das Verhältnis zwischen den Mönchen und der Bürgerschaft?
Die Minderbrüder waren eng in das soziale und politische Leben Lüneburgs eingebunden. Sie hatten Kontakte sowohl zur kommunalen Elite als auch zur Unterschicht der Stadt.
Warum wurde das Franziskanerkloster später reformiert?
Die Arbeit untersucht die Umstände der Reform und späteren Aufhebung des Konvents, die oft mit internen Ordensentwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhingen.
- Quote paper
- Marcus Sonntag (Author), 2006, Die Minderbrüder von St. Marien zu Lüneburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63401