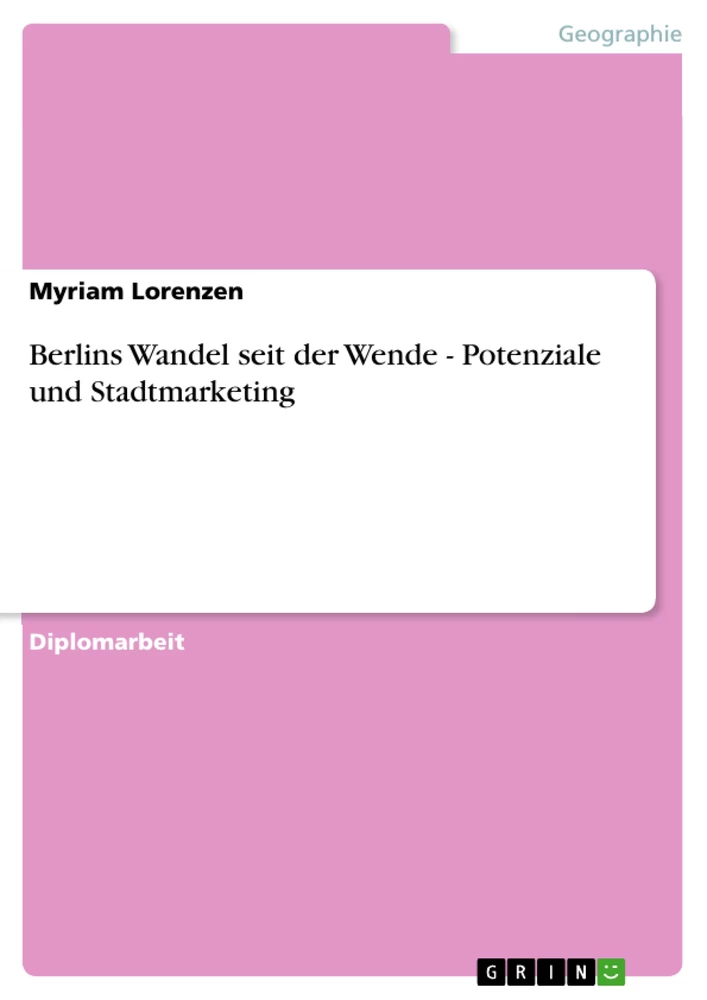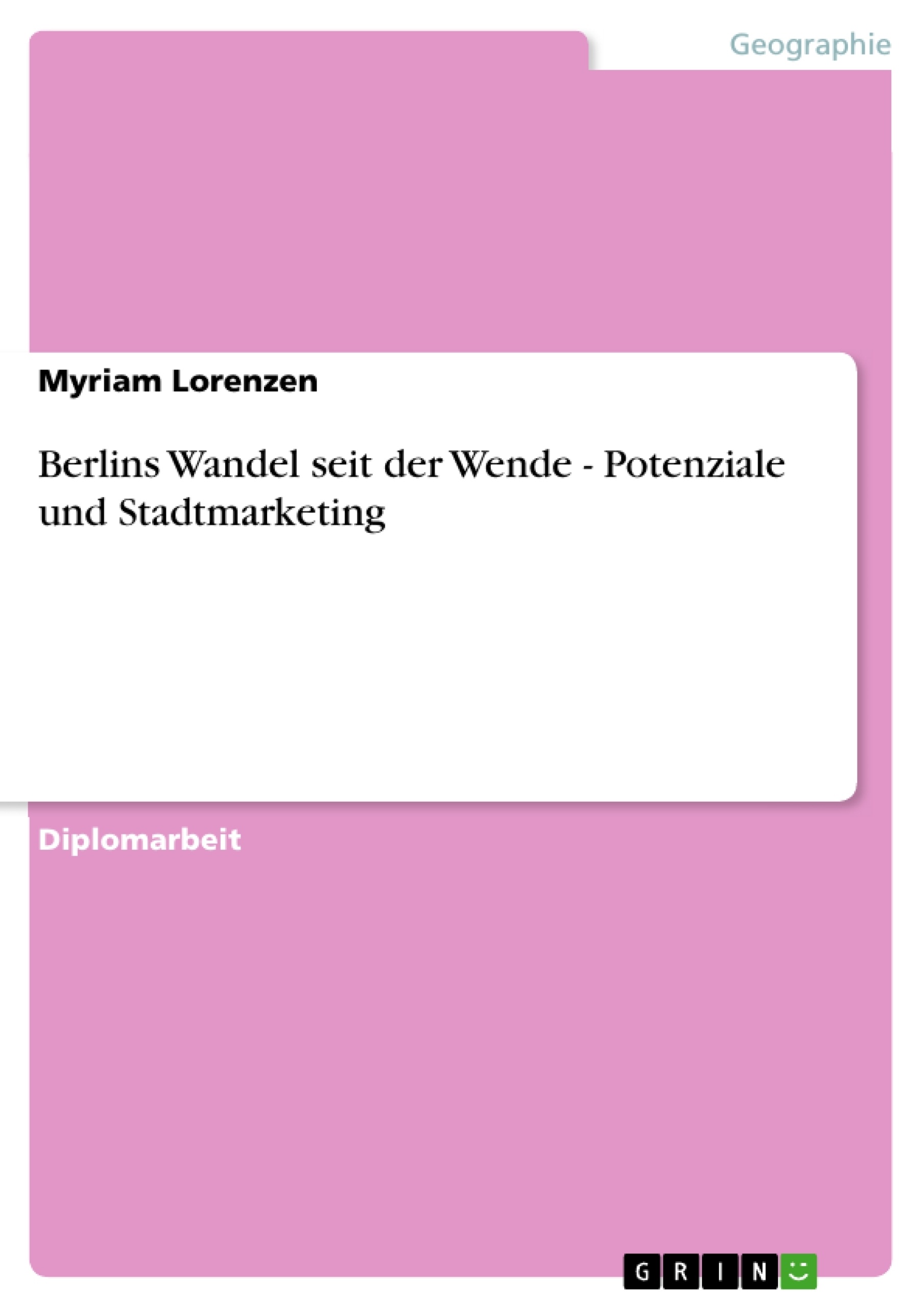Nach der Wiedervereinigung Deutschlands befand sich Berlin in einer drastischen Umbruchsituation. Der rasante Strukturwandel bot viel Raum für Spekulationen und Visionen bezüglich der zukünftigen Rolle der Stadt. Hinzu kam neben der neuen Funktion als Hauptstadt und zukünftiger Regierungssitz das direkte Aufeinandertreffen von Ost und West, das zusätzliches Potenzial für euphorische Erwartungen lieferte. Anfang der 1990er Jahre sah man Berlin als aufstrebenden Wirtschaftsstandort mit starkem Bevölkerungswachstum und als Stadt mit potenziellem Metropolencharakter. Ihre Besonderheit im Gegensatz zu anderen Städten stellt dabei der verspätet einsetzende und dadurch sehr rapide Strukturwandel dar. Durch die geopolitischen Veränderungen musste sich die gerade ernannte gesamtdeutsche Hauptstadt von nun an im Wettbewerb der Städte neu behaupten, da die Sonderrolle, die sie während der Teilung Deutschlands eingenommen hatte, wegfiel. Um sich in dieser Konkurrenzsituation etablieren zu können, bedurfte es innovativer Instrumente in der Stadtentwicklung.
Seit Mitte der 1980er Jahre gilt das Stadtmarketing in Deutschland als Instrument zur Lösung vorherrschender Probleme der Städte. Es bietet umfassende Maßnahmen, mit dem Ziel, die Standortbedingungen sowohl für Unternehmen und Einwohner als auch für Touristen in gleichem Maße zu verbessern, um eine Stadt im verstärkten Wettbewerb zu profilieren. Dabei geht es um die Identifizierung, Aktivierung und Koordinierung vorhandener Potenziale und Akteure (Maier/Weber 2002: 9). Dieses Instrument dient als theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit.
In Berlin versuchen öffentliche und private Akteure seit Mitte der 1990er Jahre ein neues Konzept für die zukünftige wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Gestaltung der Stadtentwicklung in Form von Stadtmarketing zu entwerfen. Dennoch konnte die erhoffte Position in der Städtekonkurrenz bisher nicht eingenommen werden. Blickt man heute, fast 16 Jahre nach dem Fall der Mauer, zurück, so stellt man fest, dass Berlin im Wettbewerb der Städte keinen Durchbruch erzielt hat. Die Hauptstadt konnte bisher weder Funktionen anderer Städte übernehmen, noch hat sie eine florierende Wirtschaft vorzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- GRUNDLAGEN DES STADTMARKETING
- Vom Marketing zum Stadtmarketing
- Gründe für die Entstehung
- Ziele und Aufgabenfelder
- Die Rolle des öffentlichen Sektors
- New Public Management
- Public Private Partnership
- Konventionelle Stadtentwicklungsplanung und Stadtmarketing
- Stadtmarketinginstrumente
- Idealtypischer Ablauf
- Aktuelle Ergebnisse des Stadtmarketing-Prozesses in Deutschland
- METHODISCHE VORGEHENSWEISE
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Experteninterviews
- Weitere Datenquellen
- DIE WAHRNEHMUNG DER POTENZIALE BERLINS IN DER LITERATUR
- Infrastruktur
- Industrie
- Dienstleistungssektor allgemein
- Wissenschaft
- Tourismus
- Kultur
- Finanzplatz
- Bevölkerung
- Verwaltung
- Funktionelle Bereiche
- Hauptstadtfunktion
- Ost-West-Kompetenz
- Berlin-Brandenburg als Region
- Verhältnis zu anderen Städten
- Zwischenfazit: Wahrnehmung der Potenziale Berlins
- STADTMARKETING IN BERLIN
- Die Einführung von Stadtmarketing und seine Institutionalisierung
- Struktureller Aufbau
- Die Akteure des Stadtmarketing in Berlin
- Der Senat von Berlin
- Berlin Partner GmbH
- Berlin Tourismus Marketing GmbH (BTM)
- Sonstige Akteure des Berliner Stadtmarketing
- Kooperation
- Aufgabenstellung des Berliner Stadtmarketing
- Finanzierung
- Verfahren der Erfolgskontrolle
- Probleme und Konflikte
- Stadtmarketing-Konzept für Berlin
- Situationsanalyse
- Imageanalysen
- Stadtmarketing-Maßnahmen
- Allgemeiner Überblick
- Auswertung einzelner Aktivitäten
- BEWERTUNG DES STADTMARKETING VON BERLIN
- Besonderheiten
- Berücksichtigung der Potenziale
- Verbesserungsvorschläge
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Entwicklung des Stadtmarketings in Berlin seit der Wende, untersucht die Potenziale der Stadt und bewertet die bisherige Umsetzung des Stadtmarketing-Konzeptes.
- Entwicklung des Stadtmarketings in Berlin seit der Wende
- Analyse der Potenziale Berlins in den Bereichen Infrastruktur, Industrie, Dienstleistungen, Wissenschaft, Tourismus, Kultur, Finanzplatz und Bevölkerung
- Bewertung der Stadtmarketing-Aktivitäten in Bezug auf die Berücksichtigung der Potenziale und die Erreichung der Ziele
- Identifizierung von Problemen und Konflikten im Berliner Stadtmarketing
- Ableitung von Verbesserungsvorschlägen für die zukünftige Gestaltung des Stadtmarketings
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen des Stadtmarketings, erklärt die Entstehung und Entwicklung des Konzepts sowie die Rolle des öffentlichen Sektors im Stadtmarketing.
- Das dritte Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf eine qualitative Inhaltsanalyse und Experteninterviews stützt.
- Das vierte Kapitel analysiert die Wahrnehmung der Potenziale Berlins in der Literatur und beleuchtet die Stärken und Schwächen der Stadt in verschiedenen Bereichen.
- Das fünfte Kapitel behandelt das Stadtmarketing in Berlin, untersucht die Akteure, die Aufgabenstellung, die Finanzierung und die Erfolgskontrolle des Stadtmarketing-Konzepts.
- Das sechste Kapitel bewertet das Berliner Stadtmarketing unter Berücksichtigung der Potenziale und der bisherigen Umsetzung des Konzepts.
Schlüsselwörter
Stadtmarketing, Berlin, Potenziale, Wende, Stadtentwicklung, Tourismus, Kultur, Wirtschaft, Finanzierung, Erfolgskontrolle, Image, Marketing-Mix, New Public Management, Public Private Partnership, Qualitative Inhaltsanalyse, Experteninterviews.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich Berlin nach der Wende städtebaulich entwickelt?
Nach 1989 erlebte Berlin einen rasanten Strukturwandel, geprägt durch die neue Hauptstadtfunktion und das Zusammenwachsen von Ost und West.
Was sind die Ziele des Stadtmarketings in Berlin?
Ziel ist es, die Standortbedingungen für Unternehmen, Einwohner und Touristen zu verbessern und Berlin im internationalen Städtewettbewerb zu profilieren.
Welche Potenziale Berlins werden in der Arbeit analysiert?
Die Analyse umfasst Infrastruktur, Industrie, Wissenschaft, Tourismus, Kultur sowie die Funktion als Brücke zwischen Ost- und Westeuropa.
Wer sind die Hauptakteure des Berliner Stadtmarketings?
Wichtige Akteure sind der Senat von Berlin, die Berlin Partner GmbH und die Berlin Tourismus Marketing GmbH (BTM).
Warum hat Berlin den erhofften wirtschaftlichen Durchbruch bisher nicht voll erreicht?
Die Arbeit untersucht Probleme wie mangelnde Koordination, Finanzierungsschwierigkeiten und die Herausforderung, Funktionen anderer etablierter Metropolen zu übernehmen.
- Quote paper
- Myriam Lorenzen (Author), 2005, Berlins Wandel seit der Wende - Potenziale und Stadtmarketing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63464