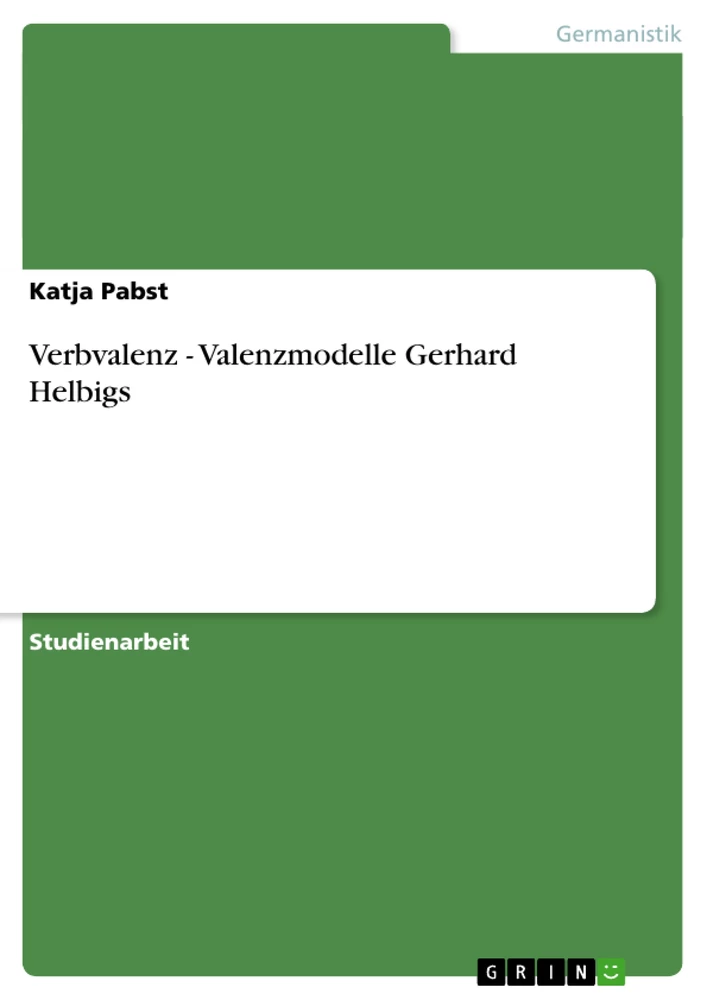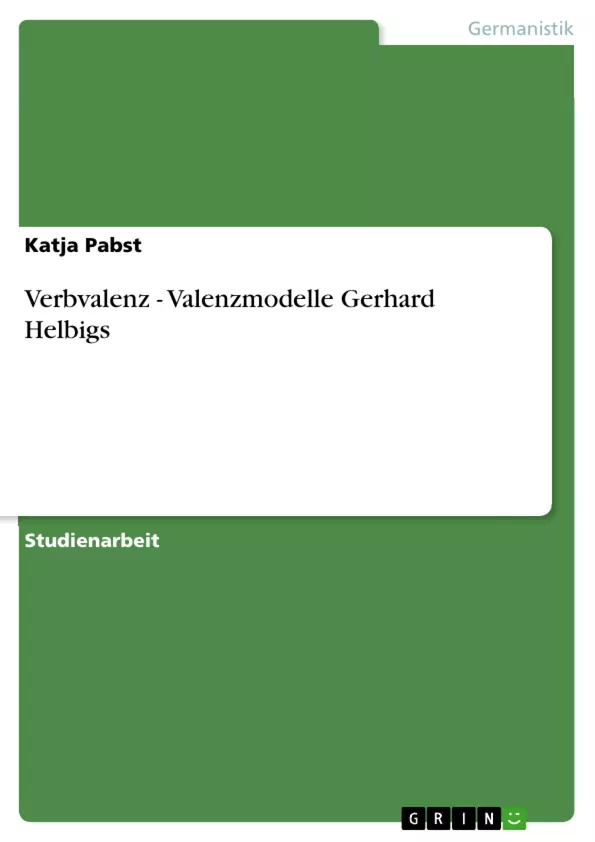Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Verbvalenz und ihrer Darstellung in den zwei Valenzmodellen Gerhard Helbigs. Ich gehe der Frage nachgehen, wie diese Modelle aufgebaut sind und zeige, welche Valenztypen darin berücksichtigt werden. Im weiteren möchte ich klären, was Helbigs Motivation ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Zu Beginn der Arbeit werde ich zunächst den Begriff Verbvalenz vorstellen und im weiteren Verlauf auch auf andere Begriffe (z.B. fakultativ, obligatorisch etc.) erklärend eingehen.
Ich werde von den zwei Modellen Helbigs zunächst den Entwurf vorstellen, der erstmalig im 1969 erschienenen Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben Anwendung findet und in dem Helbig die syntaktische und semantische Umgebung von Verben auf drei Stufen beschreibt. Dabei dient mir als Textgrundlage die siebte unveränderte Auflage von 1983. Das 3-Stufen-Modell von Helbig weist einige Schwachpunkte auf, die hauptsächlich darin bestehen, dass die Valenz der Verben vorrangig in ihrer syntaktischen Umgebung beschrieben werden. Der semantische Aspekt wird zwar berücksichtigt, doch bedarf es einer weitergehenden lexikographischen Beschreibung der Verben. Um eine Anleitung für die korrekte Benutzung von Verben zu sein, enthält dieses Modell zu wenig Informationen. Aus diesem Grund wurde das 3-Stufen-Modell später von Helbig überarbeitet und die Valenz der Verben in einem erweiterten 6-Stufen-Modell dargestellt. Auch dieses Modell werde ich vergleichend präsentieren.
Ziel der Arbeit ist es, den inhaltlichen und strukturellen Aufbau des Valenzwörterbuchs von 1969 und des 3- bzw. 6-Stufen-Modells aufzuzeigen, die Unterschiede beider Modelle darzustellen und ihren Nutzen für die Anwender in der Praxis zu klären.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verbvalenz
- Ausgangspunkt
- Valenz und Satzmodelle
- Das 3-Stufen-Modell
- Stufe I
- Stufe II
- Stufe III
- Zusammenfassung
- Die Entwicklung zum 6-Stufen-Modell
- Das 6-Stufen-Modell
- Stufe I
- Stufe II
- Stufe III
- Stufe IV
- Stufe V
- Stufe VI
- Die wesentlichen Unterschiede der Modelle
- Nutzen der Modelle für den Anwender
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Verbvalenz und ihrer Darstellung in den zwei Valenzmodellen Gerhard Helbigs. Der Fokus liegt auf der Analyse des Aufbaus dieser Modelle und der darin berücksichtigten Valenztypen. Des Weiteren wird die Motivation Helbigs, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, beleuchtet. Die Arbeit stellt den Entwurf des 3-Stufen-Modells vor, das erstmalig im Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben aus dem Jahr 1969 Verwendung findet und die syntaktische und semantische Umgebung von Verben beschreibt. Anschließend wird das erweiterte 6-Stufen-Modell vorgestellt, das als Weiterentwicklung des 3-Stufen-Modells gilt. Ziel der Arbeit ist es, den inhaltlichen und strukturellen Aufbau des Valenzwörterbuchs von 1969 sowie des 3- bzw. 6-Stufen-Modells aufzuzeigen, die Unterschiede beider Modelle darzustellen und ihren Nutzen für die Anwender in der Praxis zu klären.
- Analyse der Valenzmodelle Gerhard Helbigs
- Beschreibung der Valenztypen in den Modellen
- Motivation Helbigs für die Beschäftigung mit Verbvalenz
- Vergleich des 3-Stufen-Modells und des 6-Stufen-Modells
- Bewertung des Nutzens der Modelle für die Anwendung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema der Verbvalenz ein und stellt die beiden Valenzmodelle von Gerhard Helbig vor, die im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Sie erläutert die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
- Das Kapitel "Verbvalenz" definiert den Begriff Verbvalenz und stellt die zentrale Rolle des Verbs im Satz sowie seine Fähigkeit zur Vorstrukturierung der syntaktischen Umgebung dar.
- Das Kapitel "Ausgangspunkt" erläutert die Motivation Helbigs für die Entwicklung seines Wörterbuchs zur Valenz und Distribution deutscher Verben.
- Das Kapitel "Valenz und Satzmodelle" stellt das 3-Stufen-Modell von Helbig vor und erläutert seine grundlegenden Prinzipien.
- Das Kapitel "Das 3-Stufen-Modell" beschreibt die drei Stufen des Modells im Detail und geht auf die syntaktische und semantische Beschreibung der Verbvalenz ein.
- Das Kapitel "Die Entwicklung zum 6-Stufen-Modell" erklärt die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des 3-Stufen-Modells und die Entstehung des 6-Stufen-Modells.
- Das Kapitel "Das 6-Stufen-Modell" präsentiert die sechs Stufen des Modells und geht auf die einzelnen Stufen im Detail ein.
- Das Kapitel "Die wesentlichen Unterschiede der Modelle" stellt die Unterschiede zwischen dem 3-Stufen-Modell und dem 6-Stufen-Modell heraus.
- Das Kapitel "Nutzen der Modelle für den Anwender" beleuchtet die praktischen Vorteile der Valenzmodelle für die Anwendung in der Praxis.
Schlüsselwörter
Verbvalenz, Valenzmodelle, Gerhard Helbig, 3-Stufen-Modell, 6-Stufen-Modell, syntaktische Umgebung, semantische Umgebung, Valenztypen, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, lexikographische Beschreibung, Anwendung in der Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Verbvalenz?
Verbvalenz bezeichnet die Fähigkeit eines Verbs, Leerstellen im Satz zu eröffnen, die durch bestimmte Ergänzungen (obligatorisch oder fakultativ) gefüllt werden müssen.
Was unterscheidet Helbigs 3-Stufen-Modell vom 6-Stufen-Modell?
Das 3-Stufen-Modell beschreibt primär die syntaktische Umgebung. Das erweiterte 6-Stufen-Modell bietet eine tiefere lexikographische und semantische Beschreibung für eine korrektere Anwendung.
Was sind obligatorische und fakultative Ergänzungen?
Obligatorische Ergänzungen müssen zwingend im Satz stehen, damit dieser grammatisch korrekt ist. Fakultative Ergänzungen können weggelassen werden, ohne die Grundstruktur zu zerstören.
Welchen Nutzen haben diese Modelle für die Praxis?
Sie dienen als Grundlage für Valenzwörterbücher und helfen Sprachlernenden sowie Linguisten, die korrekte Satzbildung und Bedeutung von Verben zu verstehen.
Wann erschien das erste Valenzwörterbuch von Helbig?
Das „Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben“ wurde erstmals 1969 veröffentlicht und nutzte das 3-Stufen-Modell.
- Arbeit zitieren
- Katja Pabst (Autor:in), 2002, Verbvalenz - Valenzmodelle Gerhard Helbigs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6350