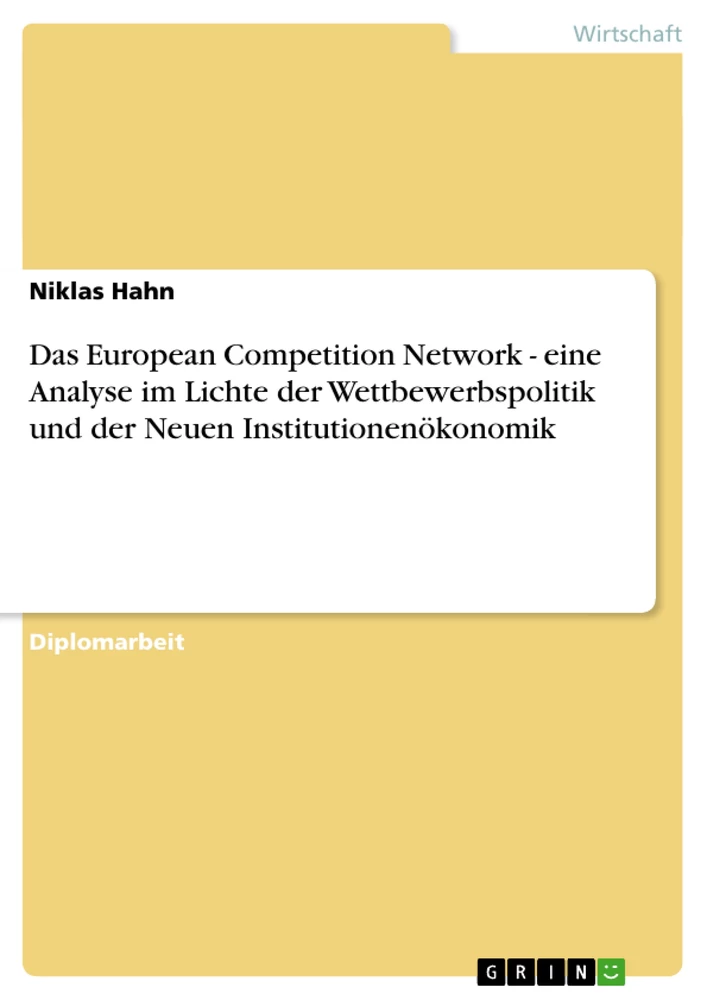Seit dem 01. Mai. 2004 arbeiten die nationalen Wettbewerbsbehörden und die Europäische Kommission (EK) in Fragen des Kartellrechts zusammen. Die Zusammenarbeit im Rahmen des European Competition Network (ECN) soll den geänderten Rahmenbedingungen des europäischen Binnenmarkts zukünftig Rechnung tragen. Diese Kooperation der Behörden soll dabei effizienter und gebündelter gegen transnationale Kartelle vorgehen.
Zu demselben Zeitpunkt ist die neue Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Europäischen Rates in Kraft getreten. Die Verordnung, die im Dezember 2002 durch den Europäischen Rat verabschiedet wurde, bestimmt die Durchsetzung der in den Artikeln 81 und 82 des EG-Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln. Die vorherigen kartellrechtlichen Regeln führten im zunehmend integrierten und wachsenden Europa vermehrt zu Koordinationsproblemen zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union (EU). Die fortschreitende Globalisierung und die ökonomischen sowie sozialen Verflechtungen der verschiedenen Märkte innerhalb der EU, aber auch weltweit, haben eine solche Anpassung erforderlich gemacht. Die Erweiterung der EU um zehn Mitgliedsstaaten, ebenfalls zum 1. Mai 2004, macht diese Notwendigkeit unmittelbar deutlich. Dies stellt die EU auf der einen Seite vor eine Vielzahl an Herausforderungen, die sie bewältigen muss. Auf der anderen Seite bedeutet die EU-Erweiterung vor allem aber eine Chance für die Wirtschaftskraft der EU, sofern es gelingt, ein stabiles Wirtschaftswachstum als Grundlage für Wohlfahrtssteigerungen der gesamten Bevölkerung dieser Gemeinschaft zu schaffen. Der Erfolg eines stabilen Wachstums liegt in erster Linie in einer effizienten Koordination aller Wettbewerbsfragen, die den europäischen Binnenmarkt betreffen, begründet. Besonders die Möglichkeit einzelner Wirtschaftsobjekte, den transnationalen Handel durch Absprachen zu verfälschen oder zu hindern, gilt es dabei zu unterbinden. Dies impliziert, dass der ökonomische Wandel in der EU unmittelbar auch einen erfolgreichen institutionellen Wechsel notwendig macht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die europäische Wettbewerbspolitik
- 2.1. Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Wettbewerbspolitik
- 2.1.1. Die Funktionen des unbeschränkten Wettbewerbs
- 2.1.2. Die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsfunktionen durch eine europaweite Wettbewerbspolitik
- 2.2. Die europäische Wettbewerbspolitik vor der VO 1/2003
- 2.2.1. Wettbewerbspolitische Regelungen vor dem 01. Mai 2004
- 2.2.2. Das Problem der Zuständigkeit zwischen den Institutionen
- 2.3. Die neue europäische Wettbewerbspolitik nach der VO 1/2003
- 2.3.1. Neuerungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
- 2.3.2. Die Rechtsunsicherheit der beteiligten Unternehmen
- 3. Das European Competition Network - eine wettbewerbspolitische Analyse
- 3.1 Das European Competition Network – eine Chance für ein starkes Europa?
- 3.1.1 Ein Netzwerk der Wettbewerbsbehörden
- 3.1.2 Wettbewerbspolitische Funktionen und Zielsetzungen des ECN
- 3.1.3 Notwendigkeiten und Implikationen für ein effizientes Netzwerk der Wettbewerbsbehörden
- 3.2 Ergebnisse aus wettbewerbspolitischer Sicht
- 4. Das European Competition Network - eine Analyse im Rahmen der neuen Institutionenökonomik
- 4.1 Die Ansätze der Neuen Institutionenökonomik
- 4.1.1. Die Ökonomische Analyse des Rechts
- 4.1.2. Prinzipal- Agenten-Beziehungen im Behördennetzwerk
- 4.1.3. Der Ansatz der Transaktionskosten
- 4.1.4. Der Ansatz der Neuen Politischen Ökonomie
- 4.1.5. Die Evolution von Institutionen
- 5. Ausblick
- Die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Wettbewerbspolitik
- Die Entwicklung der europäischen Wettbewerbspolitik
- Die Funktionsweise des ECN als Netzwerk der Wettbewerbsbehörden
- Die Anwendung der Neuen Institutionenökonomik auf das ECN
- Die Effizienz des ECN und die Auswirkungen auf die Wettbewerbspolitik in der EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert das European Competition Network (ECN) im Lichte der Wettbewerbspolitik und der Neuen Institutionenökonomik. Ziel ist es, die Funktionsweise und die Effizienz des ECN zu beurteilen und die Auswirkungen auf die Wettbewerbspolitik in der Europäischen Union zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Das erste Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz des ECN für die Wettbewerbspolitik in der EU. Es werden die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit vorgestellt.
Kapitel 2: Die europäische Wettbewerbspolitik
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der europäischen Wettbewerbspolitik und die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Wettbewerbspolitik. Es werden die Funktionen des unbeschränkten Wettbewerbs und die Herausforderungen für die Wettbewerbspolitik in der EU dargelegt.
Kapitel 3: Das European Competition Network - eine wettbewerbspolitische Analyse
Das dritte Kapitel analysiert das ECN als wettbewerbspolitisches Instrument. Es werden die Funktionsweise, die Zielsetzungen und die Implikationen des ECN für ein effizientes Netzwerk der Wettbewerbsbehörden untersucht.
Kapitel 4: Das European Competition Network - eine Analyse im Rahmen der neuen Institutionenökonomik
Dieses Kapitel betrachtet das ECN aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik. Es werden verschiedene Ansätze der Neuen Institutionenökonomik vorgestellt und auf das ECN angewendet, um die Effizienz und die Funktionsweise des Netzwerks zu beurteilen.
Schlüsselwörter
European Competition Network, Wettbewerbspolitik, Neue Institutionenökonomik, grenzüberschreitende Wettbewerbspolitik, Effizienz, Funktionsweise, Netzwerk der Wettbewerbsbehörden, Prinzipal-Agenten-Theorie, Transaktionskosten, Neue Politische Ökonomie
Häufig gestellte Fragen
Was ist das European Competition Network (ECN)?
Das ECN ist ein Netzwerk, in dem die nationalen Wettbewerbsbehörden der EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission seit 2004 eng zusammenarbeiten, um das Kartellrecht effizienter durchzusetzen.
Was änderte sich durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003?
Die Verordnung modernisierte die Durchsetzung der EU-Wettbewerbsregeln (Art. 81/82 EG-Vertrag) und dezentralisierte die Anwendung des Kartellverbots, was eine stärkere Koordination zwischen den Behörden erforderte.
Welche Rolle spielt die Neue Institutionenökonomik in der Analyse?
Sie dient als theoretischer Rahmen, um Transaktionskosten, Prinzipal-Agenten-Beziehungen innerhalb des Behördennetzwerks und die Evolution von Institutionen im Binnenmarkt zu untersuchen.
Wie geht das ECN gegen transnationale Kartelle vor?
Durch gebündelte Ressourcen und Informationsaustausch können die Behörden effizienter gegen Absprachen vorgehen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten verfälschen.
Warum war die EU-Erweiterung 2004 ein Grund für die Reform?
Mit 10 neuen Mitgliedstaaten wäre das alte, zentralisierte Anmeldesystem für Kartelle überlastet gewesen. Ein dezentrales Netzwerk war notwendig, um die Handlungsfähigkeit zu sichern.
- Arbeit zitieren
- Niklas Hahn (Autor:in), 2004, Das European Competition Network - eine Analyse im Lichte der Wettbewerbspolitik und der Neuen Institutionenökonomik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63520