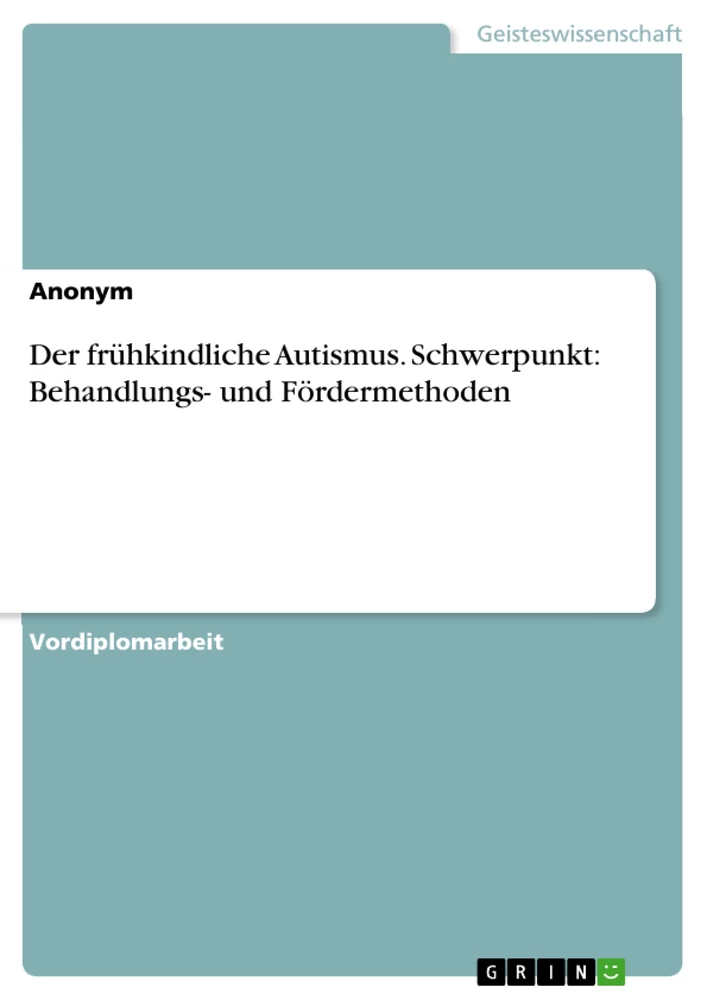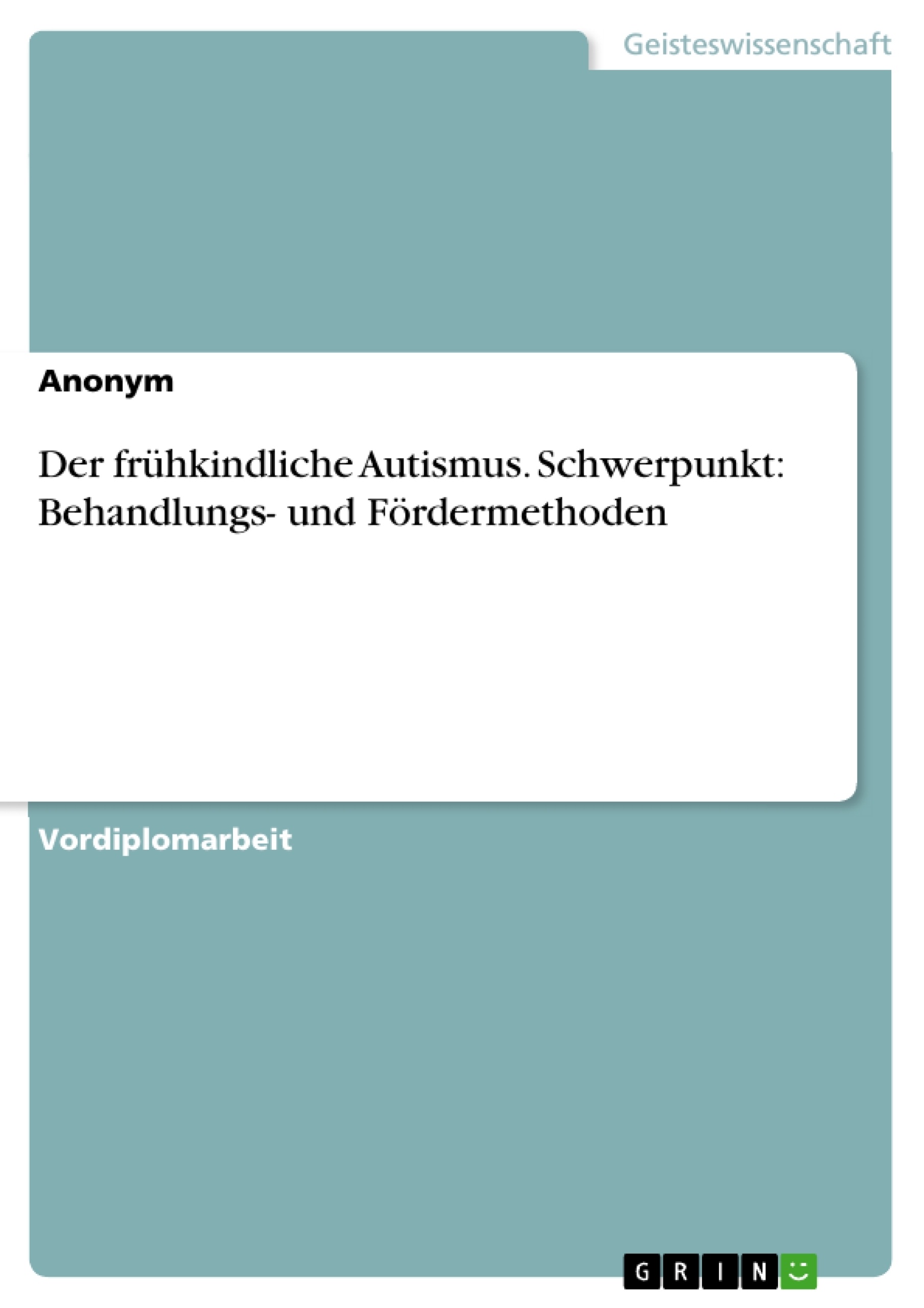Kaum eine andere Entwicklungsstörung hat weltweit Wissenschaftler so beschäftigt wie der frühkindliche Autismus. Und fragen wir jemanden, was er sich unter Autismus vorstellt, so erfahren wir in der Regel etwas über die gängigen Klischees: zwanghafte Rituale, bizarre Reaktionen, gestörter Blickkontakt und eigentümliche Verhaltensweisen. Des Weiteren erfährt man, dass diese Kinder zurückgezogen leben und kaum sprechen, jedoch seien sie hochintelligent und haben ein ausgezeichnetes Zahlenverständnis und können so, wie in vielen Filmen aus Hollywood zu sehen, die schwierigsten und geheimsten Computercodes knacken.
Im nachfolgenden Zitat beschreibt jedoch eine französische Schriftstellerin das Anders-Sein ihres Sohnes wie folgt: „Von deinem ersten Lebensjahr an, Julien-Hugo, und in den ersten Jahren danach hast du dich seltsam entwickelt, denn du weigerst dich zu sprechen, zu kauen, deine Notdurft zu verrichten. Stundenlang bliebst du reglos, mit abwesendem Blick sitzen. Deine Hauptbeschäftigung bestand darin, irgendwelche Gegenstände zu drehen, aber du schriest, wenn man etwas zu dir sagte oder wenn man dich in den Arm nehmen wollte. Du schriest, sobald man nur deinen Namen aussprach. Dabei habe ich versucht, ihn auf tausenderlei Arten zu modulieren. Doch das ändert nichts, es war unmöglich, dich zu rufen.“
Was steckt nun hinter dieser für die meisten geheimnisvollen Krankheit? Diese Arbeit stellt das Krankheitsbild des frühkindlichen Autismus vor. Was für Behandlungsmöglichkeiten gibt es und was kann mit ihnen erreicht werden? Kann man Autismus vielleicht sogar heilen? Diese Fragen sollen Gegenstand des Kapitels 7 über Behandlungs- und Fördermethoden sein. Hierfür sind jedoch auch Kenntnisse über Symptome und Ursachen von großer Bedeutung, da diese immer auch Gegenstand einer Therapie sein sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Verhaltensauffälligkeiten
- Entwicklungsstörungen
- Psychische Störungen
- Was unter Autismus verstanden wird
- Symptomatik
- Wahrnehmung
- Sprache
- Motorik und autonome Funktionen
- Sekundäre Verhaltensprobleme
- Spezielle Fertigkeiten
- Formen, Diagnostik und Epidemiologie von Autismus
- Behandlungs- und Fördermethoden
- Allgemeine Prinzipien der Förderung
- Frühförderung
- Verhaltenstherapie
- Körperbezogene Verfahren
- Pädagogische Programme
- Medikamentöse Therapie
- Krisenintervention
- Neuere Trends in der Behandlung
- Verlauf und Prognose
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Krankheitsbild des frühkindlichen Autismus. Sie beleuchtet die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und deren Erfolge. Ein zentrales Thema ist die Frage, ob Autismus heilbar ist.
- Definition von Autismus und Abgrenzung zu anderen Störungsbildern
- Symptome und Besonderheiten im Verhalten von Kindern mit Autismus
- Diagnostik und Beurteilung von Autismus
- verschiedene Behandlungs- und Fördermethoden
- Bewertung der Wirksamkeit verschiedener Therapien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung und die vielfältigen Aspekte von Autismus beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden wichtige Begriffe wie Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen und psychische Störungen definiert und voneinander abgegrenzt.
Im dritten Kapitel wird das Krankheitsbild des Autismus genauer betrachtet. Die Symptomatik, die sich in verschiedenen Bereichen wie Wahrnehmung, Sprache, Motorik und Verhalten zeigt, wird ausführlich beschrieben.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Formen, der Diagnostik und der Epidemiologie von Autismus. Es werden verschiedene Formen von Autismus vorgestellt, diagnostische Verfahren erläutert und die Häufigkeit des Autismus in der Bevölkerung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Frühkindlicher Autismus, Entwicklungsstörung, Verhaltensauffälligkeiten, Symptomatik, Diagnostik, Behandlungsmethoden, Förderung, Therapie, Pädagogische Programme, Verhaltenstherapie, Körperbezogene Verfahren, Medikamentöse Therapie
Häufig gestellte Fragen
Was sind die typischen Symptome von frühkindlichem Autismus?
Dazu gehören Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion, Verzögerungen in der Sprachentwicklung, stereotype Verhaltensweisen und Besonderheiten in der Sinneswahrnehmung.
Ist frühkindlicher Autismus heilbar?
Autismus gilt nach aktuellem Stand als eine lebenslange Entwicklungsstörung; durch gezielte Förderung können jedoch erhebliche Fortschritte in der Lebensqualität erzielt werden.
Welche Behandlungsmethoden gibt es?
Gängige Methoden sind Verhaltenstherapie (z.B. ABA), pädagogische Programme (TEACCH), Frühförderung sowie körperbezogene und medikamentöse Therapien.
Wie wird Autismus diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt meist durch spezialisierte Kinder- und Jugendpsychiater anhand standardisierter Beobachtungsskalen und ausführlicher Anamnesegespräche mit den Eltern.
Warum haben Autisten oft "Spezialinteressen"?
Spezialinteressen bieten den Betroffenen Sicherheit und Struktur in einer oft als chaotisch empfundenen Welt und können beeindruckende Fachkenntnisse hervorbringen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Der frühkindliche Autismus. Schwerpunkt: Behandlungs- und Fördermethoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63606