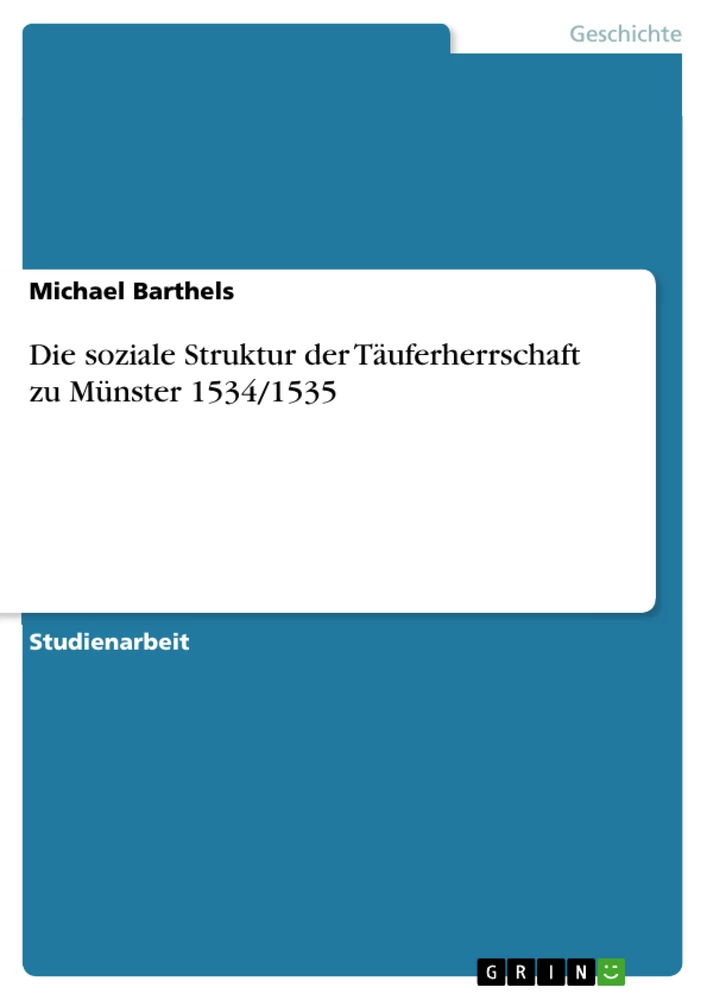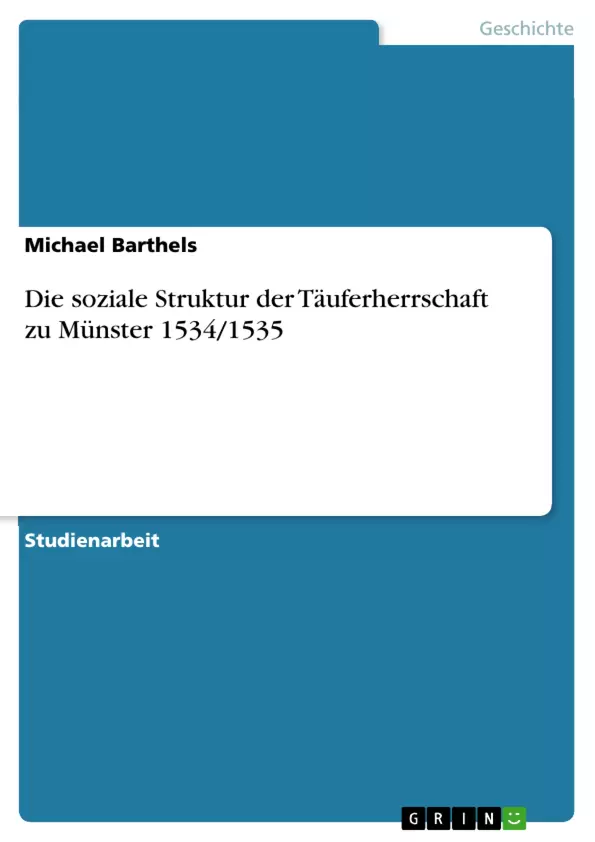Die Täuferherrschaft zu Münster 1534-1535 hat die Historiker immer wieder beschäftigt. Nicht nur, weil sie in der Zeit der Reformation eine politische Ausnahmeerscheinung bietet, sondern auch, weil durch sie das Ansehen des ganzen Täufertums stark geprägt, wenn nicht gar diskreditiert worden ist. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Darstellungen über dieses Thema, auch wegen den unterschiedlichen Interpretationen der Sozialstruktur des münsterischen Täufertums, zumeist tendenziös oder von ideologischen Einstellungen der Historiker geprägt. Zudem handelten sie die Täuferherrschaft vor allem auf Basis des Berichtes Hermann Kerssenbroiks ab, der selbst nicht objektiv urteilte. Eine lange Zeit herrschte daher ein verzerrtes Bild vor, das erst durch die Betrachtungen von Historikern in der 2. Hälfte des 20 Jahrhunderts berichtigt, zumindest aber aus seinen engen Erklärungsansätzen befreit wurde. Dies bewirkte vor allem die intensive Beschäftigung mit den zeitgenössischen Quellen und der damit verbundene neue Untersuchungsansatz, der auf die soziale Zusammensetzung der Stadt Münster vor und während der Täuferherrschaft abzielte. Aufgabe der dieser Arbeit soll sein, den Forschungsstand im Hinblick auf diesen neueren Ansatz wiederzugeben. Unumgänglich wird dabei sein, Motive anzugeben, die den Einzelnen oder auch eine Gruppe dazu bewegt haben mögen, zum Täufertum zu konvertieren, um so die sozial-strukturelle Zusammensetzung zu erklären. Dabei lassen sich nur Vermutungen anstellen, da es unmöglich ist, den Menschen in die Köpfe zu schauen. Allein die Fakten der Quellen der Zeit, die Angaben über die soziale Zusammensetzung der Täuferanhängerschaft und die Träger des Täufertums zu Münster machen, können in Verbindung mit weiteren Erklärungsansätzen wie dem zeitgenössischen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Rahmen Indizien für diese Motive liefern. Es ist aufgrund dieser Aufgabenstellung geboten, den Hauptteil der Arbeit so zu untergliedern, daß zuerst Blicke auf die Rahmenbedingungen, die zu der Errichtung der Täuferherrschaft beigetragen haben, und die Motive für die Konversion zum Täufertum geworfen werden. Im Anschluß daran soll die soziologische Zusammensetzung sowohl der Stadt vor dem ,,Tausendjährigen Reich" wie Münster später genannt werden sollte, als auch während der Täuferherrschaft betrachtet werden. Im Schlußteil wird ein Ausblick gegeben, welche Auswirkungen die Täuferherrschaft auf die unmittelbar Betroffenen hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen und Hintergründe für die Errichtung der Täuferherrschaft zu Münster
- Die politischen Hintergründe
- Der verfassungsrechtliche Hintergrund der Stadt Münster
- Die wirtschaftlichen Hintergründe
- Die religiös-konfessionellen Hintergründe
- Während der Wiedertäuferherrschaft
- Suche nach den Motiven für die Konversion zum Täufertum in Münster
- Soziale Zusammensetzung des Münsterischen Täufertums
- Zur Quellenlage
- Soziale Zusammensetzung der Täufertum-Anhängerschaft in Münster vor dem Wiedertäuferreich
- Soziale Zusammensetzung der Täufertum-Trägerschaft in Münster nach der Machtübernahme bis zur Eroberung der Stadt
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, die soziale Struktur der Täuferherrschaft in Münster im Jahre 1534/1535 zu untersuchen und den aktuellen Forschungsstand in diesem Bereich darzustellen. Dabei werden insbesondere die Motive der Konversion zum Täufertum analysiert und die soziologische Zusammensetzung der Stadt Münster vor und während der Herrschaft der Täufer betrachtet.
- Politische Hintergründe der Täuferherrschaft in Münster
- Verfassungsrechtliche Strukturen der Stadt Münster
- Soziologische Zusammensetzung der Täufer-Anhängerschaft
- Motive für die Konversion zum Täufertum
- Die Auswirkungen der Täuferherrschaft auf die unmittelbar Betroffenen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der sozialen Struktur der Täuferherrschaft in Münster vor und erläutert die historischen und wissenschaftlichen Hintergründe sowie die Relevanz der Thematik.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen für die Errichtung der Täuferherrschaft in Münster. Es analysiert die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen und religiösen Hintergründe und zeigt die Spannungen auf, die zu dieser historischen Entwicklung geführt haben.
- Das dritte Kapitel untersucht die Motive, die Menschen in Münster dazu bewogen haben, zum Täufertum zu konvertieren. Hier werden die unterschiedlichen Faktoren, die zur Entscheidung für den Glauben der Täufer führten, anhand der verfügbaren Quellen untersucht.
- Im vierten Kapitel wird die soziale Zusammensetzung des Münsterischen Täufertums analysiert. Es werden die verschiedenen sozialen Schichten und Gruppen, die zum Täufertum gehörten, und ihre Rolle innerhalb der Täuferherrschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Täuferherrschaft, Münster, 1534/1535, soziale Struktur, Konversion, Motive, Quellenlage, Soziologie, Reformation, politische Hintergründe, verfassungsrechtliche Strukturen, wirtschaftliche Hintergründe, religiöse Hintergründe, Stadtgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Täuferherrschaft zu Münster?
Die Täuferherrschaft (1534-1535) war eine radikal-reformatorische Episode in Münster, die als politische Ausnahmeerscheinung der Reformationszeit gilt.
Warum galt das Bild der Täufer lange Zeit als verzerrt?
Frühere Darstellungen basierten oft auf dem subjektiven Bericht von Hermann Kerssenbroik und waren von ideologischen Einstellungen der Historiker geprägt.
Welche Faktoren begünstigten die Errichtung der Täuferherrschaft?
Die Arbeit nennt politische, verfassungsrechtliche, wirtschaftliche und religiös-konfessionelle Hintergründe in der Stadt Münster.
Wer waren die Träger des Täufertums in Münster?
Die Untersuchung analysiert die soziale Zusammensetzung der Anhängerschaft vor und während der Herrschaft anhand zeitgenössischer Quellen.
Was waren Motive für die Konversion zum Täufertum?
Obwohl man "nicht in die Köpfe schauen" kann, liefern Fakten über die soziale Lage und den religiösen Rahmen Indizien für die individuellen und gruppenspezifischen Motive.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Michael Barthels (Autor:in), 2000, Die soziale Struktur der Täuferherrschaft zu Münster 1534/1535, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/637