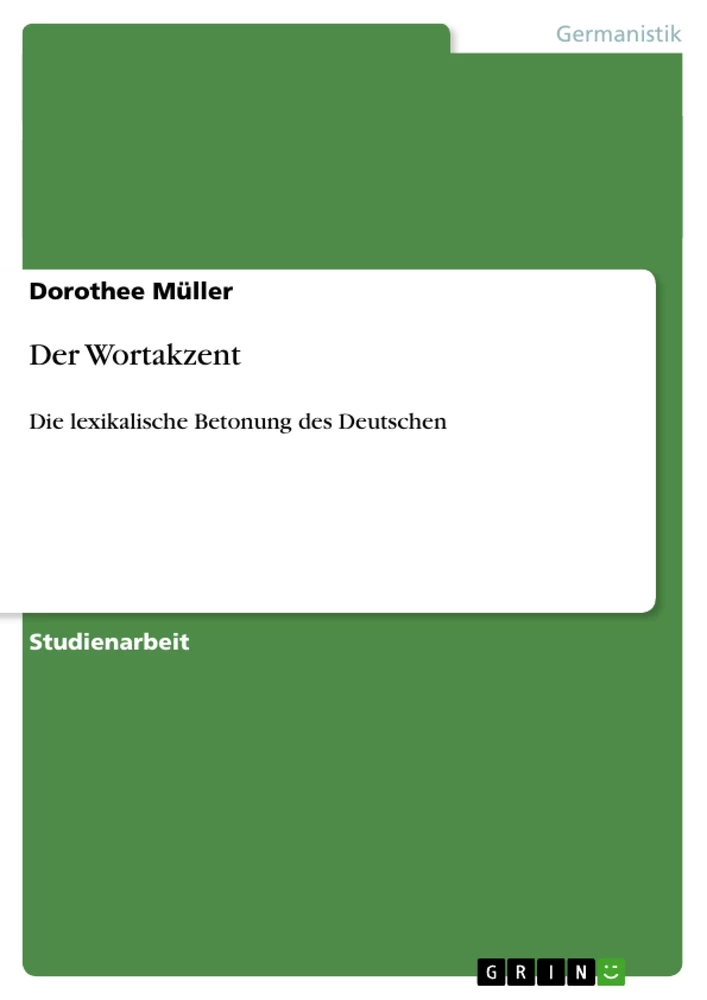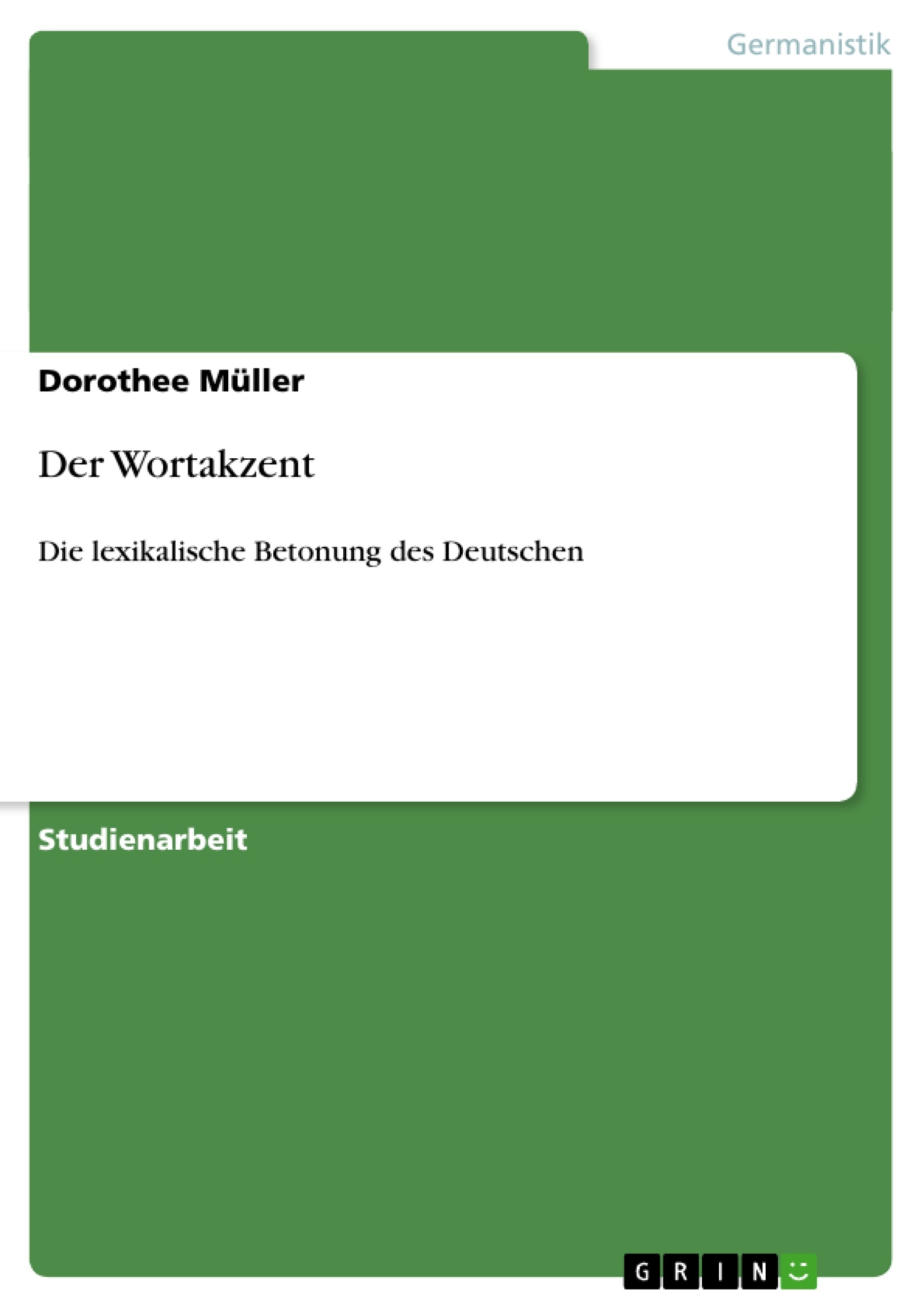Meine Arbeit beschäftigt sich mit einem Teil der metrischen Phonologie, dem Wortakzent. Zunächst gilt es zu klären, was man unter einem Akzent versteht. Anschließend gehe ich auf Generalisierungen ein, die im Zuge der Forschung bezüglich des Wortakzents festgelegt wurden. Ferner werde ich zwei verschiedene Darstellungsformen präsentieren, den metrischen Baum und das metrische Gitter. Um das Thema „Wortakzentregeln“ zu verdeutlichen, beziehe ich mich auf drei Sprachen: das australische Maranungku, das südamerikanische Weri und Latein. Des Weitern stelle ich Forschungsergebnisse bezüglich der lexikalischen Betonung des Deutschen vor und werde schließlich eine optimalitätstheoretische Analyse durchführen. Dem ersten Teil meiner Arbeit lege ich dem Text „Phonologie des Akzents“ von Tracy Allan Hall zu Grunde, die Untersuchungen zum Wortakzent des Deutschen entnehme ich den Ausführungen von C. Féry in „Phonologie des Deutschen“. Weitere Literatur werde ich im Text angeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Generalisierungen
- Darstellungsformen
- Der metrische Baum
- Silben
- Füße
- Prosodische Hierarchie
- Das metrische Gitter
- Der metrische Baum
- Wortakzentregeln
- Freier vs. fester Wortakzent
- Parameter nach Hayes
- Anwendung auf konkrete Beispiele
- Latein
- Australisches Maranungku
- Südamerikanisches Weri
- Lexikalische Betonung im Deutschen (Féry)
- Analyse der regelmäßigen Betonung in der OT
- Beispiele
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wortakzent im Rahmen der metrischen Phonologie. Sie klärt zunächst den Begriff des Akzents, präsentiert Generalisierungen aus der Forschung und erläutert verschiedene Darstellungsformen (metrischer Baum, metrisches Gitter). Anhand von Beispielsprachen (Maranungku, Weri, Latein) werden Wortakzentregeln verdeutlicht. Die Arbeit beinhaltet außerdem eine Betrachtung der lexikalischen Betonung im Deutschen und eine optimalitätstheoretische Analyse.
- Klärung des Begriffs „Wortakzent“ und seiner Eigenschaften.
- Darstellung und Erläuterung von Generalisierungen zur Phonologie des Wortakzents.
- Vergleich verschiedener Darstellungsformen des Wortakzents (metrischer Baum und Gitter).
- Analyse von Wortakzentregeln anhand konkreter Sprachbeispiele.
- Untersuchung der lexikalischen Betonung im Deutschen im Kontext der Optimalitätstheorie.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Wortakzent innerhalb der metrischen Phonologie ein. Sie definiert den Akzent als auditive Wahrnehmung der Prominenz eines Vokals im Vergleich zu anderen und erläutert seine Relativität. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau, der die Klärung des Akzentbegriffs, die Darstellung von Generalisierungen, die Vorstellung verschiedener Darstellungsformen und die Anwendung auf konkrete Sprachen umfasst. Sie benennt die zugrundeliegenden Texte von Tracy Allan Hall und C. Féry und kündigt eine optimalitätstheoretische Analyse an.
Generalisierungen: Dieses Kapitel präsentiert vier Generalisierungen aus der Forschung zur metrischen Phonologie, die sich auf den Wortakzent in Akzentsprachen beziehen. Die erste Generalisierung besagt, dass Wörter in Akzentsprachen einen einzigen Hauptakzent besitzen, wobei zwischen Funktions- und Lexikawörtern unterschieden wird. Die zweite Generalisierung postuliert die Nähe des Wortakzents zum Wortrand, mit einer Abstufung von der unmarkierten ersten Silbe zu Pänultima- und Finalbetonung. Die dritte Generalisierung beschreibt den rhythmischen Charakter des Akzentmusters in „bounded languages“ im Gegensatz zu „unbounded languages“. Schließlich wird die quantitätssensitive Natur des Wortakzents in einigen Sprachen erläutert, die sich auf das Silbengewicht bezieht.
Darstellungsformen: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung des Wortakzents mithilfe des metrischen Baums und des metrischen Gitters. Der metrische Baum visualisiert die hierarchische Struktur der Silben, Füße und der prosodischen Hierarchie. Das metrische Gitter bietet eine alternative Darstellung, die die Betonungsmuster in einer matrixartigen Form darstellt. Beide Methoden liefern unterschiedliche Perspektiven auf die Organisation und Struktur des Wortakzents.
Wortakzentregeln: Dieses Kapitel erläutert Wortakzentregeln anhand von Beispielen aus dem Lateinischen, dem Australischen Maranungku und dem Südamerikanischen Weri. Es werden die unterschiedlichen Betonungsmuster dieser Sprachen verglichen und analysiert, um die Vielfalt und die sprachspezifischen Regelmäßigkeiten im Wortakzent aufzuzeigen. Der Vergleich verdeutlicht, wie unterschiedlich Wortakzentmuster in verschiedenen Sprachen sein können.
Lexikalische Betonung im Deutschen (Féry): Dieses Kapitel befasst sich mit der lexikalischen Betonung im Deutschen, basierend auf den Arbeiten von C. Féry. Es analysiert die Regeln und Muster der Betonung in deutschen Wörtern und stellt die Ergebnisse der Forschung in diesem Bereich dar. Die Analyse beleuchtet die Komplexität und die Variabilität der Betonung im Deutschen.
Analyse der regelmäßigen Betonung in der OT: Dieses Kapitel führt eine Analyse der regelmäßigen Betonung im Rahmen der Optimalitätstheorie (OT) durch. Es werden konkrete Beispiele deutscher Wörter analysiert, um die Anwendung der OT-Prinzipien auf die Beschreibung und Erklärung von Wortakzentmustern zu demonstrieren. Die Analyse zeigt die Anwendung theoretischer Prinzipien auf empirische Daten.
Schlüsselwörter
Wortakzent, metrische Phonologie, Optimalitätstheorie, Akzentregeln, Prominenz, Silbengewicht, metrischer Baum, metrisches Gitter, Lexikalische Betonung, Deutsch, Latein, Maranungku, Weri, Generalisierungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit "Wortakzent in der metrischen Phonologie"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wortakzent im Rahmen der metrischen Phonologie. Sie behandelt die Definition und Eigenschaften des Wortakzents, Generalisierungen aus der Forschung, verschiedene Darstellungsformen (metrischer Baum, metrisches Gitter), Wortakzentregeln anhand von Beispielsprachen (Latein, Maranungku, Weri), lexikalische Betonung im Deutschen und eine optimalitätstheoretische Analyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit klärt den Begriff "Wortakzent", präsentiert Generalisierungen zur Phonologie des Wortakzents, vergleicht verschiedene Darstellungsformen (metrischer Baum und Gitter), analysiert Wortakzentregeln anhand konkreter Sprachbeispiele und untersucht die lexikalische Betonung im Deutschen im Kontext der Optimalitätstheorie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit besteht aus den Kapiteln Einleitung, Generalisierungen, Darstellungsformen (metrischer Baum und Gitter), Wortakzentregeln (am Beispiel von Latein, Maranungku und Weri), Lexikalische Betonung im Deutschen (nach Féry), Analyse der regelmäßigen Betonung in der Optimalitätstheorie (OT) und Abschluss. Jedes Kapitel befasst sich detailliert mit dem jeweiligen Aspekt des Wortakzents.
Welche Darstellungsformen des Wortakzents werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den metrischen Baum, der die hierarchische Struktur von Silben und Füßen visualisiert, und das metrische Gitter, eine matrixartige Darstellung von Betonungsmustern. Beide Methoden werden verglichen und ihre jeweiligen Vorteile erläutert.
Welche Sprachen dienen als Beispiel für die Wortakzentregeln?
Die Arbeit verwendet Latein, Australisches Maranungku und Südamerikanisches Weri als Beispielsprachen, um die Vielfalt und sprachspezifischen Regelmäßigkeiten von Wortakzentmustern zu veranschaulichen.
Welche Rolle spielt die Optimalitätstheorie (OT)?
Die Optimalitätstheorie wird verwendet, um die regelmäßige Betonung im Deutschen zu analysieren. Konkrete Beispiele deutscher Wörter werden herangezogen, um die Anwendung der OT-Prinzipien auf die Beschreibung und Erklärung von Wortakzentmustern zu demonstrieren.
Wie wird der Begriff "Wortakzent" definiert?
Der Wortakzent wird als auditive Wahrnehmung der Prominenz eines Vokals im Vergleich zu anderen Vokalen definiert. Seine Relativität wird hervorgehoben.
Welche Generalisierungen zur metrischen Phonologie werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert vier Generalisierungen: ein einziger Hauptakzent pro Wort in Akzentsprachen, die Nähe des Wortakzents zum Wortrand, der rhythmische Charakter des Akzentmusters in "bounded languages" im Gegensatz zu "unbounded languages" und die quantitätssensitive Natur des Wortakzents in einigen Sprachen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Wortakzent, metrische Phonologie, Optimalitätstheorie, Akzentregeln, Prominenz, Silbengewicht, metrischer Baum, metrisches Gitter, lexikalische Betonung, Deutsch, Latein, Maranungku, Weri und Generalisierungen.
Wer sind die wichtigsten Autoren, die in dieser Arbeit zitiert werden?
Die Arbeit bezieht sich auf die Texte von Tracy Allan Hall und C. Féry.
- Quote paper
- Dorothee Müller (Author), 2006, Der Wortakzent, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63716