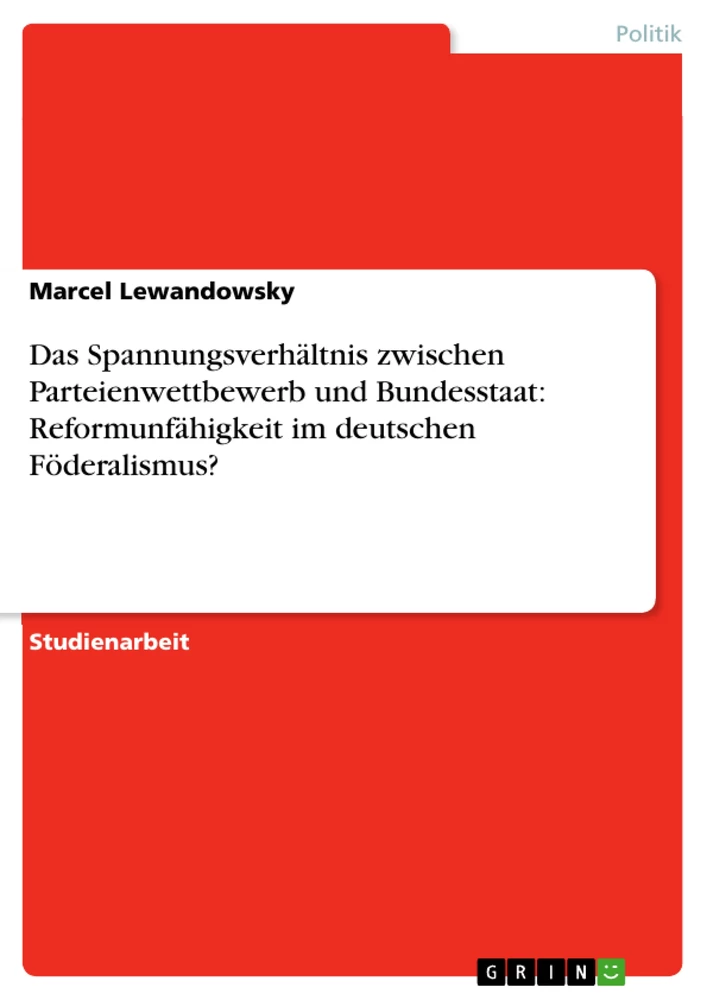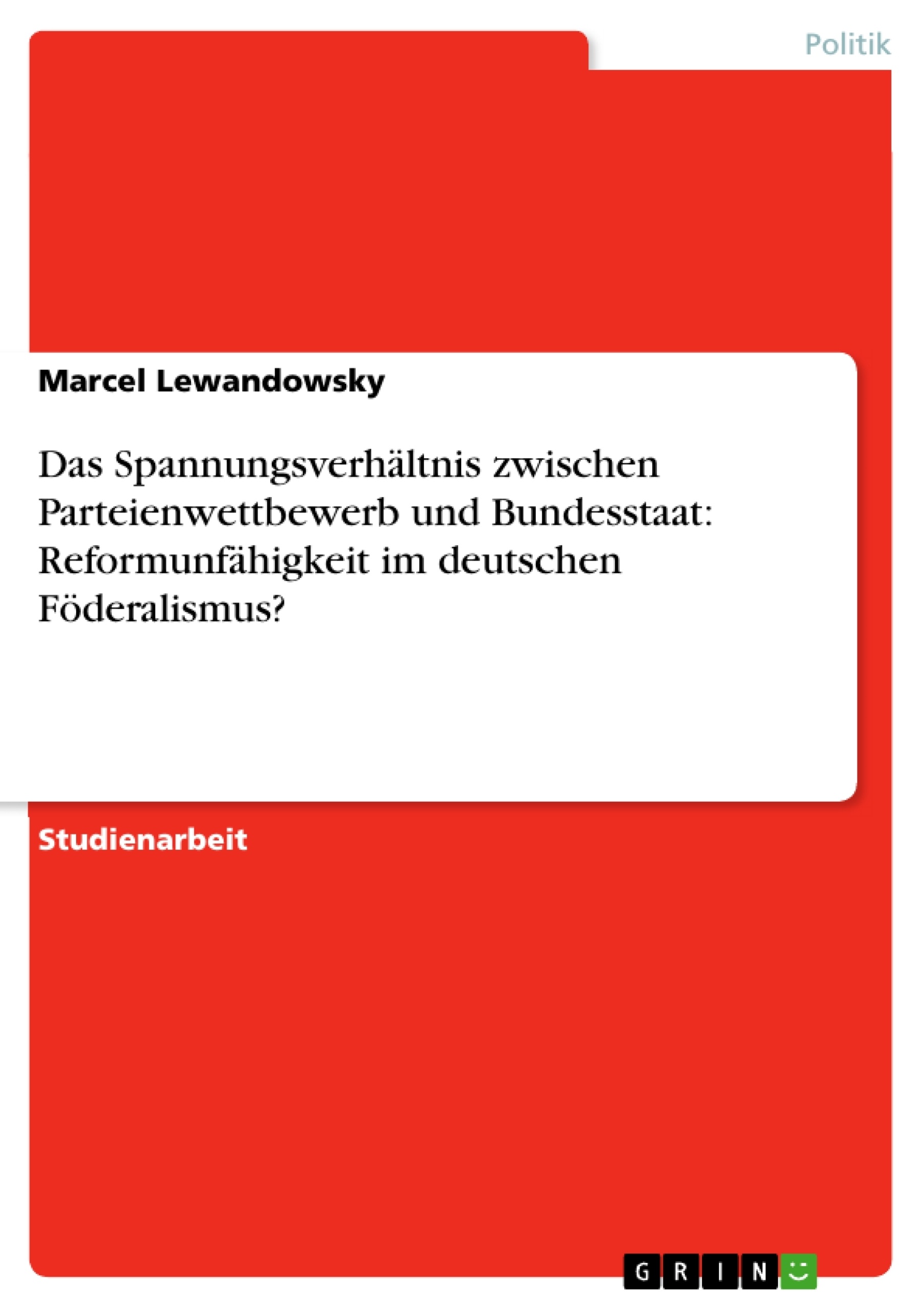Die Verflechtung verschiedener politischer Ebenen im deutschen Föderalismus – und damit die ihm nachgesagte Reformunfähigkeit – erfreuen sich in der politik- und rechtswissenschaftlichen Debatte großer Resonanz; die Literatur ist inzwischen nahezu unüberschaubar. Nicht zuletzt die Parteien werden für die „Reformblockade“ verantwortlich gemacht. Es mehrt sich daher die Skepsis gegenüber den politischen Interessenvertretern, die nach Meinung ihrer Kritiker den im Grunde gerade nicht von parteipolitischem Konkurrenzdenken her gedachten deutschen Föderalismus zu untergraben drohen.
Explizit soll es in dieser Arbeit daher nicht um die Frage gehen, ob die föderalen Strukturen selbst "unreformierbar" sind. Vielmehr steht die Analyse politischer Reformen, die innerhalb des gegebenen Systems unter den Interessenlagen der parteipolitischen Akteure durchgeführt werden, im Mittelpunkt. Die Kernfrage lautet, ob solche Vorhaben tatsächlich am strukturellen Konkurrenzverhältnis von Parteienwettbewerb und Bundesstaat scheitern.
Mit der Einschränkung der Fragestellung auf die Gesetzgebung geht indirekt eine weitere Zuspitzung einher. Zwar ist der Parteienwettbewerb grundsätzlich charakteristisch für den deutschen Föderalismus. Seine Bedeutung, insbesondere im legislativen Prozess, schwankt aber mit der Stellung der Opposition in der zweiten Kammer. Verfügen die die Regierung tragenden Parteien im Bundestag auch in der Länderkammer über die notwendige Mehrheit, so ist das kompetitive Element damit nicht neutralisiert, nimmt aber bezüglich der Substanz der Gesetzesvorhaben eine untergeordnete Rolle ein, weil der Einfluss der Oppositionsparteien sich an ihrer Stärke im Bundesrat misst. Die Untersuchungen werden sich deshalb auf die Analyse gegensätzlicher Mehrheiten zwischen Bundestag und Bundesrat beschränken.
Am Beispiel der Arbeitsmarktreformen in den Jahren 2002 und 2003 werden die institutionellen Verwerfungen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Akteure in der Praxis beleuchtet. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die Taktik der Opposition - zwischen Mitgestaltung und Blockade - sowie die Strategie der Regierung gelegt, die durch die faktische Auslagerung des Agenda-Settings in die "Hartz-Kommission" und die faktische Schaffung vollendeter Tatsachen versuchte, die Oppositionsrolle des Bundesrates durch öffentlichen Druck zu schwächen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Typologie des deutschen Föderalismus: Konkurrenzdemokratie versus Verhandlungsdemokratie
- Merkmale der Konkurrenzdemokratie
- Merkmale der Verhandlungsdemokratie
- „Verwerfungen“ zwischen den Teilsystemen
- Die Stellung des Bundesrates und die Rolle der Parteien
- Die Beteiligung des Bundesrates an der Gesetzgebung
- Die Rolle der Parteien
- Blockade als Oppositionsstrategie
- Handlungsweisen parteipolitischer Akteure im Bundesrat
- Die Rolle der Bundesstaatlichkeit innerhalb der Parteien
- Der Prozess der „Hartz“-Gesetzgebung
- Die Hartz-Kommission als Beispiel für modernes Agenda-Setting
- Die Taktik der Opposition: Zwischen Mitgestaltung und Blockade
- Reformunfähigkeit im deutschen Föderalismus? (Schlussbetrachtung)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen Parteienwettbewerb und Bundesstaat im deutschen Föderalismus. Sie befasst sich mit der Frage, ob dieses strukturelle Konkurrenzverhältnis zu Reformunfähigkeit im deutschen Föderalismus führt.
- Typologisierung des deutschen Föderalismus als Konkurrenz- oder Verhandlungsdemokratie
- Analyse der Rolle des Bundesrates und der Parteien in der Gesetzgebung
- Untersuchung der Rolle der Blockade als Oppositionsstrategie
- Bewertung des Einflusses von Parteiinteressen auf die Bundesstaatlichkeit
- Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf den Prozess der Arbeitsmarktreformen 2004
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Typologie des deutschen Föderalismus und stellt die beiden Konzepte der Konkurrenzdemokratie und Verhandlungsdemokratie gegenüber. Es werden die Merkmale beider Systeme und die „Verwerfungen“ zwischen ihnen untersucht.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Stellung des Bundesrates und der Rolle der Parteien in seinen Strukturen. Hier werden die typischen Handlungsmuster der Akteure, die Frage nach der Bundesstaatlichkeit innerhalb der Parteien und die Bedeutung der „Blockade“ als taktischer Option der Opposition untersucht.
Das dritte Kapitel untersucht den Prozess der „Hartz“-Gesetzgebung als Beispiel für modernes Agenda-Setting. Es analysiert die Taktik der Opposition im Kontext dieser Reformen und betrachtet die Debatte innerhalb der SPD.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen wie Bundesstaat, Parteienwettbewerb, Konkurrenzdemokratie, Verhandlungsdemokratie, Bundesrat, Gesetzgebung, Agenda-Setting, Reformunfähigkeit, Blockade und Arbeitsmarktreformen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt der deutsche Föderalismus als reformunfähig?
Die starke Verflechtung zwischen Bund und Ländern führt oft zu Blockaden, wenn unterschiedliche politische Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat aufeinandertreffen.
Welche Rolle spielt der Parteienwettbewerb im Bundesrat?
Der Bundesrat wird oft als Arena für parteipolitische Auseinandersetzungen genutzt, wobei die Opposition im Bund ihre Macht in den Ländern zur Blockade von Regierungsentwürfen einsetzen kann.
Was war das Besondere am Prozess der "Hartz"-Gesetzgebung?
Die Regierung versuchte, durch die Auslagerung der Planung in die "Hartz-Kommission" öffentlichen Druck aufzubauen, um die Blockademacht des Bundesrates zu schwächen.
Was unterscheidet Konkurrenzdemokratie von Verhandlungsdemokratie?
Konkurrenzdemokratie setzt auf den Wettbewerb um Mehrheiten, während Verhandlungsdemokratie auf Konsens und Kompromiss zwischen verschiedenen Ebenen und Parteien angewiesen ist.
Was versteht man unter "Blockade als Oppositionsstrategie"?
Die gezielte Ablehnung von Gesetzen im Bundesrat durch die Opposition, um die Regierungsarbeit zu erschweren und sich für kommende Wahlen zu profilieren.
- Arbeit zitieren
- Marcel Lewandowsky (Autor:in), 2005, Das Spannungsverhältnis zwischen Parteienwettbewerb und Bundesstaat: Reformunfähigkeit im deutschen Föderalismus?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63783