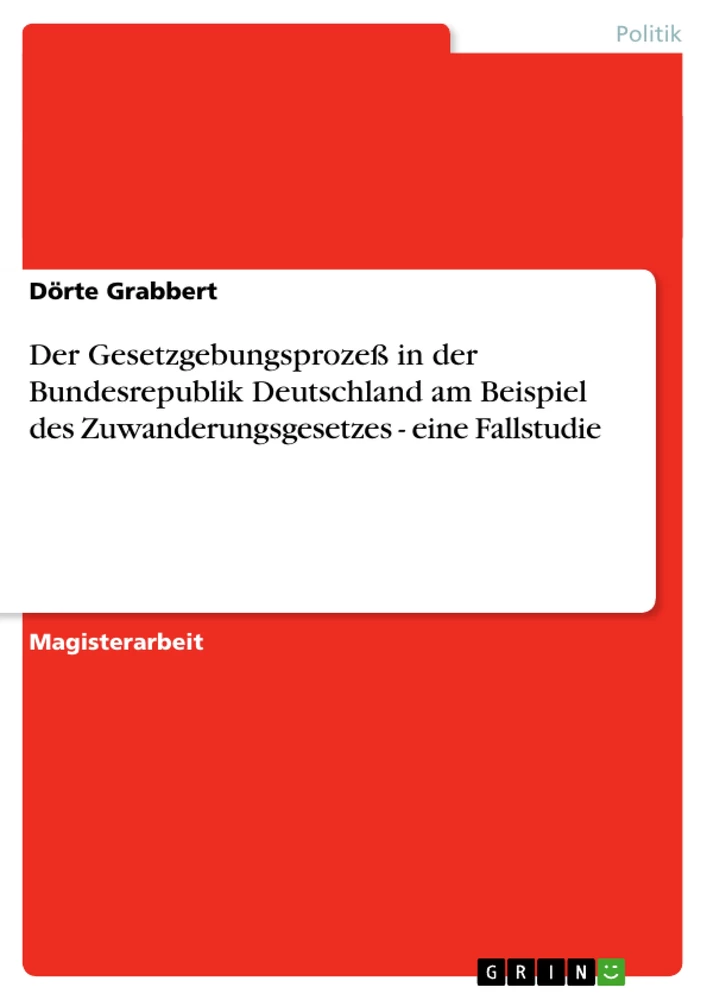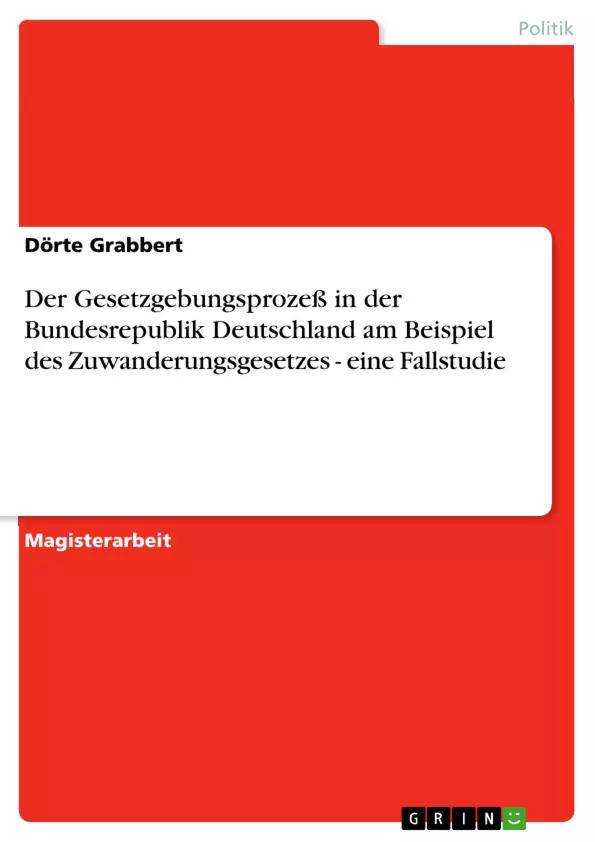Vor rund einem Jahr am 1. Januar 2005 trat das neue Zuwanderungsgesetz in Kraft. Die Verhandlungen dauerten über drei Jahre. Das erste Mal auf die Tagesordnung wurde es 1997 durch einen Antrag der SPD-Oppositionsfraktion im Bundestag gesetzt. Es sollte aber noch zwei Jahre dauern, bis das Thema ganz oben auf der politischen Tagesordnung stand. Mit dem Regierungsantritt der rot-grünen Koalition nach den Bundestagswahlen von 1998 trat ein Wandel in der Ausländerpolitik ein. Den ersten Schritt machte die neue Regierung mit einer Reform des Staatsbürgerschaftsrechtes. Das neue Gesetz, welches nun auch das ius soli-Prinzip verankerte, trat am 1. Januar 2000 in Kraft.
Den Stein des Anstoßes für die Debatte um ein Zuwanderungsgesetz gab der damalige Bundeskanzler selber. Gerhard Schröder kündigte zur Eröffnung der Computerfachmesse CeBIT im Februar 2000 eine Green-Card-Regelung für 20.000 ausländische Computerspezialisten an. Diese auf fünf Jahre befristete Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für Experten aus der Informations- und Kommunikationstechnologie aus den Nicht-EU-Staaten trat durch Verordnungen im August desselben Jahres in Kraft. Die Ausmaße für den deutschen Hochtechnologiesektor waren nur gering, da statt erhoffter 20.000 nur 10.000 Green-Cards in Anspruch genommen wurden. Dennoch war etwas viel wichtigeres geschehen: eine neue Debatte um ein Zuwanderungsgesetz wurde angestoßen. Das Thema hatte sofort eine breite gesellschaftliche und politische Basis. Am 4. Juli 2001 legte die unabhängige Kommission “Zuwanderung” den Abschlussbericht mit Vorschlägen für ein neues Zuwanderungsgesetz vor. Auf Grundlage des Berichtes jedoch mit starken Modifikationen legte die Regierung am dritten August 2001 ihren Entwurf für ein Zuwanderungsgesetz vor.
Gab es am Anfang der Debatte verhältnismäßig wenig Kontroversen hinsichtlich des Entwurfes zwischen CDU/CSU und der Regierungskoalition, so verhärtete sich der Ton nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York. Die Union brachte vermehrt Forderungen nach verschärften Sicherheitsbedingungen und Abwehrmechanismen im Zuwanderungsgesetz in die öffentliche Debatte. Am 1. März 2002 wird das Zuwanderungsgesetz im Bundestag mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die GRÜNEN verabschiedet. Die Zustimmung des Bundesrates wurde dem Gesetz am 22. März in einem umstrittenen Abstimmungsverfahren erteilt.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 1. Fragestellung und Erkenntnisinteresse
- 2. aktueller Forschungsstand
- 3. Methodenwahl und Vorgehensweise
- II begrifflich-theoretische Grundlegung
- 1. Rolle des Gesetzes im modernen Rechtsstaat
- 1.1.Entwicklung des modernen Rechtsstaates
- 1.2. Was ist ein Gesetz (Verhältnis von Gesetz und untergesetzlichen Rechtsnormen)
- 1.3.Funktion von Gesetzen (Wann bedarf es eines Gesetzes)
- 2. Die Gesetzgebung
- 2.1.Definition von Gesetzgebung
- 2.2.Akteure in der Gesetzgebung
- 3. theoretische Grundlagen für die Analyse von Gesetzgebungsprozessen - Politische Steuerung
- 3.1.Systemtheorie
- 3.2.Akteurstheorien
- 3.3.Theoriesynthese
- 3.4.Vetospieler-Ansatz
- 4. Methoden der Analyse von Entscheidungsstrukturen
- 4.1.Netzwerkanalyse
- 4.2.Policy-Analyse
- III Die Besonderheiten der Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland
- IV Zuwanderung
- 1. Anfänge und Entwicklung
- 1.1. Wanderungsbewegungen vor 1945
- 1.2. Zu- und Abwanderung nach 1945
- 2. Gesetzliche Regelungen der Zuwanderung vor dem neuen Zuwanderungsgesetz
- V Gesetzgebungsprozeß zum Zuwanderungsgesetz
- 1. Die Akteure
- 2. Das Verfahren
- 3. Fazit: Ein typisches Gesetzgebungsverfahren?
- VI Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert den Gesetzgebungsprozess in der Bundesrepublik Deutschland anhand des Beispiels des Zuwanderungsgesetzes. Ziel ist es, den Prozess detailliert zu beschreiben und die beteiligten Akteure sowie deren Strategien zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Interaktionen zwischen Regierung, Parlament, Bundesrat und anderen Akteuren.
- Der Gesetzgebungsprozess im deutschen System
- Die Rolle verschiedener Akteure (Parteien, Bundesrat, Verwaltung etc.)
- Der Einfluss von Politiknetzwerken auf den Gesetzgebungsprozess
- Analyse des Zuwanderungsgesetzes als Fallstudie
- Methoden der Analyse von Entscheidungsstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Gesetzgebungsprozess am Beispiel des Zuwanderungsgesetzes vor. Sie skizziert den aktuellen Forschungsstand und beschreibt die gewählte Methodik der Arbeit.
II begrifflich-theoretische Grundlegung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Gesetzgebungsprozesses. Es definiert den Begriff des Gesetzes im modernen Rechtsstaat, beschreibt die Akteure der Gesetzgebung und diskutiert verschiedene theoretische Ansätze wie Systemtheorie, Akteurstheorien und den Vetospieler-Ansatz. Es werden auch Methoden zur Analyse von Entscheidungsstrukturen, wie Netzwerkanalyse und Policy-Analyse, vorgestellt.
III Die Besonderheiten der Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Charakteristika des deutschen Gesetzgebungssystems, einschließlich der Gesetzgebungskompetenz, der Rolle der Parteien und Fraktionen, des Bundesrates als Vetospieler, des Vermittlungsausschusses, der Einflussnahme der Opposition, des Zusammenspiels von Politik und Verwaltung und der Rolle des Bundesverfassungsgerichts.
IV Zuwanderung: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Zuwanderung nach Deutschland, von den Wanderungsbewegungen vor 1945 bis hin zu den gesetzlichen Regelungen vor dem neuen Zuwanderungsgesetz. Es behandelt verschiedene Phasen der Zuwanderung, wie den "Import" von Arbeitskräften, die Ankunft von Spätaussiedlern und Flüchtlingen, und beleuchtet die jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen.
V Gesetzgebungsprozeß zum Zuwanderungsgesetz: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es beschreibt detailliert den Gesetzgebungsprozess des Zuwanderungsgesetzes, indem es die beteiligten Akteure (Parteien, Regierung, Bundesrat, Verbände etc.) und das Verfahren selbst analysiert. Es werden die verschiedenen Phasen des Prozesses, von der Vorparlamentarischen Phase bis zum Kontrollstadium, erläutert und bewertet.
Schlüsselwörter
Gesetzgebungsprozess, Bundesrepublik Deutschland, Zuwanderungsgesetz, Akteure, Parteien, Bundesrat, Vetospieler, Politiknetzwerke, Policy-Analyse, Netzwerkanalyse, Rechtsstaat, Systemtheorie, Akteurstheorien.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Gesetzgebungsprozess am Beispiel des Zuwanderungsgesetzes
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert den Gesetzgebungsprozess in der Bundesrepublik Deutschland anhand des Beispiels des Zuwanderungsgesetzes. Ziel ist die detaillierte Beschreibung des Prozesses, die Untersuchung der beteiligten Akteure und deren Strategien sowie die Beleuchtung der komplexen Interaktionen zwischen Regierung, Parlament, Bundesrat und anderen Akteuren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: den Gesetzgebungsprozess im deutschen System, die Rolle verschiedener Akteure (Parteien, Bundesrat, Verwaltung etc.), den Einfluss von Politiknetzwerken auf den Gesetzgebungsprozess, eine Analyse des Zuwanderungsgesetzes als Fallstudie und Methoden der Analyse von Entscheidungsstrukturen (Netzwerkanalyse und Policy-Analyse).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: I Einleitung: Vorstellung der Forschungsfrage, des Forschungsstandes und der Methodik. II begrifflich-theoretische Grundlegung: Definition von Gesetz und Gesetzgebung, Vorstellung relevanter Theorien (Systemtheorie, Akteurstheorien, Vetospieler-Ansatz) und Methoden (Netzwerkanalyse, Policy-Analyse). III Die Besonderheiten der Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland: Beschreibung des deutschen Gesetzgebungssystems mit seinen Akteuren und Besonderheiten. IV Zuwanderung: Historischer Überblick über die Zuwanderung nach Deutschland und die gesetzlichen Regelungen vor dem neuen Zuwanderungsgesetz. V Gesetzgebungsprozeß zum Zuwanderungsgesetz: Detaillierte Analyse des Gesetzgebungsprozesses zum Zuwanderungsgesetz, einschließlich der beteiligten Akteure und des Verfahrens. VI Schlussbetrachtungen: Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Akteure werden im Gesetzgebungsprozess betrachtet?
Die Arbeit betrachtet eine Vielzahl von Akteuren, darunter Regierung, Parlament, Bundesrat, Parteien, Fraktionen, Verbände und Verwaltung. Der Einfluss und die Strategien dieser Akteure im Gesetzgebungsprozess werden untersucht.
Welche Methoden werden zur Analyse des Gesetzgebungsprozesses verwendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene Methoden, darunter die Netzwerkanalyse und die Policy-Analyse, um die Entscheidungsstrukturen und den Einfluss der verschiedenen Akteure zu untersuchen. Theoretische Ansätze wie Systemtheorie, Akteurstheorien und der Vetospieler-Ansatz bilden die theoretische Grundlage der Analyse.
Welche Rolle spielt das Zuwanderungsgesetz in der Arbeit?
Das Zuwanderungsgesetz dient als Fallstudie, um den deutschen Gesetzgebungsprozess anhand eines konkreten Beispiels zu analysieren und zu illustrieren. Der Prozess wird von der Vorparlamentarischen Phase bis zum Kontrollstadium detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesetzgebungsprozess, Bundesrepublik Deutschland, Zuwanderungsgesetz, Akteure, Parteien, Bundesrat, Vetospieler, Politiknetzwerke, Policy-Analyse, Netzwerkanalyse, Rechtsstaat, Systemtheorie, Akteurstheorien.
- Citar trabajo
- Dörte Grabbert (Autor), 2006, Der Gesetzgebungsprozeß in der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel des Zuwanderungsgesetzes - eine Fallstudie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63832