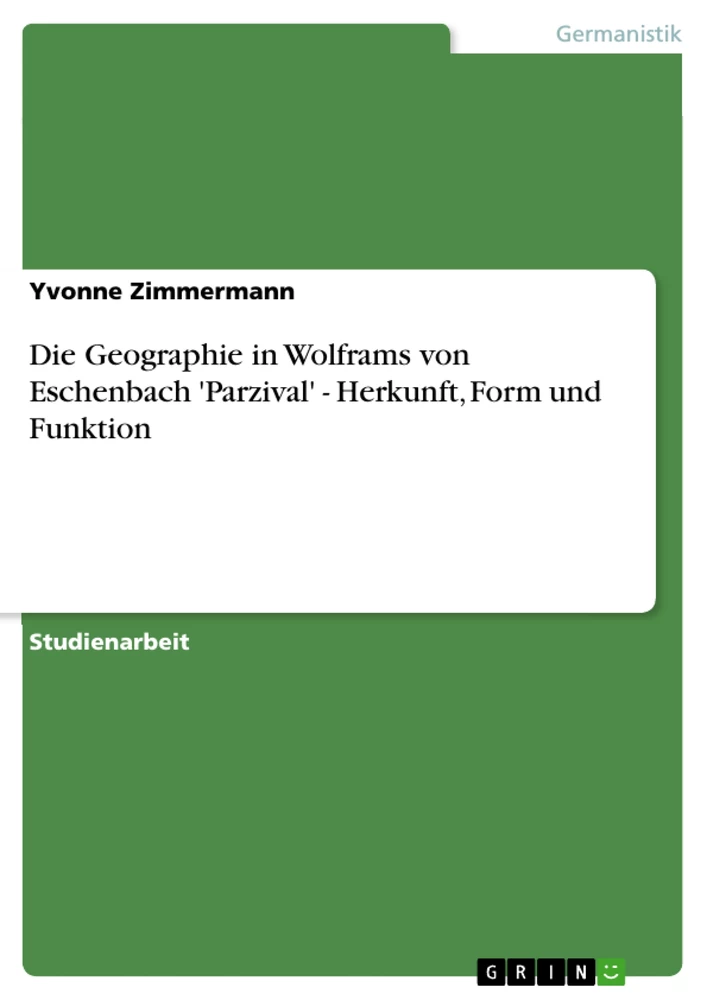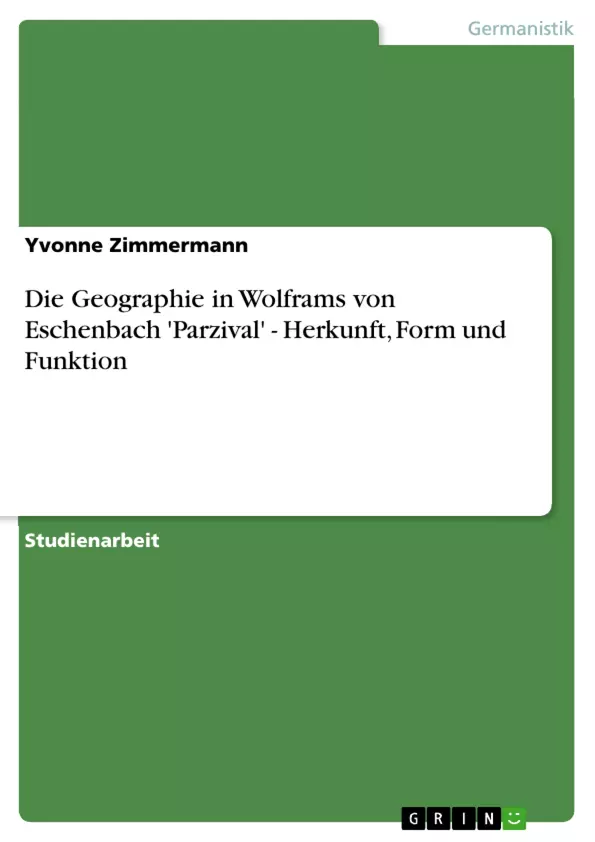Der Parzivalroman Wolframs von Eschenbach ist die Geschichte der Entwicklung des Menschen zu einer idealisierten Form seiner selbst.
Er ist aber ebenso eine Geschichte von Raum und Zeit. Jede der Hauptpersonen - ob Gahmuret, Gawan oder Parzival selbst - ist in Bewegung; nur durch ihre Reisen treffen sie auf Liebe und Gefahren, auf Personen, die für ihre Entwicklung notwendig sind. Wolfram von Eschenbach zeigt vor allem an der Figur des Parzival, wie die Wanderung auf dem Lebensweg vom Naturzustand in die Zivilisation und schließlich zum Heil/ zur Erlösung führt. Eine nähere Betrachtung der Geographie im Roman ist also unabdingbar. Zunächst werde ich mich mit der Quellenlage beschäftigen und versuchen aufzuschlüsseln, woher Wolfram von Eschenbach seine geographischen Fakten und Termini nahm. Danach werde ich mich mit verschiedenen Schwerpunkten der Parzival-Bücher befassen. Zum einen ist hier die reale europäische Geographie zu nennen, die der Dichter dem Orient gegenüberstellt. Mein Hauptaugenmerk gilt dabei den Namen als Herkunftsbezeichnungen und der Landschaft im Hintergrund. Die von Panzer und Snelleman propagierte Löwenherzthese wird in einem gesonderten Punkt behandelt.
Der zweite Abschnitt befasst sich mit der wundersamen Geographie, welche sowohl Soltane, als auch Munsalwäsche und Schastel marveille enthält. Diesen Punkt konnte aufgrund seiner bibliographisch immensen Dimensionen nicht besonders ausführlich behandelt werden. Dennoch habe ich versucht, die neuste Forschung von Michael Horchler einzuarbeiten. Mein letzter Abschnitt schließlich widmet sich dem Orient. Aus dem Blickwinkel des europäischen Mittelalters versuche ich mit der Ausformung, die der Orient bei Wolfram annimmt, seine Funktion zu ergründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage
- Lateinische Quellen
- Bischof Otto von Freising
- Willhelm von Tyrus
- C. Julius Solinus
- Altfranzösische Quellen
- Chretien de Troyes
- Die Anjou - Chronik
- Zeitgenössische Autoren – Hartmann von Aue
- Kyot
- Lateinische Quellen
- Reale Geographie
- Herkunftsbezeichnungen
- Helden und Edelfrauen
- Gegenstände und Tiere
- Die Landschaft im Hintergrund
- Die Blutstropfen im Schnee
- Gawan und Orgeluse
- Herkunftsbezeichnungen
- Gahmuret von Anschewîn
- Löwenherzthese
- Gegenthese
- Wundersame Geographie
- Soltane das verlorene Paradies
- Die Reise ins Wunderbare
- Gawan von Norgal und Schastel marveille
- Parzival und Munsalwäsche
- Der Orient
- Der Orient aus dem Blickwinkel des europäischen Mittelalters
- Der Orient bei Wolfram von Eschenbach
- Formulierung einer Verschmelzung von Orient und Okzident unter dem Banner einer Anti - Ritterschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der geographischen Dimension des Parzivalromans Wolframs von Eschenbach. Sie untersucht, wie die geographischen Elemente im Roman die Entwicklung des Protagonisten Parzival, sowie die anderen wichtigen Figuren wie Gahmuret und Gawan, beeinflussen. Darüber hinaus analysiert sie die Funktion der geographischen Szenerien als Spiegelbild der mittelalterlichen Weltanschauung und der Beziehung zwischen Orient und Okzident.
- Analyse der geographischen Quellen des Parzivalromans
- Bedeutung der realen Geographie in der Darstellung von Herkunftsbezeichnungen und Landschaft
- Untersuchung der "wundersamen Geographie" und ihrer Rolle im Kontext der Romanhandlung
- Analyse der Darstellung des Orients in Wolframs Werk und seine Funktion als Gegenwelt zum europäischen Mittelalter
- Zusammenhänge zwischen geographischen Elementen und der Entwicklung der Hauptfiguren
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand, die geographische Dimension des Parzivalromans, vor und umreißt die zentrale These der Arbeit. Sie befasst sich mit der Bedeutung der Reisemotive und der geographischen Elemente für die Charakterentwicklung der Figuren und die Erzählstruktur des Romans.
- Quellenlage: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Quellen, die Wolfram von Eschenbach für seine Darstellung der Geographie im Parzivalroman genutzt hat. Es untersucht lateinische Quellen wie die "Chronica" Ottos von Freising oder die "Historia rerum in partibus transmarinis gestarum" Wilhelms von Tyrus, sowie altfranzösische Quellen wie Chretien de Troyes' "Perceval".
- Reale Geographie: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der realen Geographie des Parzivalromans. Es betrachtet die Rolle der Herkunftsbezeichnungen, die geografischen Merkmale der Landschaft und die Beziehung zwischen Europa und dem Orient im Werk Wolframs. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Orten wie Babylon und Bagdad, sowie auf der Bedeutung der geographischen Szenerien für die Handlung des Romans.
- Gahmuret von Anschewîn: Dieses Kapitel analysiert die Figur des Gahmurets, dem Vater des Parzival. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Auseinandersetzung mit der "Löwenherzthese" und der "Gegenthese", die sich mit der Frage der Herkunft des Gahmurets und seiner Rolle in der Geschichte des Parzival beschäftigen.
- Wundersame Geographie: Dieses Kapitel untersucht die "wundersame Geographie" des Parzivalromans, welche Orte wie Soltane, Munsalwäsche und Schastel marveille umfasst. Es befasst sich mit den Funktionen dieser Orte in der Handlung des Romans, den Beziehungen zwischen den Figuren und den magischen Elementen, die mit diesen Orten verbunden sind.
- Der Orient: Das Kapitel befasst sich mit der Darstellung des Orients im Parzivalroman. Es analysiert den Orient aus der Perspektive des europäischen Mittelalters, die Rolle des Orients als Gegenwelt zum europäischen Mittelalter und die Verschmelzung von Orient und Okzident in Wolframs Werk.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe, die in der vorliegenden Arbeit behandelt werden, sind die Geographie, der Orient, die Ritterkultur, die Charakterentwicklung, die Reisemotive, die Quellenforschung, die mittelalterliche Weltanschauung, die "wundersame Geographie" und die Beziehungen zwischen den Figuren.
- Quote paper
- Yvonne Zimmermann (Author), 2004, Die Geographie in Wolframs von Eschenbach 'Parzival' - Herkunft, Form und Funktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63882