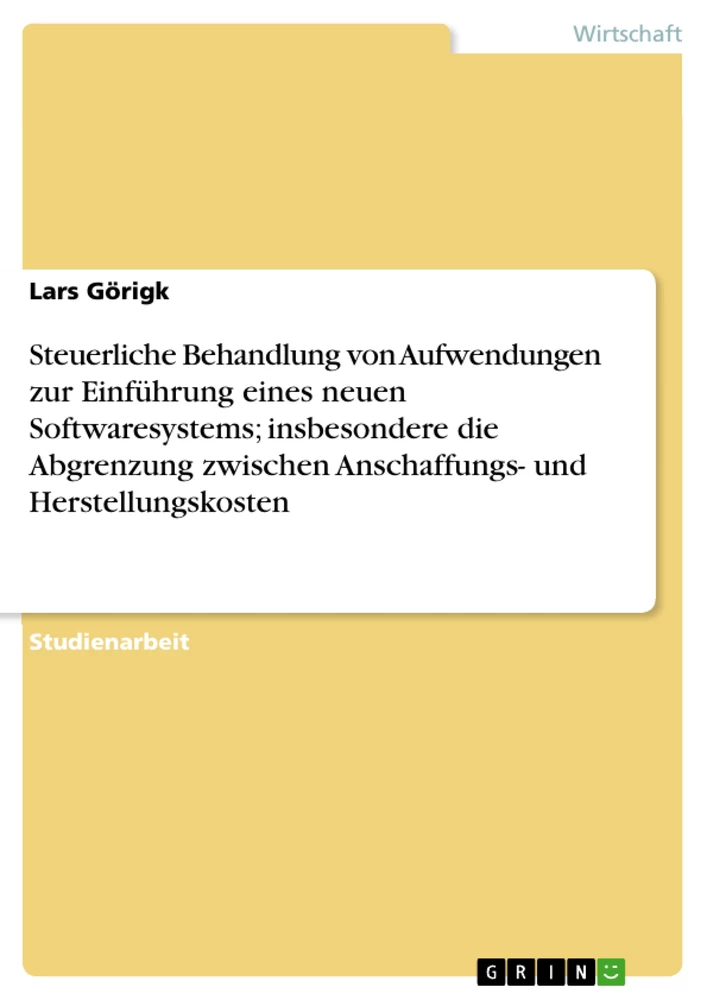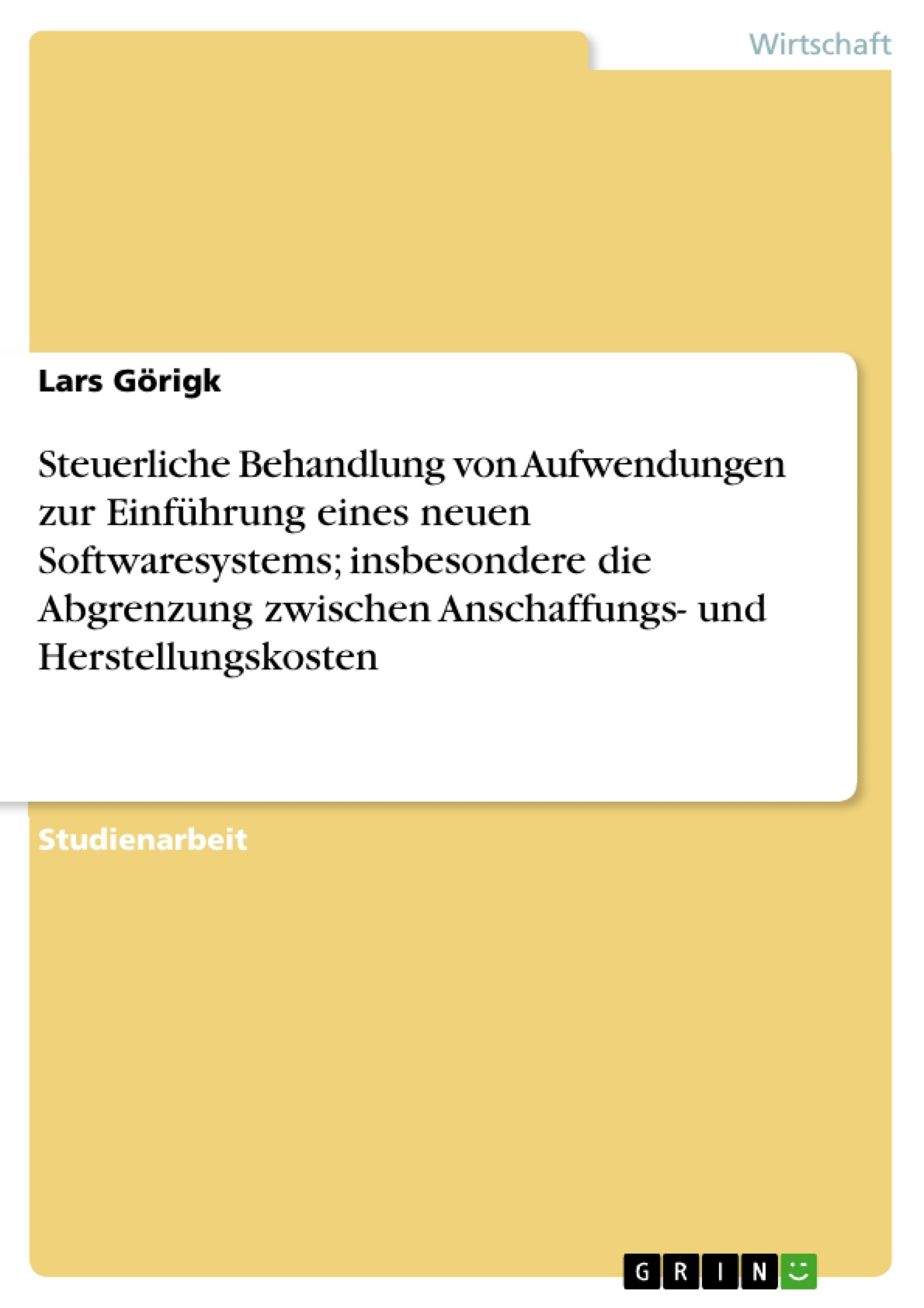Bei der Einführung eines neuen Softwaresystems in Betrieben stellt sich die Frage, wie die Aufwendungen für diese Systeme steuerlich zu behandeln sind. Die Investitionskosten von EDV-Großprojekten belaufen sich vielfach auf zweistellige Millionenbeträge. Wobei die Aufwendungen für die Implementierung, Planung, Beratung und Schulung oftmals den Kaufpreis der Softwarelizenz erheblich übersteigen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Einleitung
- Themenabgrenzung
- Begriff Software-System
- Aufwendungen für Software-Systeme
- Lizenzentgelt
- Vorkosten/Vorplanungskosten
- Planungskosten
- Implementierungskosten
- Customizing
- Modification
- Extension
- Schulungskosten
- Nachträglich entstehende Aufwendungen
- Bilanzsteuerliche Behandlung dieser Aufwendungen
- Handelsbilanzielle Grundsätze
- Steuerbilanzielle Grundsätze
- Software als immaterielles Wirtschaftsgut
- Entgeltlicher Erwerb immaterieller Wirtschaftsgüter
- ERP-Software als Anlagevermögen
- Bewertung der ERP-Software
- Handelsrechtliche Bewertung
- Einzelbewertung von Vermögensgegenständen
- Wertansatz
- Steuerrechtliche Bewertung
- Handelsrechtliche Bewertung
- Anschaffungs-/Herstellungskosten
- Anschaffungskosten
- Herstellungskosten
- Nachträglich Anschaffungs- oder Herstellungskosten
- Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand
- Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
- Vertragliche Vereinbarungen
- Überlassung von Software
- Anpassung von Software
- Vertragsauslegung
- Erweiterung oder wesentliche Verbesserung
- Entstehung eines neuen Vermögensgegenstands
- Beispiel zum Vergleich
- Vertragliche Vereinbarungen
- Quellcode
- Aktivierungspflicht
- Lizenzentgelt
- Vorkosten/Vorplanungskosten
- Planungskosten
- Implementierungskosten
- Schulungskosten
- Schulung der Anwender
- Schulung des Personals für Implementierungsarbeiten
- Nachträglich entstandene Aufwendungen
- Erweiterung durch nachträglich angeschaffte Module
- Wartungskosten
- Abschreibung
- Beginn der Abschreibung
- Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
- Differenzierung der Software
- Zeitliche Entwicklungsabstände von Produkten
- Ansicht vieler Betriebe
- Ansicht der Finanzverwaltung
- Zu berücksichtigende betriebsgewöhnlich Nutzungsdauer
- Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen
- Ermittlung der Abschreibungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die steuerliche Behandlung von Aufwendungen bei der Einführung neuer Softwaresysteme, insbesondere die Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Bilanzsteuerrecht. Der Fokus liegt auf der Klärung der rechtlichen Grundlagen und der praktischen Anwendung im Kontext von ERP-Software.
- Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Software
- Steuerliche Behandlung verschiedener Software-Aufwendungen (Lizenzgebühren, Implementierung, Schulung)
- Bewertung von Software im Anlagevermögen
- Aktivierungspflicht und Abschreibung von Software
- Relevanz des Quellcodes für die Kostenklassifizierung
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Diese Arbeit befasst sich mit der komplexen Thematik der steuerlichen Behandlung von Kosten, die bei der Einführung neuer Softwaresysteme anfallen. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, was für die korrekte bilanzielle und steuerliche Behandlung entscheidend ist.
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und grenzt den Umfang der Arbeit ab. Sie beschreibt den Fokus auf die steuerliche Behandlung von Softwarekosten und insbesondere auf die Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Aufwendungen für Software-Systeme: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten von Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Softwaresystems anfallen. Es werden Lizenzkosten, Implementierungskosten (Customizing, Modification, Extension), Schulungskosten und nachträglich anfallende Kosten detailliert behandelt und voneinander abgegrenzt. Der Unterschiedliche Aufwand und die verschiedenen Steuerlichen Behandlungen werden erläutert.
Bilanzsteuerliche Behandlung dieser Aufwendungen: Hier werden die handelsbilanziellen und steuerbilanziellen Grundsätze zur Behandlung der Softwareaufwendungen erläutert. Es wird der Unterschied in der Behandlung zwischen Handels- und Steuerbilanz aufgezeigt, und die Bedeutung der Software als immaterielles Wirtschaftsgut wird hervorgehoben. Die Prinzipien des entgeltlichen Erwerbs und die Einordnung von ERP-Software als Anlagevermögen werden ebenfalls diskutiert.
Bewertung der ERP-Software: Dieses Kapitel widmet sich der Bewertung von ERP-Software sowohl nach handels- als auch steuerrechtlichen Vorschriften. Es wird die Einzelbewertung von Vermögensgegenständen und der Wertansatz im Detail betrachtet. Die Unterschiede in der Bewertungsmethode werden herausgearbeitet.
Anschaffungs-/Herstellungskosten: Der zentrale Teil behandelt die Abgrenzung von Anschaffungskosten und Herstellungskosten im Detail. Dabei werden auch nachträglich anfallende Kosten berücksichtigt, und die Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand wird genau definiert. Die Bedeutung für die korrekte steuerliche Behandlung wird betont.
Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten: Dieses Kapitel analysiert die Kriterien zur Unterscheidung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anhand von vertraglichen Vereinbarungen, Anpassungen und Erweiterungen der Software. Ein Vergleichsbeispiel veranschaulicht die praktische Anwendung der Abgrenzungskriterien.
Quellcode: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Quellcodes für die Einstufung als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Rolle des Quellcodes für die steuerliche Behandlung wird im Detail erläutert.
Aktivierungspflicht: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Aktivierungspflicht für verschiedene Arten von Softwareaufwendungen, inklusive Lizenzgebühren, Implementierungskosten, Schulungskosten und nachträglich entstandenen Aufwendungen. Die jeweiligen Bedingungen und Auswirkungen auf die Bilanz werden diskutiert.
Wartungskosten: Hier wird die Behandlung von Wartungskosten im Kontext der Anschaffungs- und Herstellungskosten erläutert und von anderen Kosten abgegrenzt.
Abschreibung: Das Kapitel behandelt die Abschreibung von Software, beginnend mit dem Beginn der Abschreibung und der Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Dabei wird auf die Differenzierung der Software, die zeitliche Entwicklung und verschiedene Ansichten von Betrieben und Finanzverwaltung eingegangen. Die Bemessungsgrundlage und die Ermittlung der Abschreibungen werden ebenfalls dargestellt.
Schlüsselwörter
Software, Anschaffungskosten, Herstellungskosten, ERP-Software, Bilanzsteuerrecht, Immaterielles Wirtschaftsgut, Aktivierungspflicht, Abschreibung, Steuerliche Behandlung, Implementierung, Customizing, Quellcode, Bewertung, Handelsbilanz, Steuerbilanz.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Steuerliche Behandlung von Softwarekosten
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die steuerliche Behandlung von Aufwendungen für die Einführung neuer Softwaresysteme, insbesondere die Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Bilanzsteuerrecht. Der Fokus liegt auf der Klärung der rechtlichen Grundlagen und der praktischen Anwendung im Kontext von ERP-Software.
Welche Arten von Softwareaufwendungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Arten von Aufwendungen, darunter Lizenzkosten, Implementierungskosten (Customizing, Modification, Extension), Schulungskosten und nachträglich anfallende Kosten. Es wird detailliert auf die Unterschiede im Aufwand und die verschiedenen steuerlichen Behandlungen eingegangen.
Wie werden die Softwareaufwendungen handelsbilanziell und steuerbilanziell behandelt?
Die Hausarbeit erläutert die handelsbilanziellen und steuerbilanziellen Grundsätze zur Behandlung der Softwareaufwendungen. Der Unterschied in der Behandlung zwischen Handels- und Steuerbilanz wird aufgezeigt, und die Bedeutung der Software als immaterielles Wirtschaftsgut wird hervorgehoben. Die Prinzipien des entgeltlichen Erwerbs und die Einordnung von ERP-Software als Anlagevermögen werden diskutiert.
Wie wird ERP-Software bewertet?
Die Bewertung von ERP-Software wird sowohl nach handels- als auch steuerrechtlichen Vorschriften behandelt. Die Einzelbewertung von Vermögensgegenständen und der Wertansatz werden detailliert betrachtet, und die Unterschiede in den Bewertungsmethoden werden herausgearbeitet.
Wie werden Anschaffungs- und Herstellungskosten abgegrenzt?
Ein zentraler Punkt ist die detaillierte Abgrenzung von Anschaffungskosten und Herstellungskosten. Nachträglich anfallende Kosten werden berücksichtigt, und die Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand wird genau definiert. Die Bedeutung für die korrekte steuerliche Behandlung wird betont. Die Abgrenzung wird anhand von vertraglichen Vereinbarungen, Anpassungen und Erweiterungen der Software analysiert. Ein Vergleichsbeispiel veranschaulicht die praktische Anwendung.
Welche Rolle spielt der Quellcode?
Die Bedeutung des Quellcodes für die Einstufung als Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird beleuchtet. Die Rolle des Quellcodes für die steuerliche Behandlung wird detailliert erläutert.
Welche Aufwendungen sind aktivierungspflichtig?
Die Aktivierungspflicht für verschiedene Arten von Softwareaufwendungen wird behandelt, inklusive Lizenzgebühren, Implementierungskosten, Schulungskosten und nachträglich entstandenen Aufwendungen. Die jeweiligen Bedingungen und Auswirkungen auf die Bilanz werden diskutiert.
Wie werden Wartungskosten behandelt?
Die Behandlung von Wartungskosten im Kontext der Anschaffungs- und Herstellungskosten wird erläutert und von anderen Kosten abgegrenzt.
Wie erfolgt die Abschreibung von Software?
Die Abschreibung von Software wird behandelt, beginnend mit dem Beginn der Abschreibung und der Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Differenzierung der Software, die zeitliche Entwicklung und verschiedene Ansichten von Betrieben und Finanzverwaltung werden berücksichtigt. Die Bemessungsgrundlage und die Ermittlung der Abschreibungen werden ebenfalls dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Thematik?
Relevante Schlüsselwörter sind: Software, Anschaffungskosten, Herstellungskosten, ERP-Software, Bilanzsteuerrecht, Immaterielles Wirtschaftsgut, Aktivierungspflicht, Abschreibung, Steuerliche Behandlung, Implementierung, Customizing, Quellcode, Bewertung, Handelsbilanz, Steuerbilanz.
- Quote paper
- Dipl. - Finanzwirt (FH) Lars Görigk (Author), 2006, Steuerliche Behandlung von Aufwendungen zur Einführung eines neuen Softwaresystems; insbesondere die Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63906