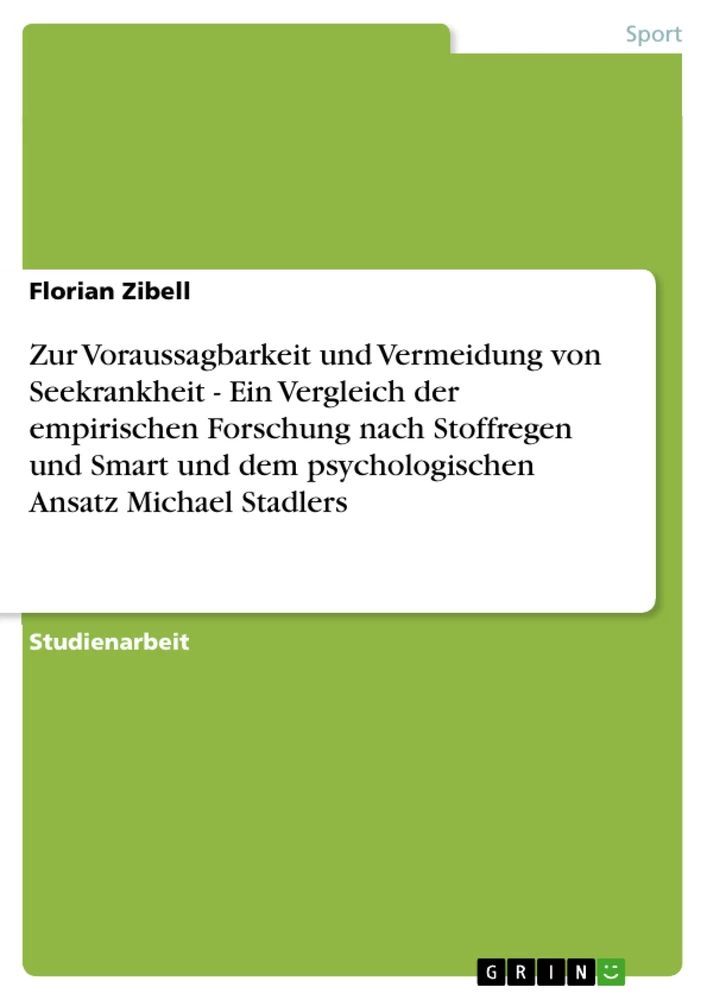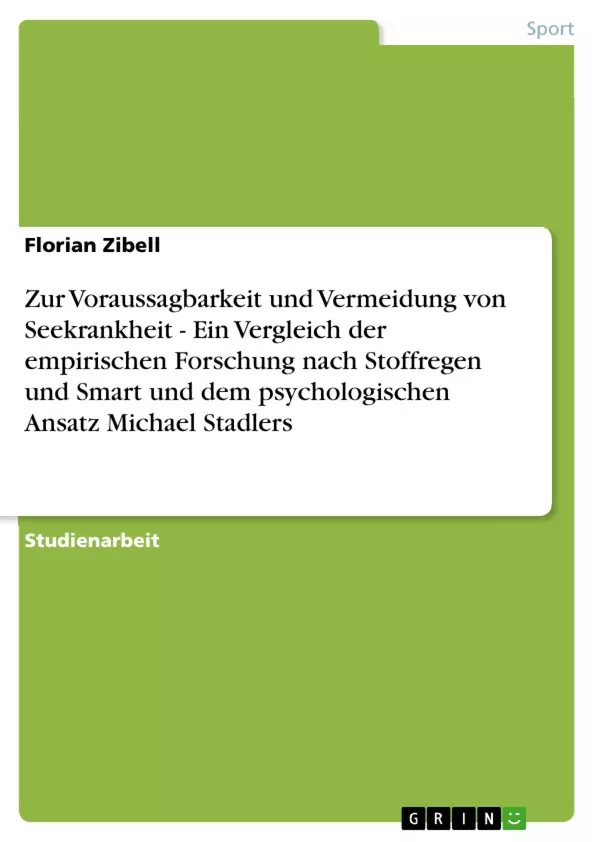In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit der Voraussagbarkeit von Seekrankheit, oder allgemeiner „motion sickness“ beschäftigen. Hierzu vergleiche ich die empirischen Untersuchungen von Stoffregen und Smart mit den psychologischen Ansätzen Michael Stadlers. Die Untersuchungen von Stoffregen und Smart beschäftigen sich eher allgemein mit dem Phänomen der „motion sickness“, das mit Seekrankheit nur ungenügend übersetzt ist.
Als „motion sickness“ werden alle Erscheinungen von „Bewegungskrankheit“ bezeichnet, die sowohl durch von Außen einwirkende Bewegungen (wie etwa das Schaukeln eines Schiffes oder die Fahrt in einem Auto), sowie Krankheitserscheinungen, die durch nur visuell initiierte Phänomene, wie etwa die „moving room“ Versuche (die im folgenden ausführlich erläutert werden), oder Erscheinungen die während der Benutzung von sogenannten „virtual environment systems“, also etwa Flug- oder Fahrtsimulatoren auftreten, ausgelöst werden. Michael Stadler hingegen beschäftigt sich in dem vorliegenden Auszug aus seinem Buch konkret mit dem Problem der Seekrankheit. Er zeigt wahrscheinliche Ursachen und Folgen auf, beleuchtet (wie auch Stoffregen und Smart) die allgemeinen wissenschaftlichen Hintergründe und macht Vorschläge zur Prävention und dem sinnvollen Umgang mit Seekrankheit vor und während eines Segeltörns. Stadlers Vorschläge und Betrachtungen beziehen sich (abgesehen von den erwähnten physikalisch, wissenschaftlichen Grundlagen) im Gegensatz zu Stoffregen und Smart, die rein empirisch und mit messbaren Ergebnissen arbeiten, nur auf psychologisches Basiswissen und die aus diesem Wissen entspringenden Implikationen. Ich will die Beiden Ansätze im Folgenden also vorstellen, vergleichend gegenüberstellen und mögliche Folgerungen vorstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ansatz von Stoffregen und Smart
- Michael Stadlers „Psychische Bedingungen der Seekrankheit“
- Vergleich/Gegenüberstellung und Kommentar
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Voraussagbarkeit von Seekrankheit, auch bekannt als "motion sickness", durch den Vergleich empirischer Studien von Stoffregen und Smart mit den psychologischen Ansätzen Michael Stadlers. Der Schwerpunkt liegt auf der Erforschung der Ursachen und Folgen von Seekrankheit, der Darstellung verschiedener wissenschaftlicher Modelle und der Ableitung von Präventionsstrategien.
- Empirische Forschung zur "motion sickness" anhand des Ansatzes von Stoffregen und Smart
- Psychologische Betrachtung der Seekrankheit nach Michael Stadler
- Vergleich der beiden Ansätze hinsichtlich ihrer methodischen Herangehensweise und ihrer Erkenntnisse
- Analyse der "sensory conflict theory" und des "sensorimotor rearrangements" als relevante Theorien zur Erklärung von Seekrankheit
- Bedeutung von "optical flow" und "postural sway" für die Entwicklung von Seekrankheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema "motion sickness" und den Vergleich der Ansätze von Stoffregen & Smart und Michael Stadler vor. Sie erläutert die verschiedenen Formen von "motion sickness" und die Relevanz der Forschung.
- Der Ansatz von Stoffregen und Smart: Die Arbeit stellt die Hypothese von Stoffregen und Smart zur Voraussagbarkeit von "motion sickness" vor und erläutert die "sensory conflict theory" als theoretische Grundlage. Sie beschreibt die Forschungsmethodik und die relevanten Fachbegriffe.
Schlüsselwörter
Seekrankheit, "motion sickness", "sensory conflict theory", "postural sway", "postural instability", "optical flow", "moving room", empirische Forschung, psychologische Ansätze, Prävention, Vergleich, wissenschaftliche Grundlagen.
- Arbeit zitieren
- Florian Zibell (Autor:in), 2002, Zur Voraussagbarkeit und Vermeidung von Seekrankheit - Ein Vergleich der empirischen Forschung nach Stoffregen und Smart und dem psychologischen Ansatz Michael Stadlers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63984