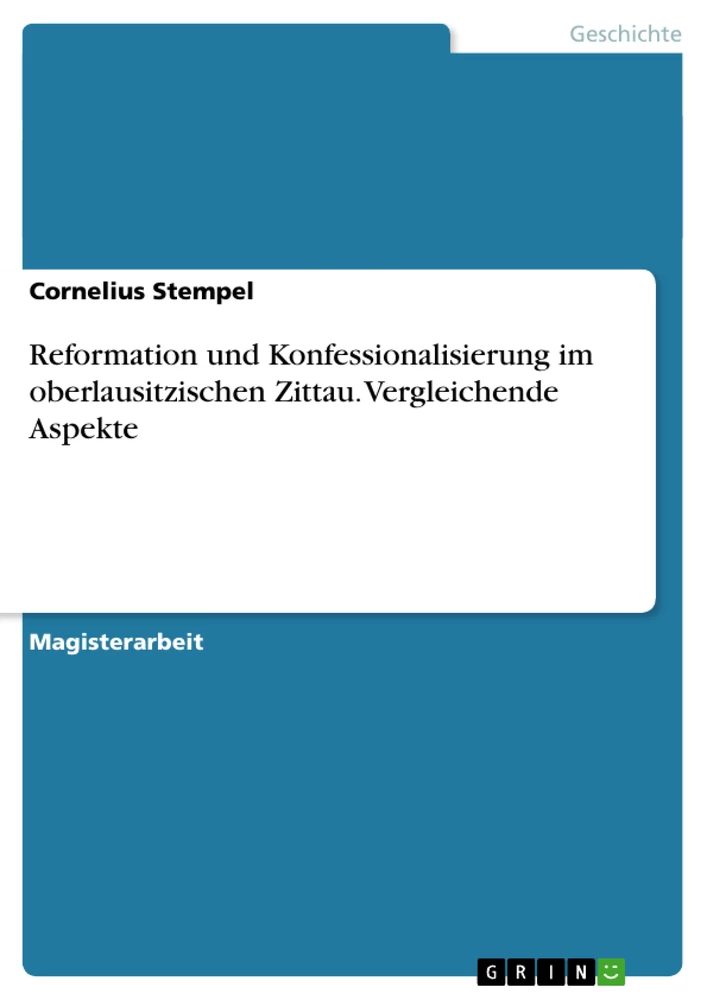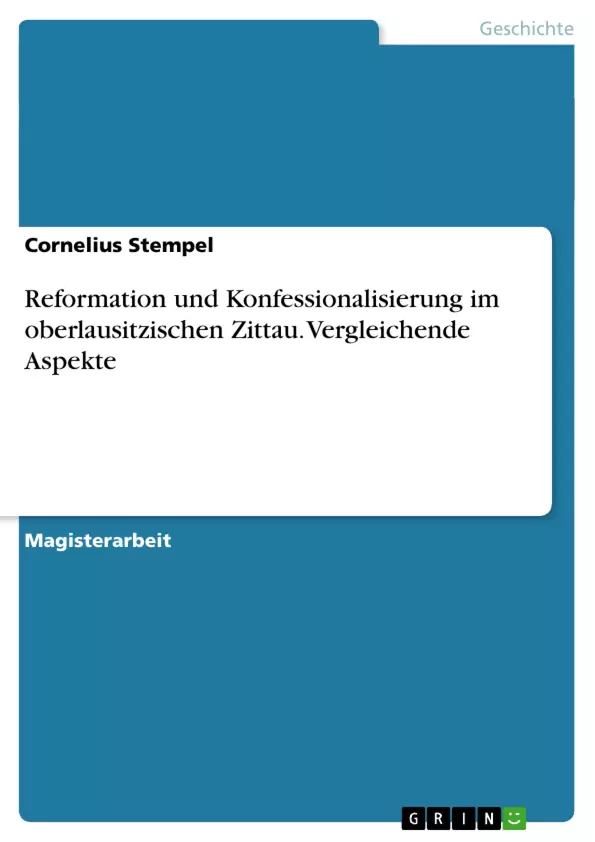Es sollen an dieser Stelle zwei Gründe angeführt werden, welche die Beschäftigung mit dem Ereignis Reformation in der Stadt Zittau lohnenswert erscheinen lassen. Zum einen die außergewöhnliche verfassungsrechtliche und kirchenpolitische Stellung Zittaus im 16. Jahrhundert, zum anderen der Mangel an modernen wissenschaftlichen Arbeiten hinsichtlich der Rolle einer oberlausitzischen Stadt bei der Einführung der Reformation. Die böhmische Gründung Zittau wuchs spätestens seit ihrem Beitritt zum "Sechsstädtebund" 1346 in das politische Gebilde der Oberlausitz hinein, verblieb aber in der kirchenpolitischen Hierarchie beim Erzbistum Prag. Die Oberlausitz besaß keine Herrscherdynastie, sondern gehörte abwechselnd zum Herrschaftsbereich der größeren Nachbarn Sachsen, Brandenburg und vor allem Böhmen, ohne jemals von diesen einverleibt worden zu sein. Das macht die Bewertung der Stellung des "Markgraftums" innerhalb des Reichsgefüges schwierig, so erwähnt die Reichsmatrikel von 1521 das Nebenland der Böhmischen Krone nicht. Das Fehlen einer im Lande ansässigen Herrschaft führte zur Herausbildung einer Landesverfassung, die Karlheinz Blaschke als "Ständerepublik" charakterisierte. Die Städte gewannen auf Grund ihrer wirtschaftlichen Potenz ein Übergewicht gegen den formal politisch vorherrschenden Adel. Diese einzigartigen Voraussetzungen machen Zittau zu einem lohnenswerten Beispiel, um die These Bernd Moellers von der besonderen Rolle der Reichsstädte am Beginn der Reformation zu untersuchen, wiewohl Zittau nie freie Reichsstadt war, sondern nur "quasi-reichsstädtischen Rang" (Blaschke) hatte. Der "Sechsstädtebund" baute im 16. Jahrhundert Ersatzformen von Staatlichkeit auf, die im zweiten Teil der Arbeit auf ihre Anwendbarkeit hinsichtlich des "Konfessionalisierungstheorems" von Heinz Schilling und Wolfgang Reinhard untersucht werden sollen. Im Fazit soll ein Ausblick bis zum Zäsurjahr 1635 gegeben werden, als die Oberlausitz im "Prager Frieden" an das Kurfürstentum Sachsen fiel.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemgegenstand und Problembereich
- 1.2. Fragestellung, Aufbau und Methode
- 1.3. Quellenlage und Literaturkritik
- 2. Die Entwicklung der Stadt Zittau bis zum 16. Jahrhundert unter politischen, wirtschaftlichen und kirchlichen Aspekten
- 2.1. Entstehung, Ersterwähnung und Stellung innerhalb der Krone Böhmens
- 2.2. Erste Blüte im 14. Jahrhundert – Ratsverfassung und Gerichtsbarkeit
- 2.3. Zittaus Rolle im „Sechsstädtebund“ und Auswirkungen auf Wirtschaft und städtische Gesellschaft
- 2.4. Die Kirchenorganisation des Dekanats Zittau vor der Reformation
- 3. Die Sakrale Topographie von Zittau zu Beginn des 16. Jahrhunderts
- 3.1. Johanniterorden und Johanniskirche
- 3.2. Die Filiale der Johanniskirche: Frauen-, Kreuz- und Dreifaltigkeitskirche
- 3.3. Franziskanerkloster, Regelschwesternhaus und Kirche St. Peter und Paul
- 3.4. Das Hospital St. Jakob und das Siechhaus zum Heiligen Geist
- 4. Lorenz Heydenreich und die beginnende Reformation 1521-1530
- 4.1. Lorenz Heydenreichs Lebensweg und Stellung innerhalb der Stadtgemeinde bis 1521
- 4.2. Der Komtur Nikolaus Hertwig und die Jahre vor der Einsetzung Heydenreichs 1517-1521
- 4.3. Die beginnende Reformation: Städtisches Umfeld und erste kirchliche Maßnahmen“ 1521-1525/26
- 4.4. Der Zittauer „Gotteskasten“ – ein Instrument der frühneuzeitlichen Armenfürsorge
- 4.5. Der Widerstand des Königs gegen die „neue Lehre“ und der Abschied Heydenreichs aus Zittau 1529/30
- 5. Vom Weggang Heydenreichs bis zum Pönfall: religiöse Vielfalt und strukturelle Neuerungen
- 5.1. Die Nachfolger Heydenreichs und der Versuch königlicher Einflussnahme 1530-1538
- 5.2. Die Veränderungen in der Kommende, die Erlangung der Kollatur durch den Rat und die Rückkehr Heydenreichs
- 5.3. Die Schule und ihre Bedeutung für die Reformation: Andreas Mascus, Konrad Nesen, Nikolaus von Dornspach
- 5.4. Der Briefwechsel Zittauer Humanisten mit Heinrich Bullinger
- 5.5. Der Pönfall der Sechsstädte 1547 und seine Auswirkungen auf den Fortgang der Reformation in Zittau
- 6. Von der Überwindung des Pönfalls bis zum Kauf der Kommende – die endgültige Durchsetzung der Reformation und die Elemente einer „Konfessionalisierung“
- 6.1. Die Berufung Tectanders und Elemente einer „städtischen Konfessionalisierung“ – die Kirchenordnung von 1564
- 6.2. Der Kauf des Klosters Oybin und der Kommenden – ,,struktureller Abschluss“ der Reformation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert die Einführung der Reformation in der Stadt Zittau im 16. Jahrhundert und untersucht den Prozess der Konfessionalisierung. Der Fokus liegt dabei auf der besonderen Rolle der Stadt innerhalb der Oberlausitz, die sich durch ihre politische Autonomie und ihre Zugehörigkeit zum „Sechsstädtebund“ auszeichnete.
- Die politische und wirtschaftliche Entwicklung Zittaus vor der Reformation
- Die Rolle des „Sechsstädtebunds“ und seine Bedeutung für die Stadt
- Die Einführung der Reformation in Zittau durch Lorenz Heydenreich
- Die Herausforderungen und Konflikte im Prozess der Konfessionalisierung
- Die endgültige Durchsetzung der Reformation und die Etablierung einer neuen Kirchenordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Problemgegenstand und die Fragestellung der Arbeit. Es erläutert die Relevanz des Themas und begründet die Wahl der Stadt Zittau als Untersuchungsgegenstand. Kapitel 2 zeichnet den historischen Hintergrund der Stadt Zittau bis zum 16. Jahrhundert nach und analysiert die politische, wirtschaftliche und kirchliche Situation. In Kapitel 3 wird die sakrale Topographie Zittaus zu Beginn des 16. Jahrhunderts dargestellt. Kapitel 4 widmet sich der Person Lorenz Heydenreich und der beginnenden Reformation in Zittau, während Kapitel 5 die Entwicklung der Reformation nach Heydenreichs Weggang und den Pönfall der Sechsstädte 1547 beleuchtet. Kapitel 6 befasst sich mit der endgültigen Durchsetzung der Reformation und der Etablierung einer neuen Kirchenordnung.
Schlüsselwörter
Die Magisterarbeit beschäftigt sich mit der Reformation und Konfessionalisierung im Kontext der Stadt Zittau. Die zentralen Themenbereiche sind die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, die Rolle des „Sechsstädtebunds“, die Einführung der Reformation durch Lorenz Heydenreich, der Prozess der Konfessionalisierung und die Etablierung einer neuen Kirchenordnung. Die Arbeit untersucht die Wechselwirkungen zwischen städtischer Autonomie, kirchlicher Entwicklung und dem Einfluss des „Sechsstädtebunds“ auf die Reformation in Zittau.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Reformation in Zittau historisch besonders?
Wegen Zittaus Sonderstellung als böhmische Gründung in der Oberlausitz, die kirchenpolitisch dem Erzbistum Prag unterstand.
Wer war Lorenz Heydenreich?
Er war die zentrale Figur der beginnenden Reformation in Zittau und trieb zwischen 1521 und 1530 erste kirchliche Reformen voran.
Was war der „Sechsstädtebund“?
Ein Bündnis oberlausitzischer Städte (darunter Zittau), das im 16. Jahrhundert eine „Ständerepublik“ bildete und Ersatzformen von Staatlichkeit aufbaute.
Was versteht man unter dem „Pönfall“ von 1547?
Eine Strafaktion des böhmischen Königs gegen die Sechsstädte, die weitreichende Auswirkungen auf die politische Autonomie und die Reformation hatte.
Wann wurde die Reformation in Zittau endgültig abgeschlossen?
Mit der Kirchenordnung von 1564 und dem Kauf der Kommenden erreichte die Reformation ihren strukturellen Abschluss.
- Citar trabajo
- Cornelius Stempel (Autor), 2006, Reformation und Konfessionalisierung im oberlausitzischen Zittau. Vergleichende Aspekte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64039