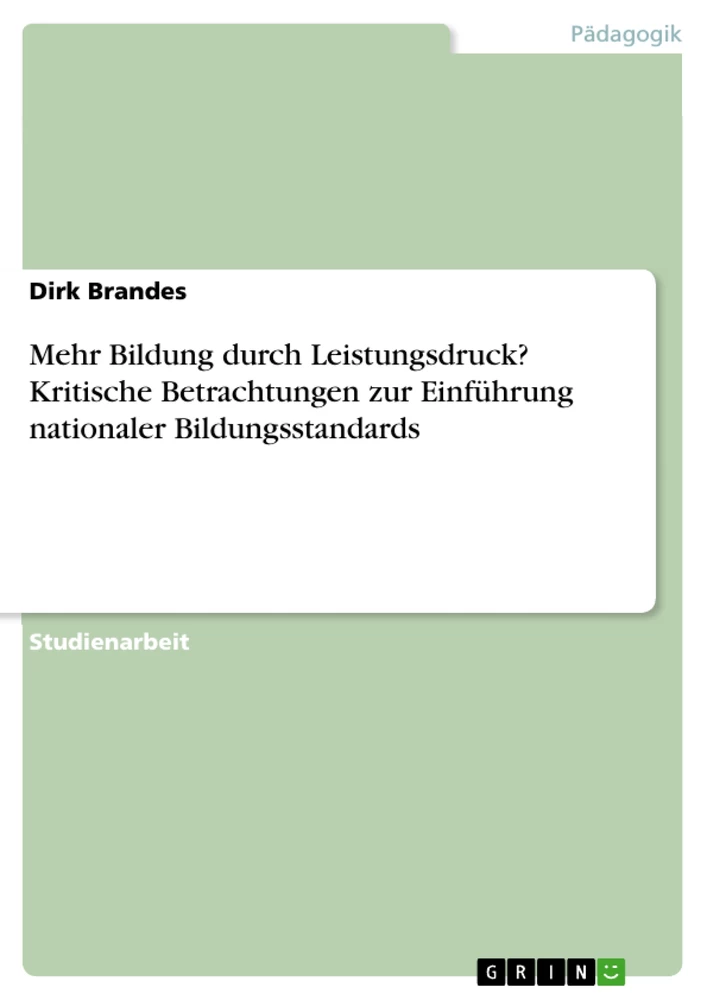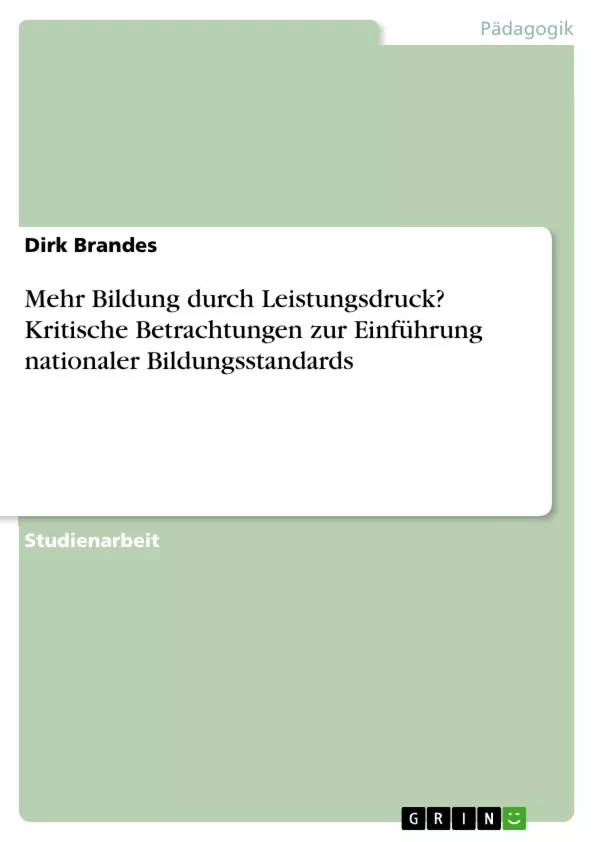Was in Deutschland 1997 als "TIMSS - Schock" begann und 2001 in die "PISA - Katastrophe" [Von der Groeben, A.: Nicht in Maßnahmen stecken bleiben. Ein Plädoyer für radikale Fragen nach PISA, in: Pädagogik 04/2002, S. 38.] mündete, ist kennzeichnend für einen in den 1990er Jahren einsetzenden internationalen Prozess der Standardisierung und Evaluation von Bildungsinhalten. Für das deutsche Bildungssystem war das Ergebnis dieser internationalen Vergleichsstudien niederschmetternd: In allen drei untersuchten Bereichen, der Lesekompetenz, der mathematischen Kompetenz und der naturwissenschaftlichen Kompetenz belegen deutsche Schüler Ränge im unteren Mittelfeld, jeweils noch unter dem OECD-Durchschnitt. Dafür ist die Leistungsstreuung überdurchschnittlich groß und die soziale Herkunft hat einen Einfluss auf die schulische Bildung wie in keinem anderen Land. [Artelt; Baumert, u. a.: PISA 2000: Die Studie im Überblick. Grundlagen, Methoden und Ergebnisse, Hg. Vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin 2002, S. 7-14]
Während die bildungspolitischen Reaktionen auf die Ergebnisse der TIMSS-Studie noch eher zurückhaltend waren, haben die Ergebnisse der PISA-Untersuchung "zu einer wahren Explosion geführt". [Böttcher, W.: Besser werden durch Leistungsstandards? Eine bildungspolitische Polemik auf empirischem Fundament, in: Pädagogik 04/2003(a), S. 50.] In Deutschland hatte es bis dahin weder besonders viel Interesse daran gegeben, die Produktivität der Schulen zu messen, noch daran, eine Rechenschaft von Lehrern und Schulen für deren pädagogische Tätigkeit zu verlangen. [Vgl. Eckinger, L.: Stärken Bildungsstandards die Lehrerarbeit?, in: Fitzner, Thilo (Hg.): Bildungsstandards. Internationale Erfahrungen - Schulentwicklung - Bildungsreform, Bad Boll 2004, S. 421. Vgl. auch Becker,G. E.: Bildungsstandards - Ausweg oder Alibi?, Weinheim u. Basel 2004, S. 9.] Nun bilden die Leistungen der Schulen und die Ergebnisse ihrer Arbeit den Kern aller bildungspolitischen Diskussionen und Reformmaßnahmen. [Böttcher (2003a), S. 50]
Inwiefern diese Umorientierung im deutschen Bildungswesen und damit die Einführung nationaler Bildungsstandards, in der Form wie sie von Seiten der Politik umgesetzt werden, tatsächlich zu den erhofften Qualitätssteigerungen in der Bildung deutscher Schüler führen, soll Gegenstand dieser Untersuchung sein.
Inhaltsverzeichnis
- I. INHALT
- 1. Einleitung
- 2. Zur Einführung nationaler Bildungsstandards
- 2.1. Von der Input- zur Output-Orientierung
- 2.2. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- 2.3. Bildungspolitische Ziele und Chancen der nationalen Standards
- 2.3.1. Was ist Bildung?
- 3. Output-Standards als Mittel zur Qualitätssteigerung
- 3.1. Deutscher Bildungspessimismus
- 3.2. Leistungsdruck und Selektion
- 3.3. Bildungsstandards als 'Leistungsstandards'
- 3.4. 'Teaching to the Test'
- 4. Zusammenfassung
- III. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Einführung nationaler Bildungsstandards in Deutschland und untersucht, ob diese tatsächlich zu einer Steigerung der Bildungqualität deutscher Schüler führen können. Die Arbeit analysiert die Unterschiede zwischen einer Steuerung des Unterrichts durch Lehrpläne und einer Orientierung an Bildungsstandards, betrachtet die Ziele und Erwartungen an die Standards und beleuchtet kritisch die Auswirkungen der Bildungsreform auf das deutsche Bildungssystem.
- Die Einführung nationaler Bildungsstandards als Reaktion auf die Ergebnisse der TIMSS- und PISA-Studien
- Die Verschiebung von der Input- zur Output-Orientierung in der deutschen Bildungspolitik
- Die Auswirkungen von Bildungsstandards auf den Leistungsdruck und die Selektion in Schulen
- Die Kritik an Bildungsstandards als "Leistungsstandards" und das Phänomen des "Teaching to the Test"
- Die Bedeutung der Strukturanalyse des Bildungssystems und der Verantwortung der Politik für die Qualitätssteigerung in der Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in das Thema der nationalen Bildungsstandards ein und stellt den aktuellen Kontext der Bildungsreform in Deutschland dar. Sie beleuchtet die Ergebnisse der TIMSS- und PISA-Studien sowie die daraus resultierende Kritik an der deutschen Bildung.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beschreibt die Einführung der nationalen Bildungsstandards im Kontext der Bildungspolitik. Es beleuchtet die Unterschiede zwischen Lehrplänen und Bildungsstandards, die Ziele der Standards und die erwarteten Chancen der Reform.
- Kapitel 3: Der Hauptteil der Arbeit analysiert die Auswirkungen der Bildungsstandards auf die Qualität schulischer Bildung. Es werden Themen wie Deutscher Bildungspessimismus, Leistungsdruck und Selektion in der Schule sowie das Phänomen des "Teaching to the Test" behandelt.
Schlüsselwörter
Bildungsstandards, TIMSS, PISA, Output-Orientierung, Qualitätssteigerung, Leistungsdruck, Selektion, "Teaching to the Test", Bildungspessimismus, Lehrpläne, Kompetenz, Strukturanalyse des Bildungssystems.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für die Einführung nationaler Bildungsstandards in Deutschland?
Der Hauptauslöser waren die Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien wie TIMSS (1997) und PISA (2001), bei denen deutsche Schüler nur unterdurchschnittliche Leistungen erbrachten.
Was bedeutet der Wechsel von der Input- zur Output-Orientierung?
Anstatt nur die Lehrpläne und Ressourcen (Input) vorzugeben, konzentriert sich die Bildungspolitik nun auf die messbaren Ergebnisse und Kompetenzen (Output), die Schüler am Ende eines Lernabschnitts erreicht haben müssen.
Was versteht man unter dem Phänomen "Teaching to the Test"?
Kritiker befürchten, dass Lehrer ihren Unterricht primär auf die Inhalte der standardisierten Tests ausrichten, anstatt eine breite Bildung zu vermitteln, um in Rankings besser abzuschneiden.
Welchen Einfluss hat die soziale Herkunft laut der PISA-Studie auf den Schulerfolg?
Die PISA-Studie zeigte, dass in Deutschland die soziale Herkunft einen stärkeren Einfluss auf die schulische Bildung hat als in fast jedem anderen OECD-Land.
Führen Bildungsstandards automatisch zu einer Qualitätssteigerung?
Dies ist umstritten. Die Arbeit untersucht kritisch, ob der erhöhte Leistungsdruck und die Standardisierung tatsächlich die Qualität verbessern oder lediglich zu mehr Selektion führen.
- Arbeit zitieren
- Dirk Brandes (Autor:in), 2006, Mehr Bildung durch Leistungsdruck? Kritische Betrachtungen zur Einführung nationaler Bildungsstandards, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64134