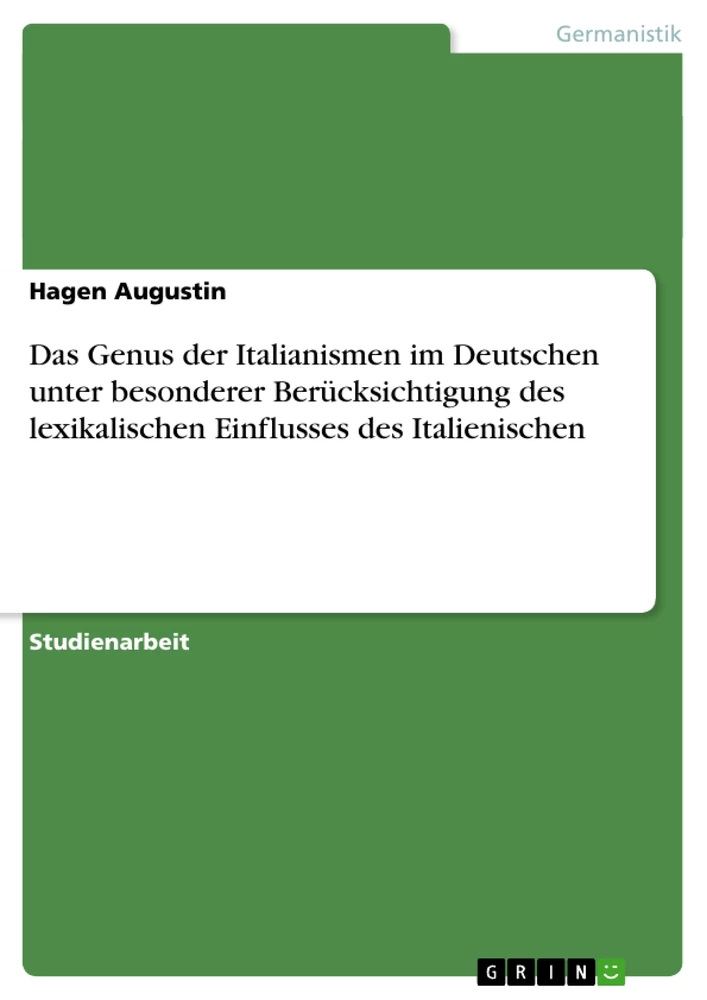Gegenstand der Hausarbeit sind die in der deutschen Sprache vorkommenden nominalen Italianismen. Unter Italianismen sollen alle aus dem Italienischen und seiner Varietäten stammenden Fremd- und Lehnwörter verstanden werden.
Im lexikologischen Teil der Arbeit soll der Untersuchungsgegenstand exemplarisch näher bestimmt werden: im Kapitel 2 "Der lexikalische Einfluss der italienischen Sprache auf das Deutsche" werden eine Reihe von Italianismen vorgestellt. Schwerpunkte sind ihre geographische und kulturgeschichtliche Herkunft als Ergebnis deutsch-italienischen Sprachkontaktes unter lexikalischen Gesichtspunkten und die oft komplizierten Entlehnungswege über Vermittlersprachen. Das Kapitel 3 "Das Genus der Italianismen im Deutschen" befasst sich mit dem Aspekt der Genuszuordnung beim Integrationsprozess der Transferenzen. Die Genussysteme der beiden Sprachen sollen kurz vorgestellt werden und der Vorgang der Genuszuordnung in seinen sprachlichen und außersprachlichen Dimensionen analysiert werden. Im Anschluss soll den Formen mit schwankendem Genus besondere Aufmerksamkeit zuteil werden, da hier bestimmte sprachwissenschaftliche Prinzipien besonders deutlich in ihrer Wirkungsweise erkennbar werden.
Die Hausarbeit kann in ihrem Rahmen keine vollständige systematische Untersuchung der Italianismen liefern, die Teilbereiche Lexik und Genus sollen exemplarisch abgehandelt werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Thema
- 1.2 Forschungsstand
- 2. Der lexikalische Einfluss der italienischen Sprache auf das Deutsche
- 2.1 Sprachgeographie
- 2.2 Deutsch-italienischer Sprachkontakt
- 2.2.1 Historischer Abriss
- 2.2.2 Mundartliche und hochsprachliche Entlehnungen
- 2.2.3 Sachgebiete
- 2.3 Zur Problematik der Vermittlersprachen
- 2.3.1 Gallizismen
- 2.3.2 Italienisch als Vermittlersprache von Arabismen
- 3. Das Genus der Italianismen im Deutschen
- 3.1 Das deutsche und italienische Genussystem im Vergleich
- 3.1.1 Numerus
- 3.1.2 Artikel
- 3.2 Genuszuordnung beim Entlehnungsprozess
- 3.2.1 Allgemeine Betrachtungen
- 3.2.2 Kriterien für die Genuszuweisung
- 3.2.3 Varietätenlinguistische Aspekte und außersprachliche Faktoren
- 3.2.3.1 Diachrone Aspekte
- 3.2.3.2 Diamesische und diaphasische Aspekte
- 3.2.3.3 Diastratische Aspekte
- 3.3 Genusschwankungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die nominalen Italianismen im Deutschen, fokussiert auf ihre lexikalische Integration und Genuszuordnung. Ziel ist es, exemplarisch den lexikalischen Einfluss des Italienischen auf das Deutsche zu beleuchten und die sprachlichen und außersprachlichen Faktoren bei der Genuszuweisung zu analysieren.
- Lexikalische Integration italienischer Wörter ins Deutsche
- Geographische und kulturgeschichtliche Herkunft der Italianismen
- Rolle von Vermittlersprachen im Entlehnungsprozess
- Vergleich des deutschen und italienischen Genussystems
- Analyse der Genuszuweisung bei Italianismen und Genusschwankungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die nominalen Italianismen im Deutschen. Sie definiert den Begriff "Italianismen" und umreißt den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 behandelt den lexikalischen Einfluss des Italienischen auf das Deutsche, während Kapitel 3 die Genuszuordnung der Italianismen analysiert. Die Arbeit konzentriert sich exemplarisch auf die Bereiche Lexik und Genus, da eine vollständige Untersuchung aufgrund des Umfangs nicht möglich ist. Der Forschungsstand wird ebenfalls kurz beleuchtet, wobei die Monographie von Frederike Schmöe als wichtigste Quelle genannt wird.
2. Der lexikalische Einfluss der italienischen Sprache auf das Deutsche: Dieses Kapitel untersucht den lexikalischen Einfluss des Italienischen auf das Deutsche. Es beginnt mit einer sprachgeographischen Betrachtung des deutsch-italienischen Sprachkontakts, wobei die geographische Nähe und die historischen Sprachkontakte, besonders in Regionen wie Südtirol und dem Tessin, hervorgehoben werden. Es wird zwischen hochsprachlichen und mundartlichen Entlehnungen unterschieden. Des Weiteren werden die komplexen Entlehnungswege über Vermittlersprachen wie Französisch und die damit verbundenen Herausforderungen für die sprachwissenschaftliche Analyse beleuchtet. Die Kapitelteile befassen sich im Detail mit der Definition und Unterscheidung von Fremd- und Lehnwörtern, den historischen Entwicklungen des Italienischen und dem Einfluss der regionalen Dialekte auf den Sprachkontakt.
3. Das Genus der Italianismen im Deutschen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Genuszuordnung von Italianismen im Deutschen. Es beginnt mit einem Vergleich der deutschen und italienischen Genussysteme, wobei auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten eingegangen wird. Der Fokus liegt dann auf dem Prozess der Genuszuordnung beim Integrationsprozess der italienischen Lehnwörter. Hier werden verschiedene Kriterien und Faktoren wie diachrone, diamesische, diaphasische und diastratische Aspekte analysiert, um die Komplexität des Genuszuweisungsprozesses zu verdeutlichen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Italianismen mit schwankendem Genus gewidmet, die als besonders aufschlussreich für die Funktionsweise sprachwissenschaftlicher Prinzipien angesehen werden. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Genuszuweisung und wie sich verschiedene sprachliche und außersprachliche Faktoren auf die Genuswahl auswirken.
Schlüsselwörter
Italianismen, Genus, Deutsch, Italienisch, Sprachkontakt, Lexik, Entlehnung, Genuszuordnung, Vermittlersprachen, Sprachgeschichte, Varietätenlinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Der lexikalische Einfluss der italienischen Sprache auf das Deutsche und die Genuszuordnung von Italianismen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den lexikalischen Einfluss der italienischen Sprache auf das Deutsche, mit besonderem Fokus auf die Genuszuordnung von nominalen Italianismen. Sie analysiert die Integration italienischer Wörter in die deutsche Sprache und die dabei wirkenden sprachlichen und außersprachlichen Faktoren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den Forschungsgegenstand vor und umreißt den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 untersucht den lexikalischen Einfluss des Italienischen auf das Deutsche, einschließlich sprachgeographischer Aspekte und der Rolle von Vermittlersprachen. Kapitel 3 analysiert die Genuszuordnung von Italianismen im Deutschen, vergleicht die deutschen und italienischen Genussysteme und untersucht die Kriterien der Genuszuweisung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: lexikalische Integration italienischer Wörter ins Deutsche, geographische und kulturgeschichtliche Herkunft der Italianismen, Rolle von Vermittlersprachen (z.B. Französisch) im Entlehnungsprozess, Vergleich des deutschen und italienischen Genussystems, Analyse der Genuszuweisung bei Italianismen und Genusschwankungen.
Wie wird der lexikalische Einfluss des Italienischen auf das Deutsche untersucht?
Kapitel 2 betrachtet den lexikalischen Einfluss unter sprachgeographischen Aspekten, indem es den deutsch-italienischen Sprachkontakt, insbesondere in Regionen wie Südtirol und dem Tessin, beleuchtet. Es unterscheidet zwischen hochsprachlichen und mundartlichen Entlehnungen und analysiert die komplexen Entlehnungswege über Vermittlersprachen. Die Definition und Unterscheidung von Fremd- und Lehnwörtern sowie historische Entwicklungen des Italienischen werden ebenfalls behandelt.
Wie wird die Genuszuordnung von Italianismen analysiert?
Kapitel 3 vergleicht zunächst das deutsche und italienische Genussystem. Anschließend wird der Prozess der Genuszuordnung bei der Integration italienischer Lehnwörter untersucht. Dabei werden verschiedene Kriterien und Faktoren wie diachrone, diamesische, diaphasische und diastratische Aspekte analysiert, um die Komplexität des Genuszuweisungsprozesses zu verdeutlichen. Besondere Beachtung finden Italianismen mit schwankendem Genus.
Welche Rolle spielen Vermittlersprachen?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Vermittlersprachen wie Französisch im Entlehnungsprozess. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich durch diese komplexen Entlehnungswege für die sprachwissenschaftliche Analyse ergeben, und beleuchtet den Einfluss von Vermittlersprachen auf die Genuszuweisung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Italianismen, Genus, Deutsch, Italienisch, Sprachkontakt, Lexik, Entlehnung, Genuszuordnung, Vermittlersprachen, Sprachgeschichte, Varietätenlinguistik.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit nennt die Monographie von Frederike Schmöe als wichtigste Quelle. Weitere Quellen werden im Literaturverzeichnis der vollständigen Arbeit aufgeführt (nicht in diesem Auszug).
Ist eine vollständige Untersuchung aller Italianismen möglich?
Nein, aufgrund des Umfangs ist eine vollständige Untersuchung aller Italianismen nicht möglich. Die Arbeit konzentriert sich exemplarisch auf die Bereiche Lexik und Genus.
- Arbeit zitieren
- Hagen Augustin (Autor:in), 2001, Das Genus der Italianismen im Deutschen unter besonderer Berücksichtigung des lexikalischen Einflusses des Italienischen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6416