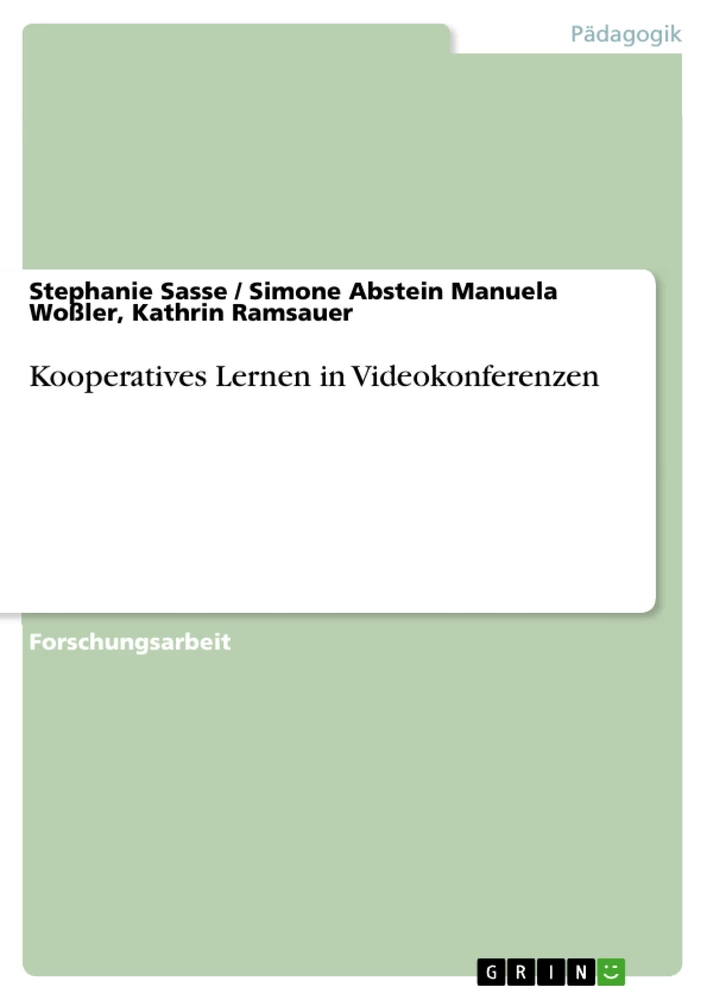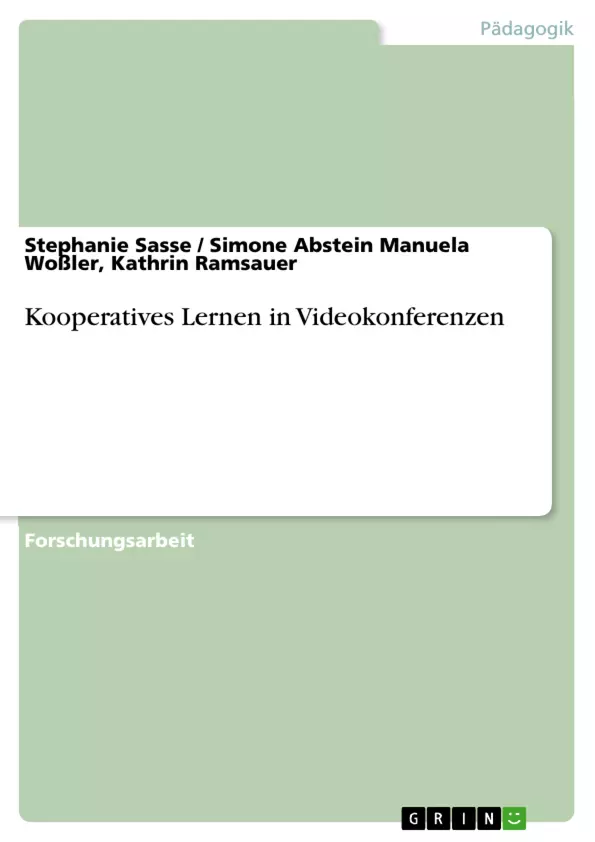Mit der Einführung des computerunterstützten Lernens in die Bildungsbereiche wurde in der Pädagogik eine neue Epoche eingeleitet. Über kaum ein anderes pädagogisches Thema wurde in den letzten Jahren mehr diskutiert.
Durch die neuen Entwicklungen im Bereich der Kommunikationsmittel gewinnen neue Lernformen, wie beispielsweise das kooperative Lernen in Videokonferenzen, immer mehr an Bedeutung. Diese Möglichkeiten können für das Lernen im Betrieb oder in der Universität genutzt werden. So ist auch über größere Distanzen eine direkte, persönliche Kommunikation möglich, da die Lernenden zeitgleich über einen audiovisuellen Kanal miteinander verbunden sind. In Zeiten der Globalisierung ist dies sehr von Vorteil, denn so kann kooperatives Lernen stattfinden, ohne dass sich die Lernenden am gleichen Ort aufhalten müssen (Fischer, Bruhn, Gräsel & Mandl, 1999). Die breite Akzeptanz der neuen Medien im Bildungssystem wurde schließlich dadurch erwirkt, dass sie eine Menge Vorzüge bietet, die mit der Veränderung unserer Gesellschaft notwendig geworden sind. Zum einen wird, wie bereits erwähnt, mit ihrem Einsatz eine neue räumliche Flexibilisierung geschaffen. Dadurch wird sogar ermöglicht, dass sich Menschen auf der ganzen Welt über ein Wissensgebiet austauschen können. Desweiteren bringen neue Medien eine zeitliche Flexibilisierung mit sich. Menschen, die sich beispielsweise weiterbilden wollen, sind nicht mehr darauf angewiesen zu einer bestimmten Zeit an einem Kurs teilzunehmen, sondern können so
Weiterbildungsmaßnahmen besser mit ihrem Beruf vereinbaren. Zusätzlich ermöglichen Computernetze einen schnelleren Informationszugriff, die auf traditionellen Weg nicht oder nicht so schnell zugänglich wären (Fischer, Bruhn, Gräsel & Mandl, 1999). Ein weiteres Argument für die neuen Technologien ist „die Verwirklichung von didaktischen Prinzipien, die im konventionellen Unterricht nur ansatzweise realisiert werden konnten: Individualisierung des Lernens, Authentizität, Situiertheit, Interaktivität, Kooperation“ (Weidenmann, 2001, S.464). Besonderes in Lernformen wie dem kooperativen Lernen in Videokonferenzen können diese Prinzipien angewendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Geschlecht
- Vorwissen
- Soziale Ängstlichkeit
- Ziel der Studie
- Fragestellungen
- Methode
- Stichprobe und Design
- Lernumgebung
- Versuchsablauf
- Experimentalbedingungen
- Experimentalbedingung: Wissensschema
- Experimentalbedingung: Kooperationsskript
- Experimentalbedingung: Kooperationsskript und Wissensschema
- Experimentalbedingung: Ohne Kooperationsskript und ohne Wissensschema
- Variablen und Variablenerhebung
- Relevante Variablen der Untersuchung
- Lernerfolg
- Geschlecht
- Vorwissen
- Soziale Ängstlichkeit
- Ergebnisse
- Vorraussetzungen
- Geschlecht
- Vorwissen
- Soziale Ängstlichkeit
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Diskussion
- Geschlecht
- Vorwissen
- Soziale Ängstlichkeit
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit befasst sich mit der Untersuchung des Einflusses individueller Faktoren auf den Lernerfolg beim kooperativen Lernen in Videokonferenzen. Ziel ist es, die Rolle des Geschlechts, des Vorwissens und der sozialen Ängstlichkeit in diesem Kontext zu erforschen.
- Kooperatives Lernen in Videokonferenzen
- Einfluss individueller Faktoren auf den Lernerfolg
- Rolle des Geschlechts, des Vorwissens und der sozialen Ängstlichkeit
- Situiertes Lernen und der Konstruktionsprozess des Wissens
- Instruktionsunterstützung im kooperativen Lernen in Videokonferenzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des computerunterstützten Lernens und des kooperativen Lernens in Videokonferenzen ein. Sie beleuchtet die Bedeutung dieser Lernformen im Kontext der Globalisierung und der digitalen Transformation. Die Einleitungs sektion bespricht die Vorteile neuer Medien im Bildungssystem, wie zum Beispiel räumliche und zeitliche Flexibilisierung sowie den schnelleren Informationszugriff. Darüber hinaus wird auf die Bedeutung der Anwendung didaktischer Prinzipien, wie Individualisierung, Authentizität und Interaktivität, im kooperativen Lernen in Videokonferenzen hingewiesen. Die Einleitung betont auch die Bedeutung der Untersuchung individueller Unterschiede in diesem Kontext.
- Theorie: Die Theorie sektion erläutert das Konzept des situierten Lernens und betont, dass Wissen nicht einfach weitergegeben, sondern durch den aktiven Konstruktionsprozess des Lernenden entsteht. Dieser Prozess ist stark vom sozialen Kontext abhängig. Diese Sektion beleuchtet auch die relevanten Theorien zur Rolle von Geschlecht, Vorwissen und sozialer Ängstlichkeit im Lernprozess.
- Ziel der Studie: Diese Sektion beschreibt das Forschungsziel der Arbeit, welches in der Untersuchung des Einflusses individueller Faktoren auf den Lernerfolg beim kooperativen Lernen in Videokonferenzen besteht. Die Studie konzentriert sich auf die Analyse der Rolle des Geschlechts, des Vorwissens und der sozialen Ängstlichkeit.
- Methode: Die Methode sektion beschreibt den Forschungsansatz, die Stichprobe, das Design der Studie und die Lernumgebung. Sie erläutert den Versuchsablauf und die verschiedenen Experimentalbedingungen, die eingesetzt werden. Darüber hinaus werden die Variablen und deren Erhebungsmethoden vorgestellt.
- Ergebnisse: Diese sektion präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, die mit den individuellen Faktoren wie Geschlecht, Vorwissen und sozialer Ängstlichkeit in Bezug gesetzt werden. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die verschiedenen Experimentalbedingungen analysiert.
- Diskussion: Die Diskussion sektion interpretiert die Ergebnisse und setzt sie in den Kontext der vorgestellten Theorien. Sie beleuchtet die Relevanz der Forschungsergebnisse für die Praxis des kooperativen Lernens in Videokonferenzen und diskutiert die Bedeutung individueller Unterschiede im Lernprozess.
Schlüsselwörter
Kooperatives Lernen, Videokonferenzen, Lernerfolg, Geschlecht, Vorwissen, Soziale Ängstlichkeit, Situiertes Lernen, Instruktionsunterstützung, Individuelle Unterschiede, Empirische Forschungsmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile von kooperativem Lernen in Videokonferenzen?
Es ermöglicht räumliche und zeitliche Flexibilität, globalen Wissensaustausch und die Anwendung didaktischer Prinzipien wie Individualisierung und Interaktivität, ohne dass Lernende am selben Ort sein müssen.
Welchen Einfluss hat das Vorwissen auf den Lernerfolg?
Vorwissen ist ein entscheidender Faktor, da Lernen als aktiver Konstruktionsprozess verstanden wird. Wer bereits über Basiswissen verfügt, kann neue Informationen leichter in bestehende Wissensschemata integrieren.
Wie wirkt sich soziale Ängstlichkeit in Videokonferenzen aus?
Soziale Ängstlichkeit kann die Beteiligung und Interaktion in Videokonferenzen hemmen, was den kooperativen Wissenserwerb erschwert. Die Forschung untersucht, wie Instruktionsunterstützung hier helfen kann.
Was ist ein Kooperationsskript?
Ein Kooperationsskript ist eine strukturierte Anleitung oder ein Leitfaden, der den Lernenden hilft, ihre Zusammenarbeit in der Videokonferenz effektiver zu gestalten und Rollen klar zu verteilen.
Spielt das Geschlecht eine Rolle beim Lernerfolg in Videokonferenzen?
Die Studie untersucht, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede im Kommunikationsverhalten oder im Lernerfolg beim computerunterstützten kooperativen Lernen gibt.
- Quote paper
- Dr. Stephanie Sasse (Author), Simone Abstein Manuela Woßler, Kathrin Ramsauer (Author), 2005, Kooperatives Lernen in Videokonferenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64192