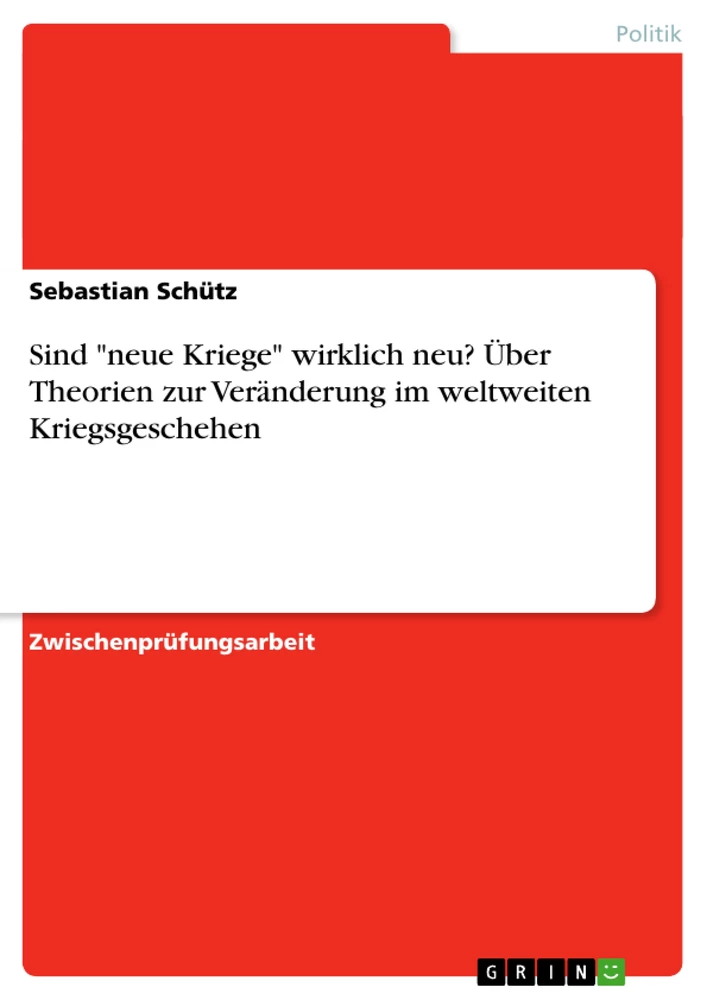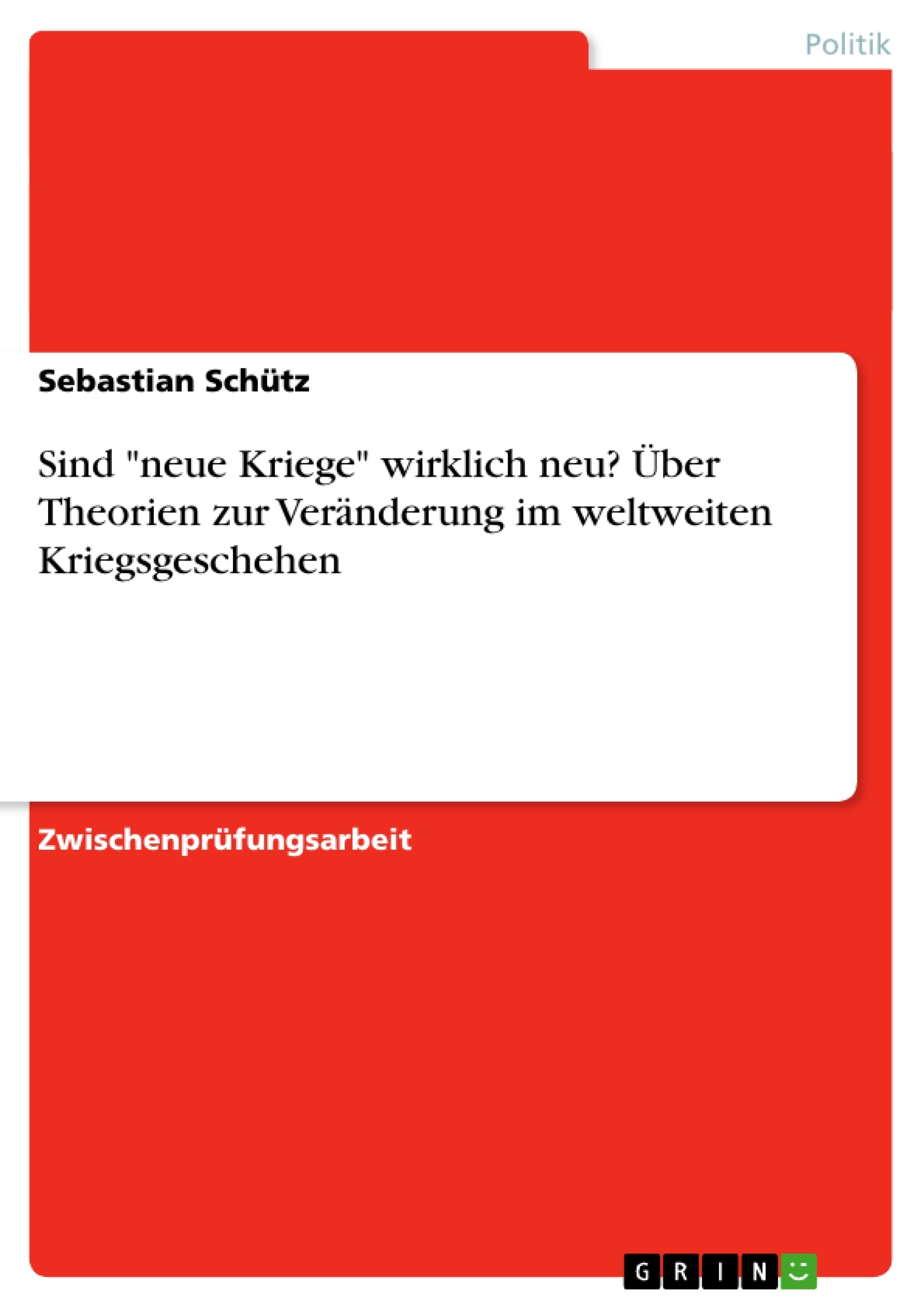Mit dem Ende des Kalten Krieges haben sich die geopolitischen Parameter substantiell verschoben. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die einzige noch existierende Supermacht und auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen haben sich mit dem Ende des Ost-West Konflikts fundamental geändert. Anstelle der Konfrontationen zwischen den beiden Blöcken sind lokale Konflikte getreten, welche sich zumeist innerhalb von Staatsgrenzen abspielen. Des Weiteren stellt die Problematik des global agierenden Terrorismus eine neue Herausforderung dar.
Wer zu Beginn der neunziger Jahre glaubte, der Wegfall der Systemkonfrontation würde den Beginn eines neuen, friedlicheren Zeitalters markieren, sah sich getäuscht. Die Zeit nach dem Kalten Krieg war geprägt vom Zerfall der ehemals kommunistischen Vielvölkerstaaten, dem Völkermord in Ruanda oder auch den blutigen Bürgerkriegen in Sri Lanka, Kongo und Angola. Alle diese Kriege haben oder hatten eines gemeinsam, sie finden zwischen bewaffneten Gruppierungen innerhalb eines Staatsgebietes statt. Für diese Art von Konflikten hat Mary Kaldor den Begriff der „neuen Kriege“ geprägt um sie einerseits von den Konflikten während der Zeit des Kalten Krieges, welche zumeist Ausdruck des Systemkonflikts zwischen den beiden Blöcken waren, andererseits von den klassischen zwischenstaatlichen Kriegen abzugrenzen. Was aber zeichnet nun diese „neuen Kriege“ aus? In der vorliegenden Arbeit soll die Frage behandelt werden, ob diese „neuen Kriege“ wirklich neu sind oder, um mit Clausewitz zu sprechen, ob das „Chamäleon Krieg“ nur seine Farbe geändert hat, oder tatsächlich ein neues Tier geworden ist.
Grundlage der Ausführungen über die „neuen Kriege“ bilden größtenteils die Darstellungen Herfried Münklers, welcher sich in verschiedensten Publikationen umfassend mit der Thematik befasst. Daneben werden auch andere Autoren wie Kaldor, van Crefeld oder von Trotha ergänzend herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die „alten Kriege“
- 2.1. Krieg - Ein Begriff ohne klare Definition
- 2.2. Merkmale „alter Kriege“
- 3. Die „neuen Kriege“
- 3.1. Wandel der Kriegsformen seit 1945
- 3.2. Entstehung der Begrifflichkeit
- 4. Merkmale des Wandels
- 4.1. Asymmetrische Akteurskonstellationen - Staat gegen substaatlichen Akteur
- 4.2. Wandel der Gewaltakteure - Staatszerfall, Entstaatlichung und Privatisierung
- 4.3. Wandel der Gewaltmotive - Kriminalisierung, Ökonomisierung und Entpolitisierung
- 4.4. Wandel der Gewaltstrategien - Enthegung und Brutalisierung des Kriegsgeschehens
- 5. „Neuer Krieg“ – „Chamäleon“ oder neues Tier?
- 5.1. Das Merkmal der Asymmetrisierung der Gewaltakteure
- 5.2. Das Merkmal des Staatszerfalls, der Entstaatlichung und Privatisierung der Gewaltakteure
- 5.3. Das Merkmal der zunehmenden Ökonomisierung, und die damit einhergehende Entpolitisierung der Gewaltakteure
- 5.4. Das Merkmal der zunehmenden Enthegung und Brutalisierung des Kriegsgeschehens
- 6. Fazit und Ausblick
- 7. Literatur- und Quellenverzeichnis
- 8. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These der „neuen Kriege“ und hinterfragt, ob diese tatsächlich neuartig sind oder lediglich eine veränderte Form bereits bekannter Kriegsführung darstellen. Die Arbeit analysiert die Merkmale der „alten“ und „neuen“ Kriege und vergleicht diese miteinander.
- Definition und Merkmale „alter Kriege“
- Wandel der Kriegsformen seit 1945
- Merkmale des Wandels im Kontext der „neuen Kriege“ (Asymmetrie, Akteurskonstellationen, Gewaltmotive, Strategien)
- Vergleich der Merkmale: Neue Aspekte oder Wiederkehr alter Muster?
- Bewertung der These der „neuen Kriege“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „neuen Kriege“ ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach deren tatsächlicher Neuheit. Sie beschreibt den Wandel der geopolitischen Lage nach dem Kalten Krieg und die Herausforderungen durch lokale Konflikte und globalen Terrorismus. Der Begriff „neue Kriege“, geprägt von Mary Kaldor, wird eingeführt, und die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz, der den Vergleich von „alten“ und „neuen“ Kriegen umfasst.
2. Die „alten Kriege“: Dieses Kapitel legt den Grundstein für den Vergleich, indem es die „alten“ oder klassischen Kriege definiert und ihre Merkmale beschreibt. Die Schwierigkeit einer eindeutigen Definition von „Krieg“ wird angesprochen, bevor zentrale Merkmale klassischer Kriege herausgearbeitet werden. Der Fokus liegt darauf, einen Vergleichsmaßstab für die nachfolgende Analyse der „neuen Kriege“ zu schaffen.
3. Die „neuen Kriege“: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Wandel der Kriegsformen seit 1945 und der Entstehung des Begriffs „Neuer Krieg“. Es werden die Veränderungen in der Art der Kriegsführung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beleuchtet, um den Hintergrund für die Entwicklung des Konzepts der „neuen Kriege“ zu etablieren. Der Fokus liegt auf der Entstehung der Begrifflichkeit und den historischen Kontext.
4. Merkmale des Wandels: Dieses Kapitel präsentiert die von verschiedenen Autoren als entscheidend angesehenen Aspekte des Wandels, die die „neuen Kriege“ kennzeichnen. Hier werden die Veränderungen in den Akteurskonstellationen, den Gewaltmotiven und -strategien detailliert untersucht, um ein umfassendes Bild der Veränderungen im Wesen der Kriegsführung zu liefern. Die verschiedenen Merkmale werden prägnant und verständlich erklärt.
5. „Neuer Krieg“ – „Chamäleon“ oder neues Tier?: Dieses Kapitel analysiert die in Kapitel 4 beschriebenen Merkmale im Detail und bewertet, ob sie tatsächlich neue Aspekte darstellen oder lediglich eine Wiederkehr bekannter Phänomene aus vergangenen Kriegen sind. Es handelt sich um eine tiefgehende kritische Auseinandersetzung mit der zentralen Forschungsfrage. Die Kapitel 4 und 5 bilden den Kern der Argumentation.
Schlüsselwörter
Neue Kriege, Alte Kriege, Kriegsdefinition, Asymmetrische Konflikte, Staatszerfall, Entstaatlichung, Privatisierung, Gewaltmotive, Gewaltstrategien, Ökonomisierung, Entpolitisierung, Kaldor, Münkler, Systemkonflikt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der "Neuen Kriege"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die These der „neuen Kriege“ und untersucht, ob diese tatsächlich neuartig sind oder ob es sich lediglich um eine veränderte Form bereits bekannter Kriegsführung handelt. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Merkmale von „alten“ und „neuen“ Kriegen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Merkmale „alter Kriege“, der Wandel der Kriegsformen seit 1945, die Merkmale des Wandels im Kontext der „neuen Kriege“ (Asymmetrie, Akteurskonstellationen, Gewaltmotive und -strategien), ein Vergleich der Merkmale (neue Aspekte oder Wiederkehr alter Muster?) und eine abschließende Bewertung der These der „neuen Kriege“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, „Alte Kriege“, „Neue Kriege“, Merkmale des Wandels, „Neuer Krieg“ – „Chamäleon“ oder neues Tier?, Fazit und Ausblick, sowie ein Literatur- und Quellenverzeichnis und ein Anhang. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit der Definition von Krieg und der Analyse klassischer Kriegsführung, bis hin zur detaillierten Untersuchung der Merkmale der „neuen Kriege“ und einer kritischen Bewertung der zugrundeliegenden These.
Was sind die zentralen Merkmale der „alten Kriege“?
Die Arbeit definiert und beschreibt zunächst die Merkmale klassischer Kriege, um einen Vergleichsmaßstab für die „neuen Kriege“ zu schaffen. Die genaue Definition von „Krieg“ wird dabei als schwierig erachtet und diskutiert.
Welche Merkmale kennzeichnen die „neuen Kriege“?
Die „neuen Kriege“ werden durch verschiedene Merkmale charakterisiert, die in der Arbeit detailliert untersucht werden: asymmetrische Akteurskonstellationen (Staat gegen nicht-staatliche Akteure), Staatszerfall, Entstaatlichung und Privatisierung von Gewalt, der Wandel der Gewaltmotive (Kriminalisierung, Ökonomisierung und Entpolitisierung) sowie der Wandel der Gewaltstrategien (Enthegung und Brutalisierung).
Wie werden „alte“ und „neue“ Kriege verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Merkmale der „alten“ und „neuen“ Kriege, um die Frage nach der tatsächlichen Neuheit der „neuen Kriege“ zu beantworten. Der Vergleich konzentriert sich auf die Aspekte der Asymmetrie, der Akteurskonstellationen, der Gewaltmotive und -strategien. Es wird untersucht, ob die Merkmale der „neuen Kriege“ tatsächlich neuartig sind oder ob es sich um eine Wiederkehr bekannter Phänomene handelt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit und der Ausblick fassen die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewerten die These der „neuen Kriege“. Die Arbeit hinterfragt kritisch, ob der Begriff „Neuer Krieg“ treffend ist oder ob er eher als veränderte Form der Kriegsführung zu verstehen ist. Die zentralen Argumente und die Ergebnisse des Vergleichs von „alten“ und „neuen“ Kriegen werden hier zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter der Arbeit sind: Neue Kriege, Alte Kriege, Kriegsdefinition, Asymmetrische Konflikte, Staatszerfall, Entstaatlichung, Privatisierung, Gewaltmotive, Gewaltstrategien, Ökonomisierung, Entpolitisierung, Kaldor, Münkler und Systemkonflikt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich mit den Themen Krieg, Konfliktforschung und Geopolitik auseinandersetzen. Die Arbeit bietet eine strukturierte und umfassende Analyse der „neuen Kriege“ und liefert wichtige Erkenntnisse für das Verständnis moderner Konflikte.
- Quote paper
- Magister Artium Sebastian Schütz (Author), 2006, Sind "neue Kriege" wirklich neu? Über Theorien zur Veränderung im weltweiten Kriegsgeschehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64240