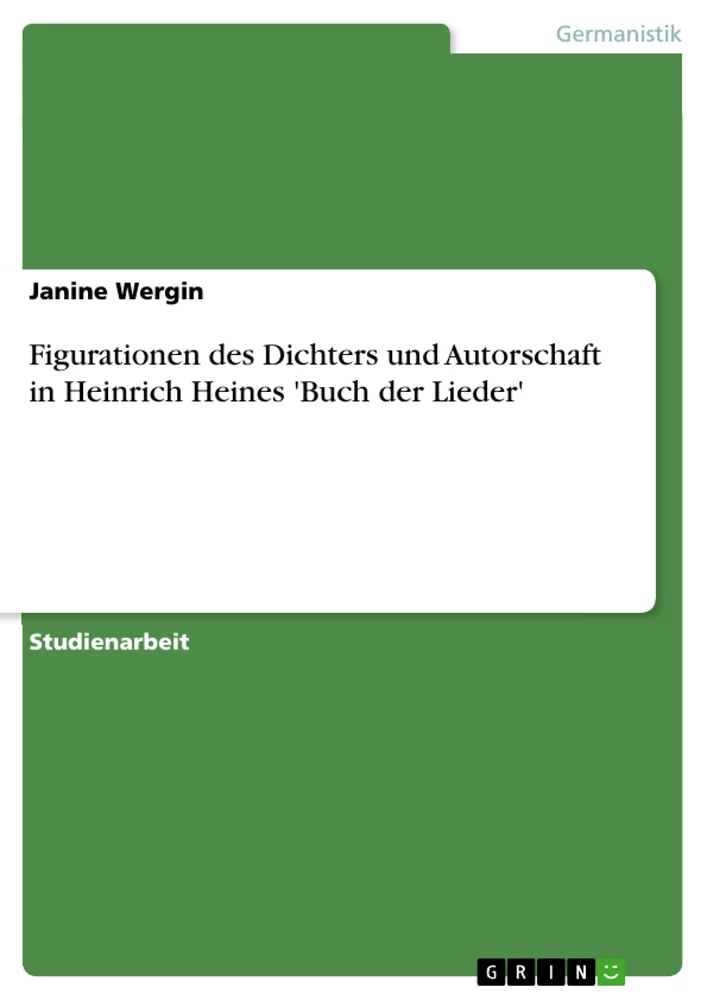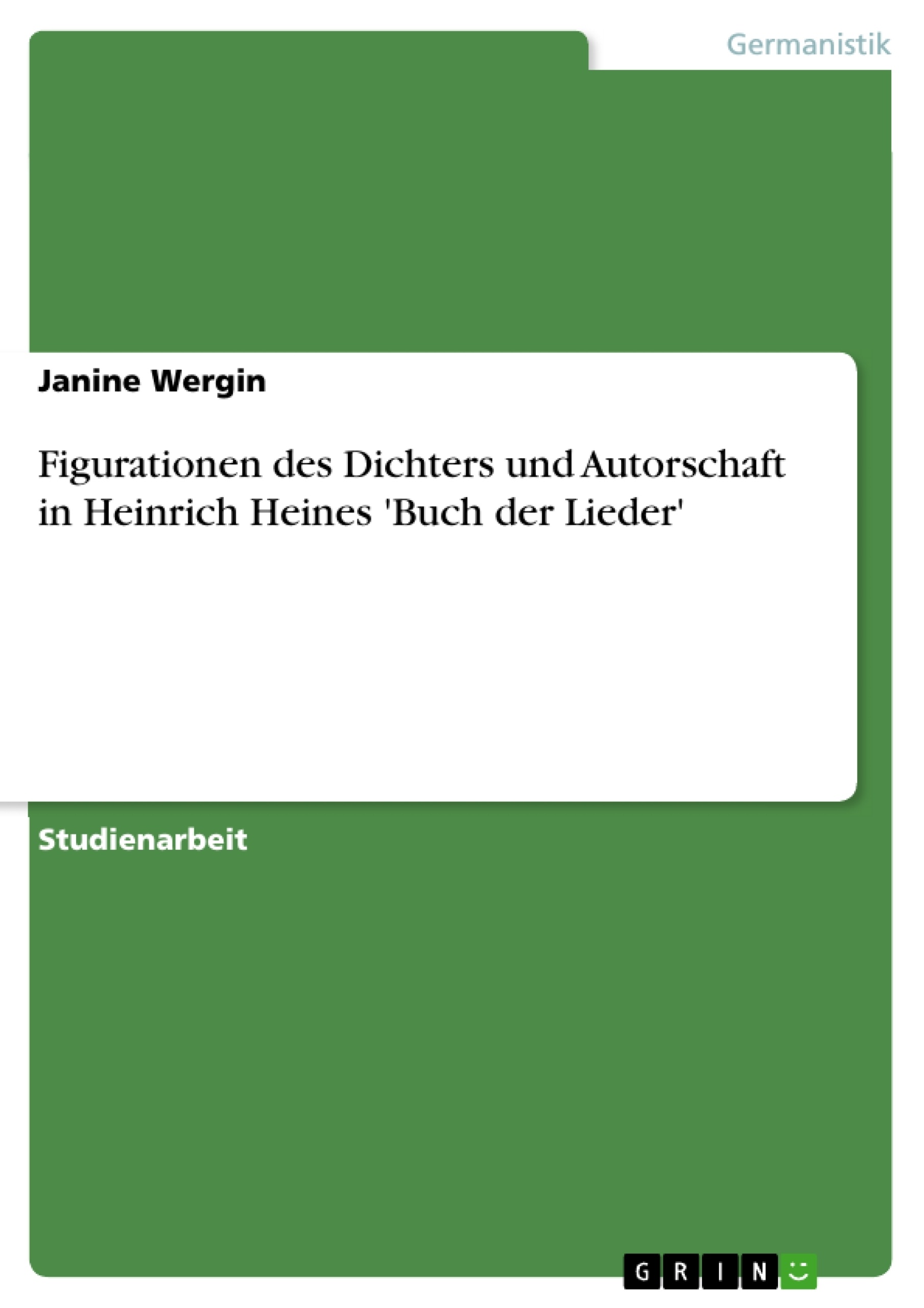Heinrich Heine hat die Poetik selbst immer wieder zum Thema des Dichtens gemacht. Gemäß Karl-Heinz Fingerhut finden sich vor allem in seinen lyrischen Zyklen in fast regelmäßiger Wiederkehr Lieder, „die die poetologische Konzeption, nach der Heine die sie umgebende Lyrik verstanden wissen möchte, selbst poetisch behandeln.“ Viele Gedichte beinhalten nicht nur ein poetisches Programm, sondern auch Selbstdarstellungen des Lyrikers und gehören damit in den Bereich der Stilisierung des lyrischen Ichs. Diese Arbeit beschäftigt sich speziell mit den poetologischen Gedichten im Buch der Lieder (1827). Neben den Figurationen des Dichters wird in einem zweiten Teil des Aufsatzes die Problematik der Autorschaft des Buches der Lieder behandelt. Die Analyse zeigt, dass Heines Gedichte offenbar bewusst in der Schwebe zwischen Kollektivität und Originalität, Tradiertem und Gemachtem, gehalten sind. Durch den starken Bezug auf das Volkstümliche wird eine kollektive Autorschaft evoziert. Zugleich betont Heine die Originalität seiner Dichtungen auf vielfache Weise.
Inhaltsverzeichnis
- Untersuchungsgegenstand
- Dichterbilder im Buch der Lieder
- Der aus dem Erlebnis schaffende Dichter
- Der an Liebes- und Weltschmerz leidende Dichter
- Die ironische Selbstdarstellung des Poeten
- Zur Ambivalenz von Originalität und Kollektivität im Buch der Lieder
- Kollektivität
- Originalität
- Zur ästhetischen Strategie Heines
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die poetologischen Gedichte im Buch der Lieder von Heinrich Heine, insbesondere die Figurationen des Dichters und die Problematik der Autorschaft. Sie analysiert, wie Heine die Rolle des lyrischen Ichs inszeniert und wie er die Ambivalenz zwischen Kollektivität und Originalität in seinen Gedichten thematisiert.
- Dichterbilder im Buch der Lieder
- Poetische Strategien und Selbstinszenierung
- Ambivalenz von Originalität und Kollektivität
- Beziehung zwischen Erlebnis und Dichtung
- Heines Umgang mit der Tradition und Innovation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt den Fokus auf den Untersuchungsgegenstand und definiert die Bereiche, die in der Analyse des Buches der Lieder im Vordergrund stehen. Es werden die beiden wichtigsten Themenkreise in Heines poetologischen Gedichten, Liebeslyrik und engagierte Lyrik, vorgestellt und die besondere Bedeutung der Liebeslyrik im Buch der Lieder hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Dichterbilder im Buch der Lieder beleuchtet. Dabei werden die Figurationen des aus dem Erlebnis schaffenden Dichters, des Sängers, des Märtyrers, des an Welt- und Liebesschmerz leidenden Poeten und des Selbstkritikers und -ironikers analysiert. Die Arbeit zeigt, wie Heine die Authentizität des lyrischen Ichs inszeniert und gleichzeitig die Grenzen zwischen Realität und Fiktion aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Heineschen Poetik, insbesondere mit den Dichterbildern, der Ambivalenz von Originalität und Kollektivität sowie den poetologischen Strategien, die Heine im Buch der Lieder verwendet. Zu den zentralen Begriffen gehören: Dichterfigur, lyrisches Ich, Erlebnislyrik, Kollektivität, Originalität, Authentizität, Ironie, Selbstinszenierung und poetische Strategie. Die Arbeit analysiert, wie diese Konzepte in Heines Gedichten zusammenspielen und welche Auswirkungen sie auf die Interpretation des Buches der Lieder haben.
Häufig gestellte Fragen
Was sind poetologische Gedichte bei Heinrich Heine?
Das sind Gedichte, in denen Heine das Dichten selbst und seine Konzepte von Lyrik thematisiert und reflektiert.
Wie inszeniert Heine das lyrische Ich im „Buch der Lieder“?
Heine nutzt verschiedene Rollen, vom leidenden Liebhaber bis zum ironischen Selbstkritiker, um die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu verwischen.
Was bedeutet die Ambivalenz von Originalität und Kollektivität?
Heine spielt mit volkstümlichen Traditionen (Kollektivität), betont aber gleichzeitig seine schöpferische Einzigartigkeit als moderner Autor (Originalität).
Warum nutzt Heine Ironie in seiner Selbstdarstellung?
Die Ironie dient dazu, die romantische Gefühlsduselei zu brechen und eine kritische Distanz zum eigenen Werk und zur Tradition herzustellen.
Welche Rolle spielt das „Volkstümliche“ in Heines Werk?
Es evoziert eine scheinbare kollektive Autorschaft, die Heine jedoch bewusst kunstfertig konstruiert und modifiziert.
- Arbeit zitieren
- Janine Wergin (Autor:in), 2006, Figurationen des Dichters und Autorschaft in Heinrich Heines 'Buch der Lieder', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64281