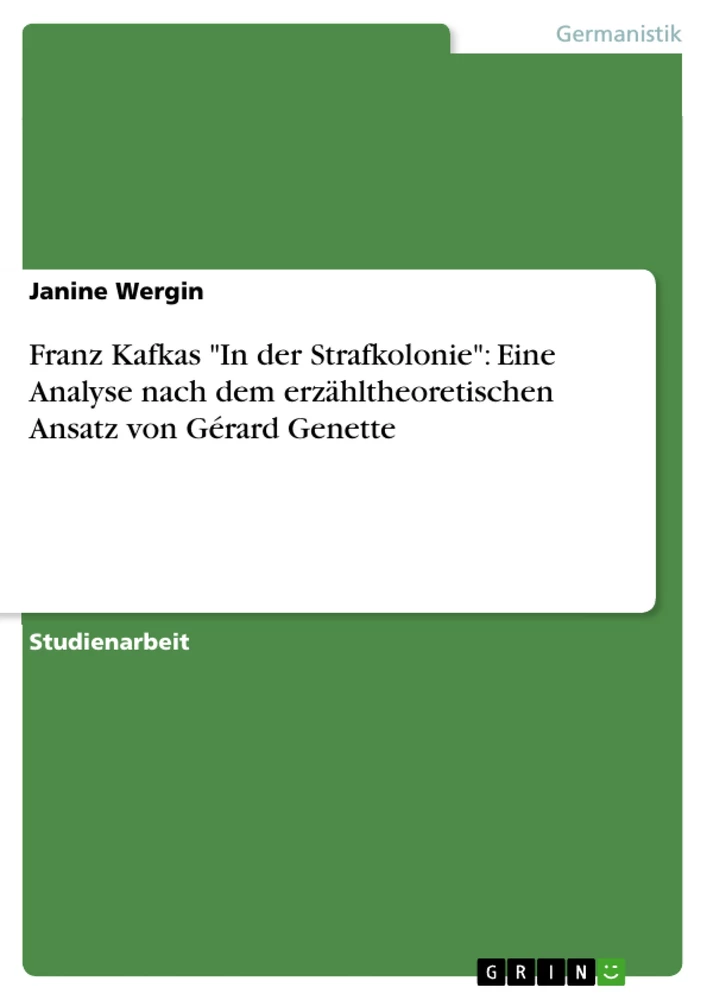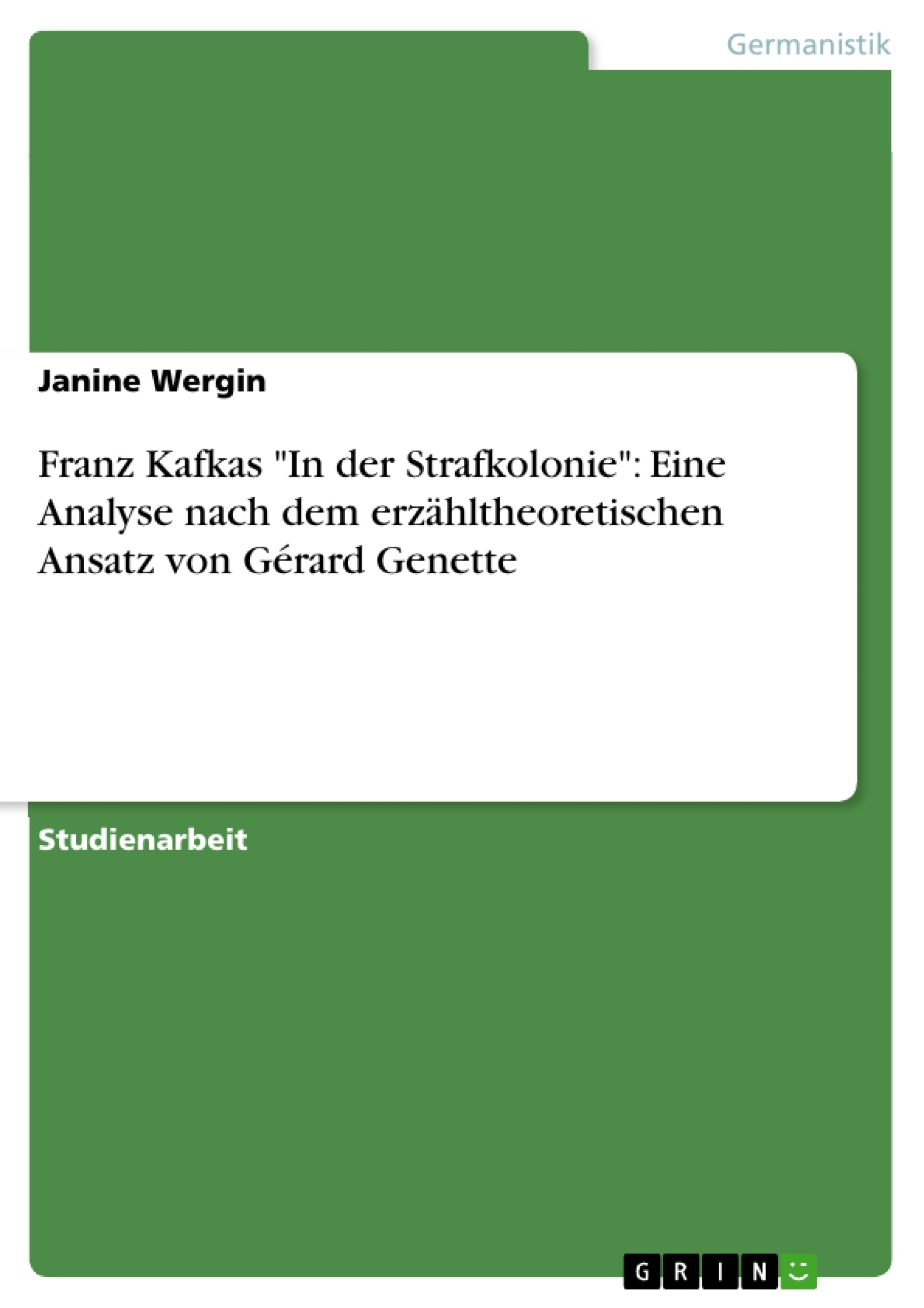Die Erzählforschung hat seit den 60er Jahren zahlreiche neue Termini und Systeme für die Analyse von Erzähltexten entwickelt. Der französische Strukturalist Gérard Genette hat 1972 ein Modell zur Analyse vorgelegt, das in der Literaturwissenschaft allgemein Anerkennung findet. Jonathan Culler wertet Genettes Discours du récit als "bislang gründlichste[n] Versuch, die Grundlagen und Techniken des literarischen Erzählens zu analysieren, zu benennen und zu veranschaulichen" Genette lenke die Aufmerksamkeit auf Strukturen und Techniken der Fiktion, die zuvor nicht wahrgenommen wurden oder deren Bedeutung nicht erkannt worden sei. Die Frage nach dem Gebrauchswert von Genettes Ansatz beantwortet Jochen Vogt im Nachwort zur deutschen Ausgabe: Es handle sich um eine "hochgradig praktikable Theorie der literarischen Erzählung".
Im Folgenden soll Franz Kafkas Erzählung "In der Strafkolonie" von 1914 erzähltheoretisch analysiert werden. Genettes "Die Erzählung" dient als Grundlage dieser Untersuchung. Das von ihm entwickelte Modell wird auf seine Anwendbarkeit überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeit
- Erzählzeit und erzählte Zeit
- Zeitliche Ordnung
- Dauer
- Frequenz
- Modus
- Distanz
- Fokalisierung
- Stimme
- Zeit der Narration
- Person
- Narrative Ebenen
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Franz Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ anhand des erzähltheoretischen Ansatzes von Gérard Genette. Ziel ist es, die Anwendbarkeit von Genettes Modell auf Kafkas Text zu überprüfen und dabei die spezifischen Erzähltechniken Kafkas herauszuarbeiten. Die Analyse konzentriert sich auf das „Wie“ der Erzählung, also die Darstellung des Geschehens, und lässt das „Was“, den Inhalt und seine Bedeutung, außer Betracht.
- Anwendung von Genettes Erzähltheorie auf Kafkas Werk
- Analyse der Zeitstrukturen in "In der Strafkolonie"
- Untersuchung der Modi der Darstellung bei Kafka
- Erforschung der narrativen Stimme und ihrer Funktion
- Herausarbeitung der spezifischen Erzählweise Kafkas
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der erzähltheoretischen Analyse ein und stellt Gérard Genettes Modell als Grundlage der Untersuchung vor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Analyse der Erzähltechnik in Kafkas „In der Strafkolonie“, wobei die erzählte Geschichte selbst (das „Was“) zugunsten des „Wie“ der Erzählung zurücktritt. Die Einleitung skizziert kurz den Inhalt der Erzählung und hebt die zentrale Frage nach dem grausamen Hinrichtungsapparat hervor. Die methodische Herangehensweise nach Genette wird erläutert, wobei die Kategorien Zeit, Modus und Stimme als analytische Werkzeuge angekündigt werden.
Zeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse der Zeitstrukturen in Kafkas Erzählung. Es beginnt mit der Unterscheidung zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit, wobei der enorme Unterschied zwischen dem Umfang des Textes und dem in ihm dargestellten Zeitraum hervorgehoben wird. Die Analyse konzentriert sich insbesondere auf die zeitliche Ordnung, die durch Analepsen und Prolepsen gekennzeichnet ist, und auf die Dauer der einzelnen Erzählsegmente. Die Schwierigkeit der Segmentierung des Textes aufgrund der häufigen, kurzen Analepsen wird thematisiert. Die Kapitelstruktur wird detailliert beschrieben, um die zeitliche Ordnung zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, In der Strafkolonie, Erzähltheorie, Gérard Genette, Zeit, Modus, Stimme, Erzählzeit, erzählte Zeit, Anachronie, Analepse, Prolepse, narrative Ebenen, Hinrichtungsapparat, Strafsystem.
Häufig gestellte Fragen zu Kafkas "In der Strafkolonie" - Erzählanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Franz Kafkas Erzählung "In der Strafkolonie" unter Verwendung der erzähltheoretischen Ansätze von Gérard Genette. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung des Geschehens (dem "Wie") und nicht auf dem Inhalt und dessen Bedeutung (dem "Was"). Die Arbeit untersucht die Anwendung von Genettes Modell auf Kafkas Text und beleuchtet dessen spezifische Erzähltechniken.
Welche Aspekte der Erzähltheorie werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf Genettes Kategorien Zeit, Modus und Stimme. Im Einzelnen werden untersucht: Erzählzeit und erzählte Zeit, die zeitliche Ordnung (inklusive Analepsen und Prolepsen), die Dauer und Frequenz der Erzählung, die Distanz und Fokalisierung, die Zeit der Narration, die Person der Erzählstimme und die narrativen Ebenen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Zeit, Modus und Stimme, ein Kapitel zu narrativen Ebenen und ein Schlusswort. Die Einleitung präsentiert Genettes Modell und den methodischen Ansatz. Die Kapitel behandeln jeweils die entsprechenden Aspekte der Erzähltheorie im Kontext von Kafkas "In der Strafkolonie".
Welche konkreten Themen werden in den Kapiteln behandelt?
Das Kapitel "Zeit" analysiert die Zeitstrukturen, unterscheidet zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit und untersucht die zeitliche Ordnung anhand von Analepsen und Prolepsen. Das Kapitel "Modus" befasst sich mit Distanz und Fokalisierung der Erzählung. Das Kapitel "Stimme" analysiert die Zeit der Narration und die Person der Erzählstimme. Die Kapitelstruktur dient der Verdeutlichung der zeitlichen Ordnung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Franz Kafka, In der Strafkolonie, Erzähltheorie, Gérard Genette, Zeit, Modus, Stimme, Erzählzeit, erzählte Zeit, Anachronie, Analepse, Prolepse, narrative Ebenen, Hinrichtungsapparat, Strafsystem.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel ist es, die Anwendbarkeit von Genettes Modell auf Kafkas "In der Strafkolonie" zu überprüfen und die spezifischen Erzähltechniken Kafkas herauszuarbeiten. Die Arbeit soll zeigen, wie Genettes Theorie zur Analyse von Kafkas Erzählweise beitragen kann.
- Arbeit zitieren
- Janine Wergin (Autor:in), 2004, Franz Kafkas "In der Strafkolonie": Eine Analyse nach dem erzähltheoretischen Ansatz von Gérard Genette, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64345