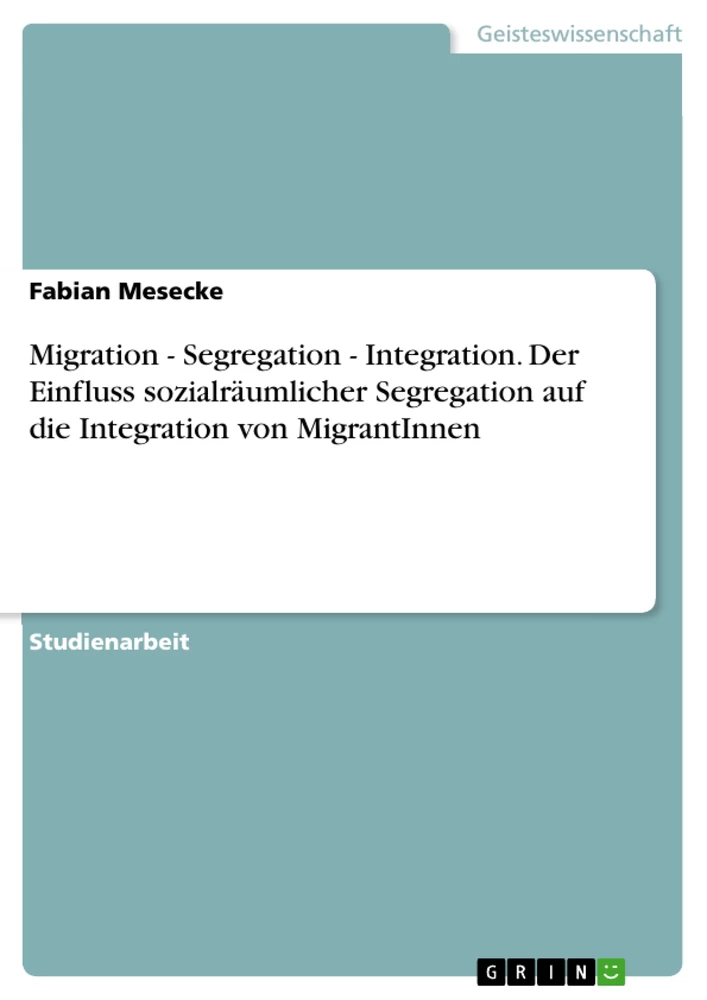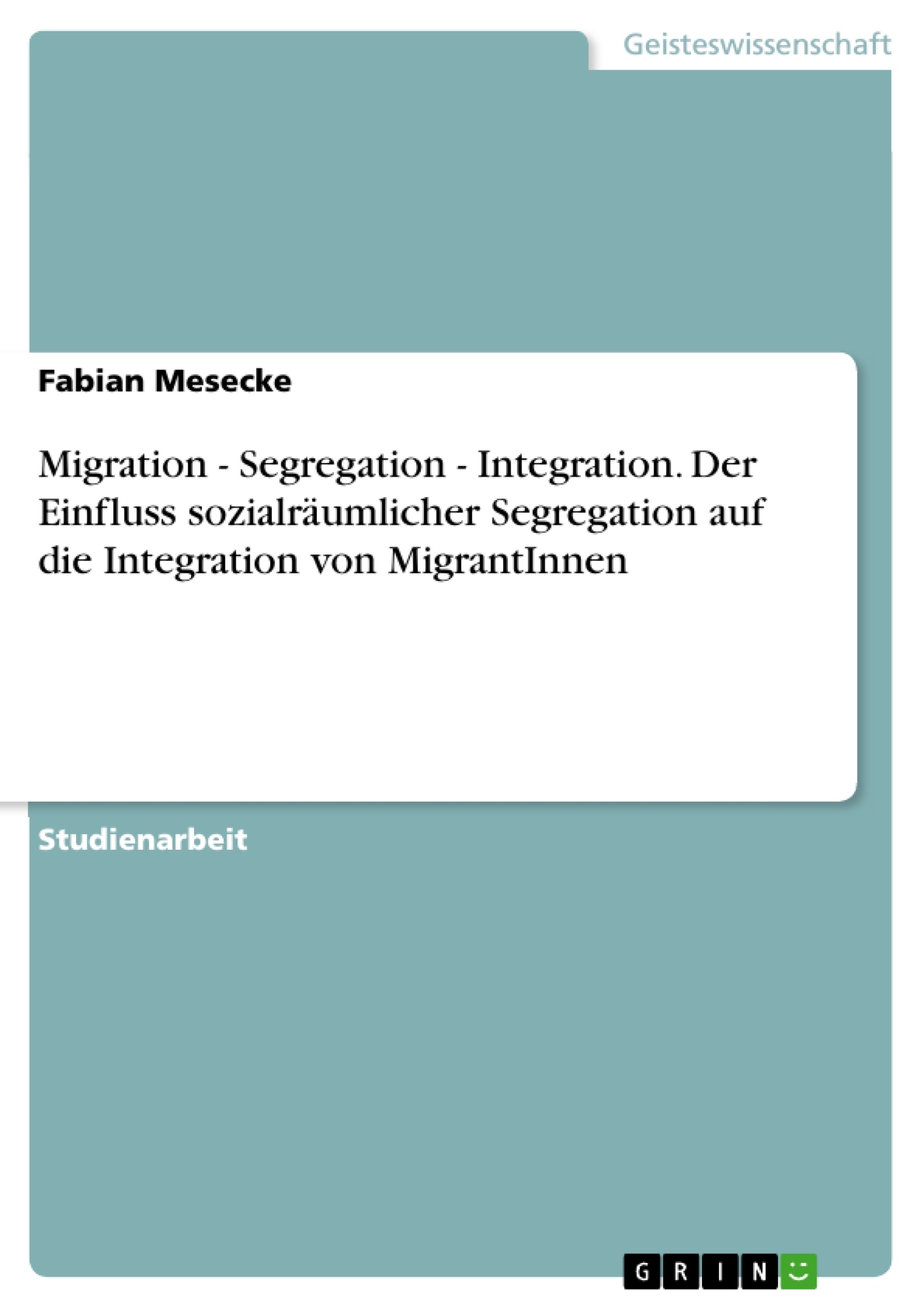Im Juli 2007 fand der so genannte Integrationsgipfel statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel lud mehr als 80 Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Kirchen und Zuwanderern ins Kanzleramt ein, um einen nationalen Integrationsplan zu erarbeiten. Auf die politische Agenda gelangte das Thema Integration zuvor im März dieses Jahres durch Medienberichte über die Rütli- Schule im Berliner Stadtteil Neukölln. Deren Lehrer übten über die Öffentlichkeit Druck auf die Berliner Schulbehörde aus, um auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen, die sie durch einen besonders hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund bei gleichzeitigem Personalmangel verursacht sahen. Der Stadtteil Neukölln weist im Vergleich zur Stadt Berlin mit 20,3% einen überdurchschnittlich hohen statistischen Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung auf. Schon weit vor diesem Ereignis wurde das Thema Integration im Rahmen eines anderen Politikfeldes dazu benutzt Aufgeregtheit zu erzeugen. Nämlich im öffentlichen Diskurs um die Gefährdung der inneren Sicherheit durch eingewanderten islamisch inspirierten Terrorismus, der unter anderem durch die Ermordung des niederländischen Filmemachers Theo van Gogh im November 2004 ausgelöst wurde. Der Begriff Parallelgesellschaften wurde zum Schlagwort. Zurück geht dieser auf Heitmeyer, der bereits 1996 auf das Problem hinwies, das drohe, wenn sich „ökonomische Ausgrenzungen mit kulturellen Abschottungen und religiös-politischer Propaganda verbindet“. Dann nämlich bestehe die Gefahr einer „schwer durchschaubare(n) Parallelgesellschaft am Rande der Mehrheitsgesellschaft“, so Heitmeyer. Im öffentlichen Diskurs wurde der Begriff allerdings seiner Komplexität beraubt. So wurden bereits segregierte Stadtquartiere mit einem hohen Anteil an Muslimen als eine Gefahr betrachtet (vgl. Gestring 2005: 3) . Die geschilderten Ereignisse lösten eine politische und mediale Debatte um das Thema Integration aus. In beiden Fällen wurde der räumlichen Konzentration ethnisch-kultureller Gruppen Einfluss auf die Integration ihrer Mitglieder in die Aufnahmegesellschaft unterstellt. Ob diese Annahme berechtigt ist, untersuche ich im Rahmen dieser Hausarbeit anhand verschiedener Integrationsansätze.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff der Segregation
- 2.1 Quantifizierbarkeit
- 2.2 Ursachen
- 2.3 Formen und Entwicklung
- 2.4 Quartierseffekte
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Zum Begriff der Integration
- 3.1 Die Stadt als Ort der Integration
- 3.2 Integrationsmodelle
- 3.2.1 Parks race-relations-cycle
- 3.2.2 Gordons Assimilationsmodell
- 3.2.3 Integration bei Esser
- 3.3 Zusammenfassung
- 4. Segregationseffekte
- 4.1 Vorteile für die Integration von MigrantInnen
- 4.2 Nachteile für die Integration von MigrantInnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss sozialräumlicher Segregation auf die Integration von MigrantInnen in Deutschland. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung von Segregation, untersucht verschiedene Integrationsmodelle und untersucht, wie Segregation die Integration von MigrantInnen beeinflusst.
- Der Begriff der Segregation und seine Quantifizierbarkeit
- Die Ursachen und Formen von Segregation in deutschen Städten
- Die Rolle der Stadt in der Integration von MigrantInnen
- Verschiedene Integrationsmodelle und ihre Auswirkungen
- Die Auswirkungen von Segregation auf die Integration von MigrantInnen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und zeigt die Relevanz der sozialräumlichen Segregation im Kontext der Integrationsdebatte auf.
Kapitel 2 untersucht den Begriff der Segregation, analysiert seine Ursachen und zeigt verschiedene Formen und Entwicklungen in Deutschland auf. Besonderes Augenmerk liegt auf den Quartierseffekten, die durch die Konzentration bestimmter sozialer Gruppen in bestimmten Stadtgebieten entstehen.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Begriff der Integration und der Bedeutung der Stadt in diesem Prozess. Es werden verschiedene Integrationsmodelle vorgestellt, die den Verlauf des Integrationsprozesses beleuchten.
Kapitel 4 verbindet die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel und analysiert die Auswirkungen der residentiellen Segregation auf den Prozess der Integration von MigrantInnen. Es werden sowohl positive als auch negative Effekte untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Segregation und Integration, wobei insbesondere die sozialräumliche Segregation und ihre Auswirkungen auf die Integration von MigrantInnen im Vordergrund stehen. Weitere wichtige Begriffe sind: Stadtentwicklung, Integrationsmodelle, Quartierseffekte, ethnisch-kulturelle Gruppen, Parallelgesellschaften, und Ausländeranteil.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet sozialräumliche Segregation?
Segregation beschreibt die ungleiche Verteilung von Bevölkerungsgruppen im Stadtraum, oft nach ethnischen oder sozialen Merkmalen (z. B. „Problemviertel“).
Was versteht man unter „Parallelgesellschaften“?
Der Begriff bezieht sich auf die Abschottung von Minderheiten von der Mehrheitsgesellschaft, oft bedingt durch ökonomische Ausgrenzung und kulturelle oder religiöse Rückzugsräume.
Beeinflusst das Wohnquartier die Integration von Migranten?
Ja, die Arbeit untersucht sogenannte „Quartierseffekte“. Diese können negativ (mangelnde Sprachpraxis) oder positiv (soziale Netzwerke und Starthilfe) auf die Integration wirken.
Welche Integrationsmodelle werden in der Forschung genutzt?
Wichtige Modelle sind der „Race-relations-cycle“ von Park, das Assimilationsmodell von Gordon und die Integrationstheorie von Hartmut Esser.
Hat Segregation auch Vorteile für Migranten?
In räumlich konzentrierten Gebieten können ethnische Ökonomien und soziale Infrastrukturen den Einstieg in die Aufnahmegesellschaft erleichtern (soziale Brückenfunktion).
- Arbeit zitieren
- Fabian Mesecke (Autor:in), 2006, Migration - Segregation - Integration. Der Einfluss sozialräumlicher Segregation auf die Integration von MigrantInnen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64379