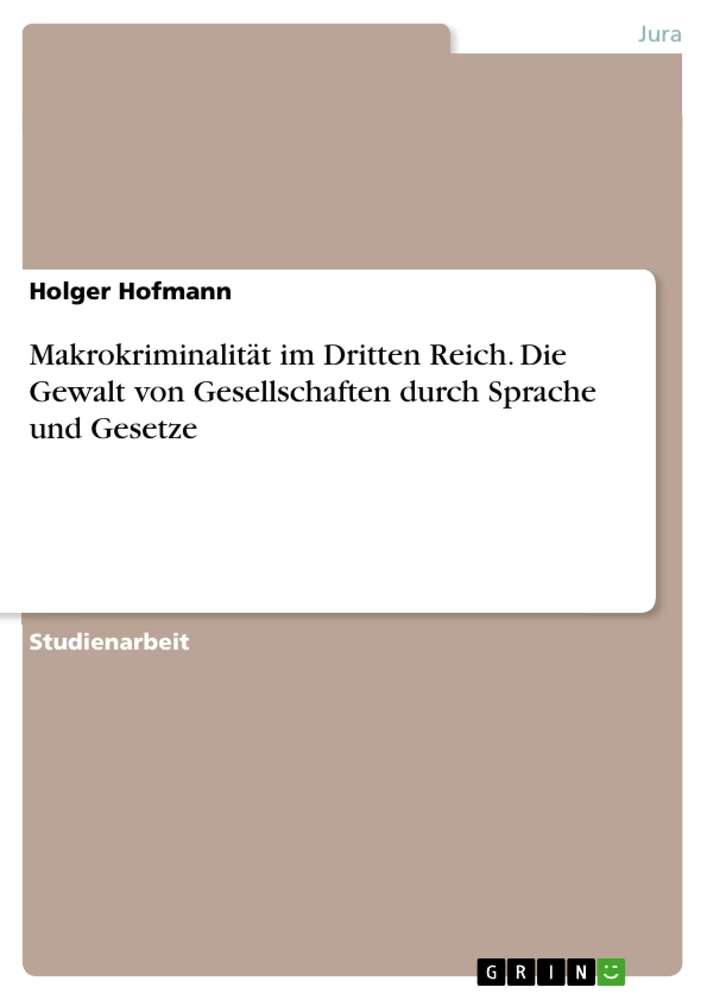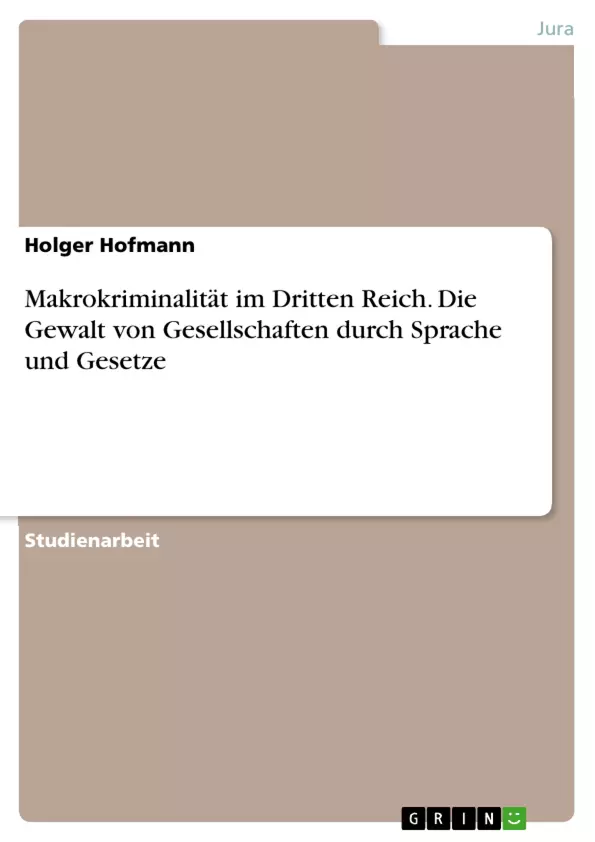Das originäre Forschungsgebiet der Kriminologie ist die individuelle Kriminalität, gekennzeichnet durch das abweichende Verhalten einzelner Personen (Devianz). Indes werden die schlimmsten Verbrechen in den allermeisten Fällen nicht von abweichenden Einzelkämpfern begangen, sondern von Menschen, die in Kollektiven tätig sind und in diesen Kollektiven durchaus konform handeln. Das offenkundigste Beispiel hierfür dürfte der Nationalsozialismus sein. Gleichwohl wird die kollektive Kriminalität in der Kriminologie bislang nur stiefmütterlich behandelt. Diesem Missstand hatHerbert Jägerentgegengewirkt, der für die kollektive Verbrechensdimension den Begriff der „Makrokriminalität“ eingeführt hat. Darunter versteht er beispielsweise Kriegsverbrechen, Völkermord oder Staatsterrorismus, gemeint sind also die „Großformen des Verbrechens“ mit regelmäßig verheerendem Ausmaß. Gemeinsames Merkmal aller makrokriminellen Erscheinungen ist in der Terminologie Jägers aber nicht etwa die außerordentliche Schadensdimension eines Verbrechens, sondern die Größenordnung des Täterkollektivs. Mit „Makrokriminalität“ habe man es dann zu tun, „wenn sich die kollektiven Taten als Teilakte gesamtgesellschaftlicher Konflikte und Prozesse darstellen, Staat und Gesellschaft also durch ihre auslösende Bedeutung unmittelbar in die kriminellen Ereignisse involviert sind“6. Entscheidend ist also die Abhängigkeit der individuellen Handlung von den Geschehnissen der Makroebene, etwa von „politischen Ausnahmebedingungen“7.
Hier sollen nun am konkreten Beispiel des Dritten Reichs insbesondere zwei Phänomene näher untersucht werden, die dieser Makroebene zuzuordnen sind und als das Verbrechen begünstigende makrokriminelle Faktoren in Betracht kommen: einerseits die Sprache in der nationalsozialistischen Gesellschaft (III.) und andererseits die Gesetzgebung im nationalsozialistischen Staat (IV).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Der Begriff der „Makrokriminalität“
- II. Sprache und Gesetze als Form der mittelbaren Gewalt
- III. Gewalt durch Sprache (Propaganda)
- 1. Antisemitische Tendenzen vor der Machtergreifung
- 2. Gewalt durch Sprache im Nationalsozialismus: Propaganda
- 3. Beispiel: die polnischsprachige Propagandapresse im Generalgouvernement der Jahre 1939-1945 („,gadzinówki\")
- 4. Wirkungen der Propaganda
- IV. Gewalt durch Gesetze
- 1. Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“
- 2. Die „Heimtückeverordnung“ und das „Heimtückegesetz“
- 3. Die „Nürnberger Rassegesetze❝
- a. Das Reichsbürgergesetz
- b. Das „Blutschutzgesetz“
- 4. Auswirkungen der Gesetze
- V. Ergebnis und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen der „Makrokriminalität“, das von Herbert Jäger geprägt wurde, um kollektive Kriminalität wie Völkermord oder Staatsterrorismus zu beschreiben. Ziel ist es, die Rolle von Sprache und Gesetzgebung im Nationalsozialismus als mittelbare Gewaltformen zu analysieren und aufzuzeigen, wie diese Faktoren zur Begünstigung von Verbrechen im Dritten Reich beitrugen.
- Die Definition und Bedeutung von „Makrokriminalität“
- Sprache und Gesetze als Formen der mittelbaren Gewalt
- Die Rolle der Propaganda im Nationalsozialismus
- Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Gesetzgebung
- Der Zusammenhang zwischen Sprache, Gesetzgebung und Gewalt im Dritten Reich
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Der Begriff der „Makrokriminalität“
Dieses Kapitel führt den Begriff der „Makrokriminalität“ ein, der von Herbert Jäger geprägt wurde, um die kollektive Kriminalität im Gegensatz zur individuellen Devianz zu beschreiben. Es werden Beispiele für Makrokriminalität wie Kriegsverbrechen, Völkermord und Staatsterrorismus genannt und die Merkmale dieser Erscheinungen erläutert. Die Arbeit fokussiert auf das Beispiel des Dritten Reichs und untersucht die Rolle von Sprache und Gesetzen als Faktoren der Makrokriminalität.
II. Sprache und Gesetze als Form der mittelbaren Gewalt
Das Kapitel betont, dass Sprache und Gesetze zwar nicht direkt verantwortlich für die Gewalt im Nationalsozialismus sind, aber eine wichtige Rolle als mittelbare Gewaltformen spielen. Die Arbeit differenziert zwischen direkter und mittelbarer Gewalt und argumentiert, dass Sprache und Gesetzgebung zwar keine körperliche Gewalt darstellen, aber eine prägende Wirkung auf die Ausübung von Gewalt haben können.
III. Gewalt durch Sprache (Propaganda)
Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Propaganda im Nationalsozialismus als Form der Gewalt durch Sprache. Es werden antisemitische Tendenzen in der Sprache vor der Machtergreifung und die Ausgestaltung der Propaganda im Nationalsozialismus selbst analysiert. Das Kapitel geht auf die Verwendung von Tiervergleichen und Vernichtungsphantasien ein, die zur Entmenschlichung der Juden beitrugen.
IV. Gewalt durch Gesetze
Dieser Teil der Arbeit analysiert die nationalsozialistische Gesetzgebung und ihre Auswirkungen auf die Gewalt im Dritten Reich. Es werden Gesetze wie das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, die „Heimtückeverordnung“ und das „Heimtückegesetz“ sowie die „Nürnberger Rassegesetze“ beleuchtet und ihre Bedeutung für die systematische Diskriminierung und Verfolgung der Juden erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Makrokriminalität, Gewalt, Sprache, Propaganda, Gesetzgebung, Nationalsozialismus, Antisemitismus, Judenverfolgung, Rassegesetze, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Rolle von Sprache und Gesetzen als Faktoren der mittelbaren Gewalt im Kontext des Dritten Reichs.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert den Begriff "Makrokriminalität"?
Der von Herbert Jäger geprägte Begriff beschreibt Großformen des Verbrechens wie Völkermord oder Staatsterrorismus, bei denen nicht Einzeltäter, sondern Kollektive (Staat/Gesellschaft) unmittelbar involviert sind.
Wie wirkte Sprache als Form der Gewalt im Nationalsozialismus?
Durch Propaganda, Entmenschlichung (z.B. Tiervergleiche) und Vernichtungsphantasien schuf die Sprache die psychologische Basis für die spätere physische Gewalt und Verfolgung.
Welche Rolle spielten Gesetze bei der Ausübung von Makrokriminalität?
Gesetze wie die Nürnberger Rassegesetze oder das Heimtückegesetz dienten als Instrumente der systematischen Diskriminierung und gaben dem staatlichen Unrecht einen legalen Anschein.
Was war die Funktion der "gadzinówki" im besetzten Polen?
Dies war die polnischsprachige Propagandapresse im Generalgouvernement (1939-1945), die dazu diente, die Bevölkerung im Sinne der Besatzer zu beeinflussen.
Was unterscheidet Makrokriminalität von individueller Kriminalität?
Während individuelle Kriminalität auf abweichendem Verhalten (Devianz) basiert, zeichnet sich Makrokriminalität durch konformes Handeln innerhalb eines verbrecherischen Kollektivs unter politischen Ausnahmebedingungen aus.
- Citar trabajo
- Holger Hofmann (Autor), 2006, Makrokriminalität im Dritten Reich. Die Gewalt von Gesellschaften durch Sprache und Gesetze, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64386