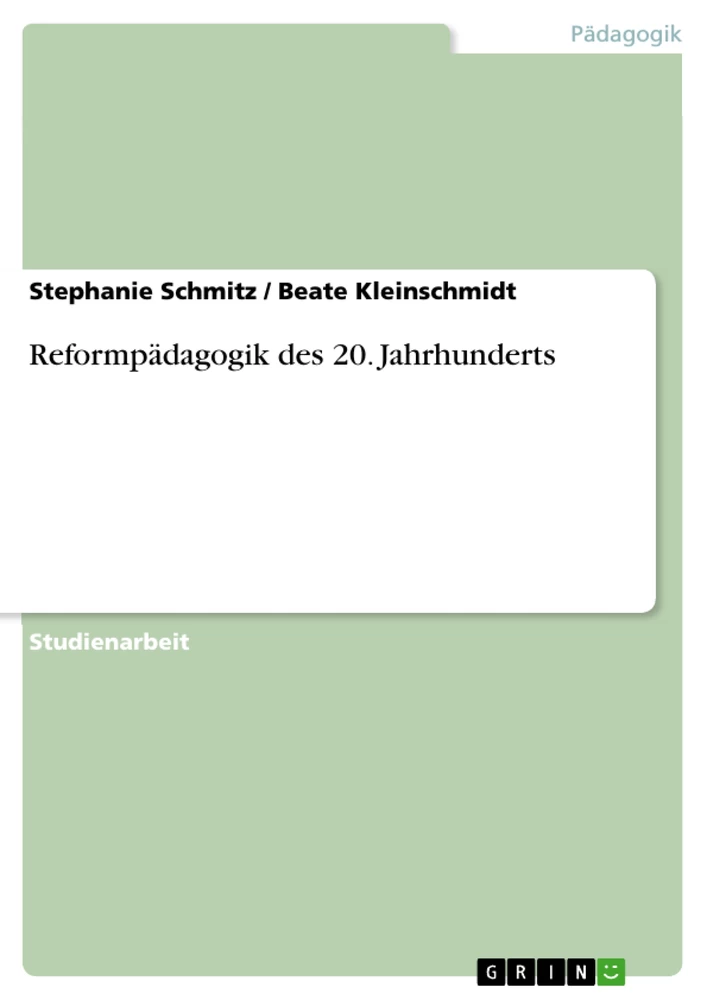Im ersten Teil der Arbeit soll die Entwicklung der Erziehung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland unter der besondern Berücksichtigung der Reformpädagogik dargestellt werden. Dieser Zeitraum soll in drei Bereiche eingeteilt werden, dem Beginn des 20. Jahrhunderts, dem Nationalsozialismus und der unmittelbaren Zeit nach 1945. Dabei soll die Rolle der Reformpädagogik in ihrem jeweiligen historischen Kontext herausgestellt werden. Abschließend sollen in einer Schlussbemerkung eine Bewertung der reformpädagogischen Bewegung und ihrer Auswirkung auf die Erziehungswirklichkeit vorgenommen werden. Der zweite Teil der Arbeit soll einen Einblick in Reformschulen bieten und aufzeigen, ob und inwiefern sie als Alternativen zur Regelschule angesehen werden können. Dabei soll zunächst auf die Grundsätze der Reformpädagogik im Allgemeinen eingegangen werden. In den beiden folgenden Punkten, die die Montessori- und Waldorfschulen betreffen, sollen jeweils die Leitgedanken und Lehrmethoden, die sich von denen der Regelschule unterscheiden, aufgezeigt werden. Schließlich soll zu einem abschließenden Vergleich zwischen den verschiedenen Schulformen gekommen werden und einem Fazit, ob es die richtige Schulform gibt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beginn des 20. Jahrhunderts
- Allgemeine Tendenzen
- Die pädagogische Bewegung
- Die Jugendbewegung
- Die Kunsterziehungsbewegung
- Die Arbeitsschulbewegung
- Die Erziehungswissenschaft
- Die geisteswissenschaftliche Pädagogik
- Empirismus und die kritisch-rationale Theorie
- kritische Theorie
- 1933-1945/ der Nationalsozialismus
- Führerprinzip und Ideologie
- Erziehung unter der NS-Herrschaft
- Schule und Bildung
- Außerschulische Organisationen
- Die Zeit nach 1945
- Grundsätze der aktuellen Reformpädagogik
- Montessori-Pädagogik
- Wer war Maria Montessori?
- Grundsätze & Lehrmethoden
- Prinzipien
- Sensible Phasen
- Polarisation der Aufmerksamkeit
- Absorbierender Geist
- Normalisation
- Vorbereitete Umgebung
- Das Entwicklungsmaterial
- Waldorfschulen
- Wer war Rudolf Steiner?
- Leitgedanken & Lehrmethoden
- Verwaltung
- Unterricht
- Epochenunterricht
- Fachunterricht
- Praktischer Unterricht
- Zusammenfassung der Unterrichtsarten
- Anthroposophie
- Entwicklungspsychologische Grundlagen
- Die Temperamentenlehre
- Kritik an der Waldorfschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung der Erziehung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Reformpädagogik gelegt wird. Die Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte: Der Beginn des 20. Jahrhunderts, die Zeit des Nationalsozialismus und die unmittelbare Nachkriegszeit. Dabei soll die Rolle der Reformpädagogik in ihrem jeweiligen historischen Kontext beleuchtet werden. Die Arbeit soll zudem einen Einblick in Reformschulen bieten und aufzeigen, ob und inwiefern sie als Alternativen zur Regelschule angesehen werden können. Dazu werden die Montessori- und Waldorfschulen als Beispiele für reformpädagogische Ansätze näher betrachtet.
- Die Entwicklung der Erziehung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland
- Die Rolle der Reformpädagogik in ihrem historischen Kontext
- Die Reformschulen als Alternativen zur Regelschule
- Die Leitgedanken und Lehrmethoden der Montessori- und Waldorfschulen
- Ein Vergleich zwischen verschiedenen Schulformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Reformpädagogik des 20. Jahrhunderts ein und skizziert die Struktur der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die allgemeinen Tendenzen des frühen 20. Jahrhunderts, die den Boden für die Verbreitung der Reformpädagogik bereiteten. Es wird auf die Auswirkungen der Industrialisierung, die Entdeckung des Unterbewusstseins und die Sehnsucht nach Natur und Ursprünglichkeit hingewiesen. Im weiteren Verlauf wird die pädagogische Bewegung als eine Reaktion auf die autoritären Strukturen des 19. Jahrhunderts beschrieben. Dabei werden die Hauptströmungen der Reformpädagogik, wie die Jugendbewegung, die Kunsterziehungsbewegung und die Arbeitsschulbewegung, vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über die Entwicklung der Erziehungswissenschaft in dieser Zeit.
Das dritte Kapitel behandelt die Zeit des Nationalsozialismus und seine Auswirkungen auf die Erziehung. Es geht auf das Führerprinzip und die Ideologie des NS-Regimes sowie die Auswirkungen auf Schule und außerschulische Organisationen ein. Das vierte Kapitel beleuchtet die Zeit nach 1945 und thematisiert die Grundsätze der aktuellen Reformpädagogik. Die Kapitel 6 und 7 widmen sich der Montessori- und Waldorfschulen. Hier werden die jeweiligen Leitgedanken und Lehrmethoden, die sich von denen der Regelschule unterscheiden, dargestellt.
Schlüsselwörter
Reformpädagogik, 20. Jahrhundert, Deutschland, Erziehung, Schule, Bildung, Jugendbewegung, Kunsterziehungsbewegung, Arbeitsschulbewegung, Montessori-Pädagogik, Waldorfschulen, Leitgedanken, Lehrmethoden, historische Entwicklung, gesellschaftliche Veränderungen, Bildungsphilosophie, alternative Schulformen.
- Quote paper
- Stephanie Schmitz (Author), Beate Kleinschmidt (Author), 2003, Reformpädagogik des 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64443