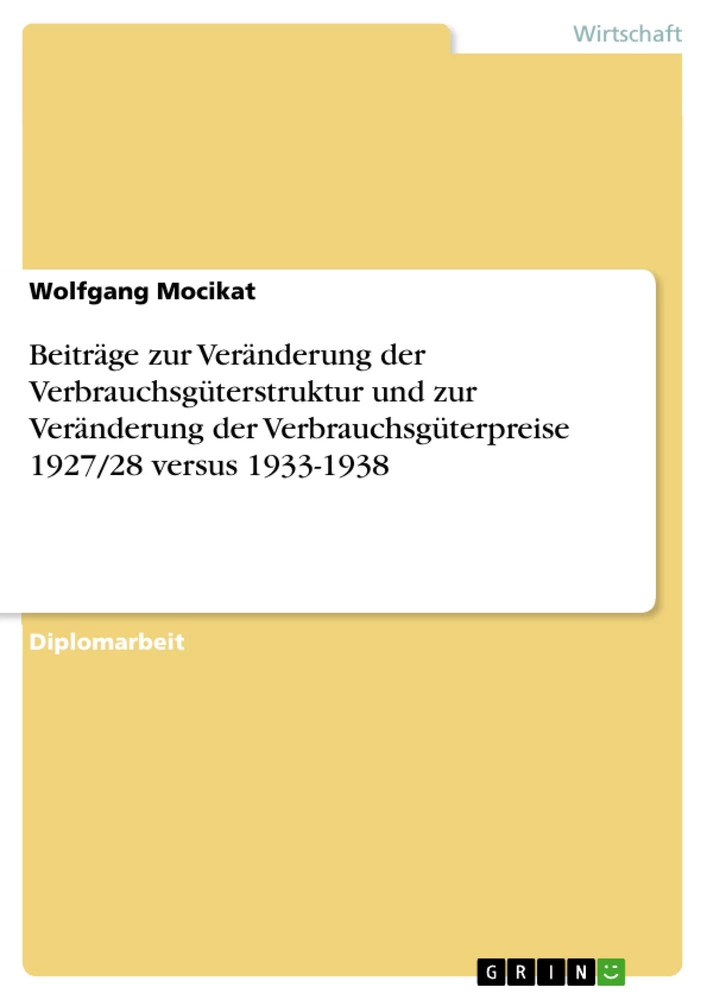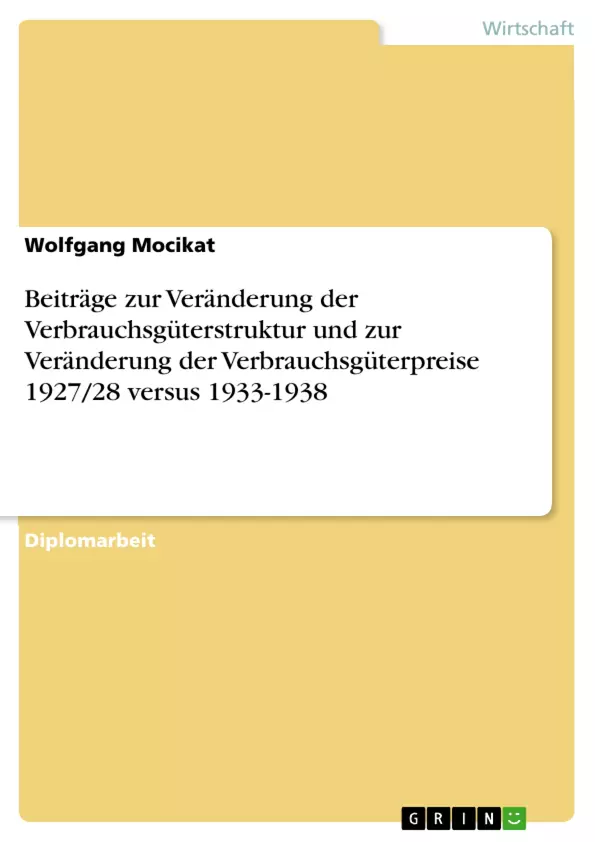Wenn im folgenden einige Beiträge zur Verbrauchsgüterstruktur gemacht werden sollen, so ist zunächst eine Abgrenzung des Begriffs „Verbrauchsgut“ vorzunehmen. Hierzu bieten sich in der Literatur mehrere Möglichkeiten an.
Da ist z.B. die Auffassung Stackelbergs, der zur Gruppe der Verbrauchsgüter die Nahrungs-und Genussmittel, Roh-, Hilfs- und Kraftstoffe, sowie Halbfabrikate rechnet. Er erfasst hierbei also Güter der Produktions- wie der Konsumtionsstufe. Nicht zu den Verbrauchsgütern zählt er dauerhafte Güter, die von den Haushalten nachgefragt werden, wie z.B. Bekleidung, Hausrat u.ä. Sie bilden bei ihm eine eigene Gruppe.
Dieser Auffassung steht die von Hicks gegenüber. Bei ihm fallen unter den Begriff „Verbrauchsgut“ nur solche Güter, die in den Begehrskreis der Haushalte fallen. Dabei unterscheidet er solche, die „bei ihrer Verwendung sofort ganz verbraucht werden (wie z.B. Nahrungsmittel, Brennstoffe, Tabak, Streichhölzer, Schreibpapier)“ und solche, deren Gutseigenschaft mehr oder minder lang bestehen bleibt. Diese Güter bezeichnet er als Gebrauchsgüter (z.B. Möbel, Kleidung, Hausrat, usw.). Oft werden sie auch als langlebige Verbrauchsgüter im Gegensatz zu den kurzlebigen, wie sie oben beschrieben sind bezeichnet.
Hier soll im wesentlichen die Hicks’sche Terminologie zugrunde gelegt werden. Wir beschränken uns also auf solche Güter, die unmittelbar von den Haushalten nachgefragt werde.
Dazu gehören einerseits in der Gruppe der kurzlebigen Verbrausgüter die Nahrungs- und Genussmittel, sowie anderer Güter, die immer wieder im Rahmen der Lebenshaltung gekauft werden müssen, andererseits in der Gruppe der langlebigen Verbrauchsgüter die von den Haushalten nachgefragten industriellen Fertigwaren wie Kleidung, Hausrat, Kleineisenwaren, Fahrräder u.ä., also Güter, die nicht immer wieder gekauft werden müssen, sondern nur, „wenn das Bedürfnis nach ihnen zum ersten Mal auftritt“, oder eine Erstanschaffung vorgenommen wird.
Im folgenden beschränken wir uns auf die wichtigsten Verbrauchsgüter wie Nahrungsmittel, Bekleidung und Hausrat. Ausgaben für Miete, Verkehr, Unterhaltung, Bildung, Reinigung u.ä., die ja zum Verbrauch i.e.S. gehören und auch in allen Preisindices für die Lebenshaltung berücksichtigt werden, sollen hier außer acht gelassen werden. Denn hier richtet sich die Nachfrage nicht auf Güter im strengen Sinn. Vielmehr tragen diese Dinge Dienstleistungscharakter; es handelt sich um immaterielle Güter.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Definitorische Abgrenzung des Begriffs „Verbrauchsgut“
- Bemerkungen zum Begriff „Verbrauchsgüterstruktur“
- Die Verbrauchserhebung und ihre Methoden
- Beiträge zur Verbrauchsgüterstruktur
- Vergleich der Verbrauchserhebungen von 1927/28 und 1937
- Kurze Schilderung der allgemeinen Wirtschaftslage zu beiden Vergleichszeitpunkten
- Statistische Schwierigkeiten eines Vergleichs
- Vergleich der Ausgaben für Verbrauchsgüter in v.H. der Gesamtverbrauchsausgaben
- Vergleich der absoluten Ausgaben pro Haushaltung für die wichtigsten Verbrauchsgüter und Gegenüberstellung der tatsächlich verbrauchten Mengen an Nahrungs- und Genussmitteln
- Zusammenfassung, Ergebnis
- Die Entwicklung des privaten Verbrauchs unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik
- Konjunkturpolitische Ausgangslage
- Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten
- Die Devisenkrise und ihre Folgen für den privaten Verbrauch
- Die Entwicklung des Verbrauchs
- Kurze Darstellung der Verbrauchsänderungen 1933 vs. 1932
- Die Entwicklung ab 1933
- Zusammenfassung
- Die Entwicklung der Verbrauchsgüterproduktion
- Im Ernährungssektor; die Fett- und Eiweißfutterlücke
- Im Sektor der industriell erzeugten Verbrauchsgüter
- Das Verhältnis zwischen Verbrauchs- und Produktionsgüterindustrie
- Zusammenfassung
- Die Rolle der Verbrauchslenkung
- Die Ziele der Verbrauchslenkung
- Die Mittel der Verbrauchslenkung
- Direkte Verbrauchslenkung
- Indirekte Verbrauchslenkung
- Ergebnisse des Vergleichs der Verbrauchserhebungen von 1927/28 und die Entwicklung des Pro-Kopf-Verbrauchs von 1933 - 1937
- Die Entwicklung der Verbrauchsgüterpreise 1933-38
- Die Entwicklung der Preise für agrarische Nahrungsmittel unter dem Einfluss der staatlichen Preispolitik
- Ziele der Preispolitik im Sektor der Landwirtschaft
- Allgemeine Besserung der Lage der Landwirtschaft
- Produktionslenkung
- Die Mittel
- Aufbau des Reichsnährstandes bzw. der Reichsstellen; ihre Befugnisse und Organe
- Setzung von Festpreisen; Beispiele für einige wichtige Gebiete
- Preisentwicklung und -bildung bei importierten Nahrungsmitteln
- Allgemeine Bemerkungen zum Festpreissystem bei landwirtschaftlichen Produkten
- Die Entwicklung der Preise für einige wichtige industrielle Fertigwaren
- Die Periode der Preisüberwachung vom 30.1.33 bis 29.10.36
- Einwirkungen auf die gebundenen Preise
- Einwirkungen auf die freien Preise
- Preispolitische Einflussnahme bei importabhängigen Waren
- Die Periode der Preisbildung vom 29.10.36 bis zum Ende des Untersuchungszeitraums
- Die Befugnisse des Reichskommissars für Preisbildung
- Die Preisstopverordnung
- Ausnahmen vom Preisstop; Maßnahmen auf dem Gebiet der Textilwirtschaft
- Gründe für Preissteigerungen speziell auf dem Gebiet der Textilwirtschaft
- Versuche des Ausgleichs von Preissteigerungen
- Zusammenfassung
- Ausblick auf die weitere Entwicklung
- Die staatliche Einflussnahme auf den Verbrauch nach 1939
- Die weitere Entwicklung der Verbrauchsgüterpreise und staatliche Maßnahmen auf diesem Gebiet
- Vergleich der Verbrauchsgüterstruktur in den Jahren 1927/28 und 1937
- Entwicklung des privaten Verbrauchs unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik
- Entwicklung der Verbrauchsgüterproduktion in der Zeit des Nationalsozialismus
- Rolle der Verbrauchslenkung in der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik
- Entwicklung der Verbrauchsgüterpreise zwischen 1933 und 1938
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Veränderungen der Verbrauchsgüterstruktur und -preise in Deutschland zwischen den Jahren 1927/28 und 1933-1938. Dabei wird die Bedeutung der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik für diese Entwicklungen beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der definitorischen Abgrenzung des Begriffs „Verbrauchsgut“ und den Besonderheiten der Verbrauchserhebung und ihrer Methoden.
Das zweite Kapitel analysiert die Veränderungen der Verbrauchsgüterstruktur in den Jahren 1927/28 und 1937. Es werden statistische Schwierigkeiten eines Vergleichs aufgezeigt und die Entwicklung des privaten Verbrauchs unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik untersucht. Die Analyse beinhaltet auch die Entwicklung der Verbrauchsgüterproduktion und die Rolle der Verbrauchslenkung.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Verbrauchsgüterpreise zwischen 1933 und 1938. Dabei werden die Auswirkungen der staatlichen Preispolitik im Sektor der Landwirtschaft und die Preisentwicklung für industrielle Fertigwaren betrachtet.
Schlüsselwörter
Verbrauchsgüterstruktur, Verbrauchserhebung, nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, Verbrauchslenkung, Preispolitik, Agrarwirtschaft, industrielle Fertigwaren.
- Quote paper
- Diplom-Volkswirt Wolfgang Mocikat (Author), 1969, Beiträge zur Veränderung der Verbrauchsgüterstruktur und zur Veränderung der Verbrauchsgüterpreise 1927/28 versus 1933-1938, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64485