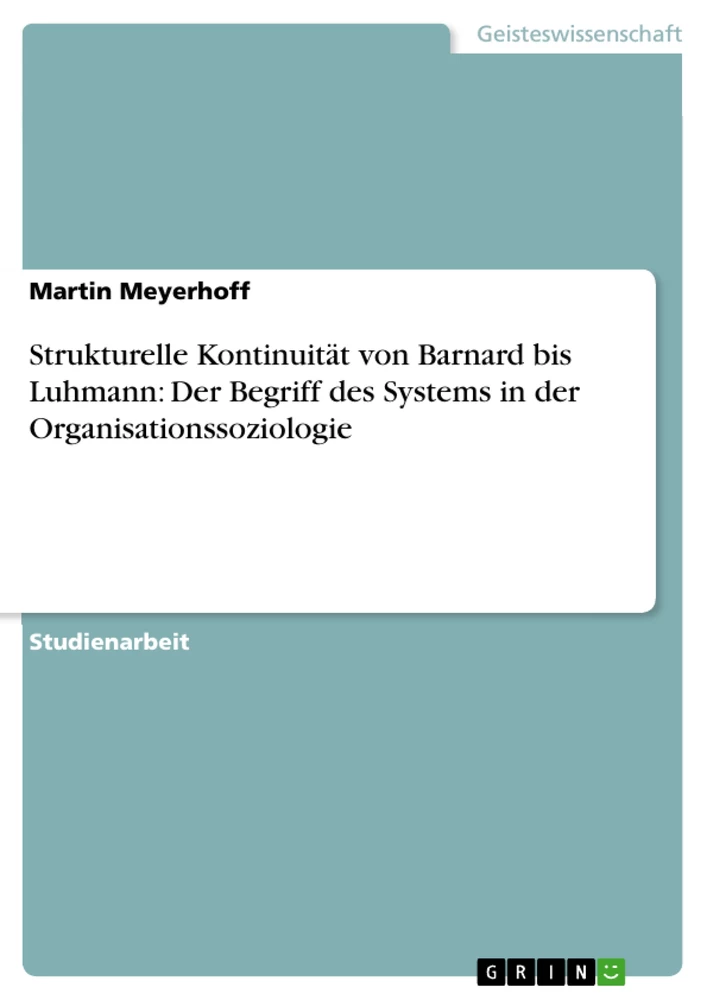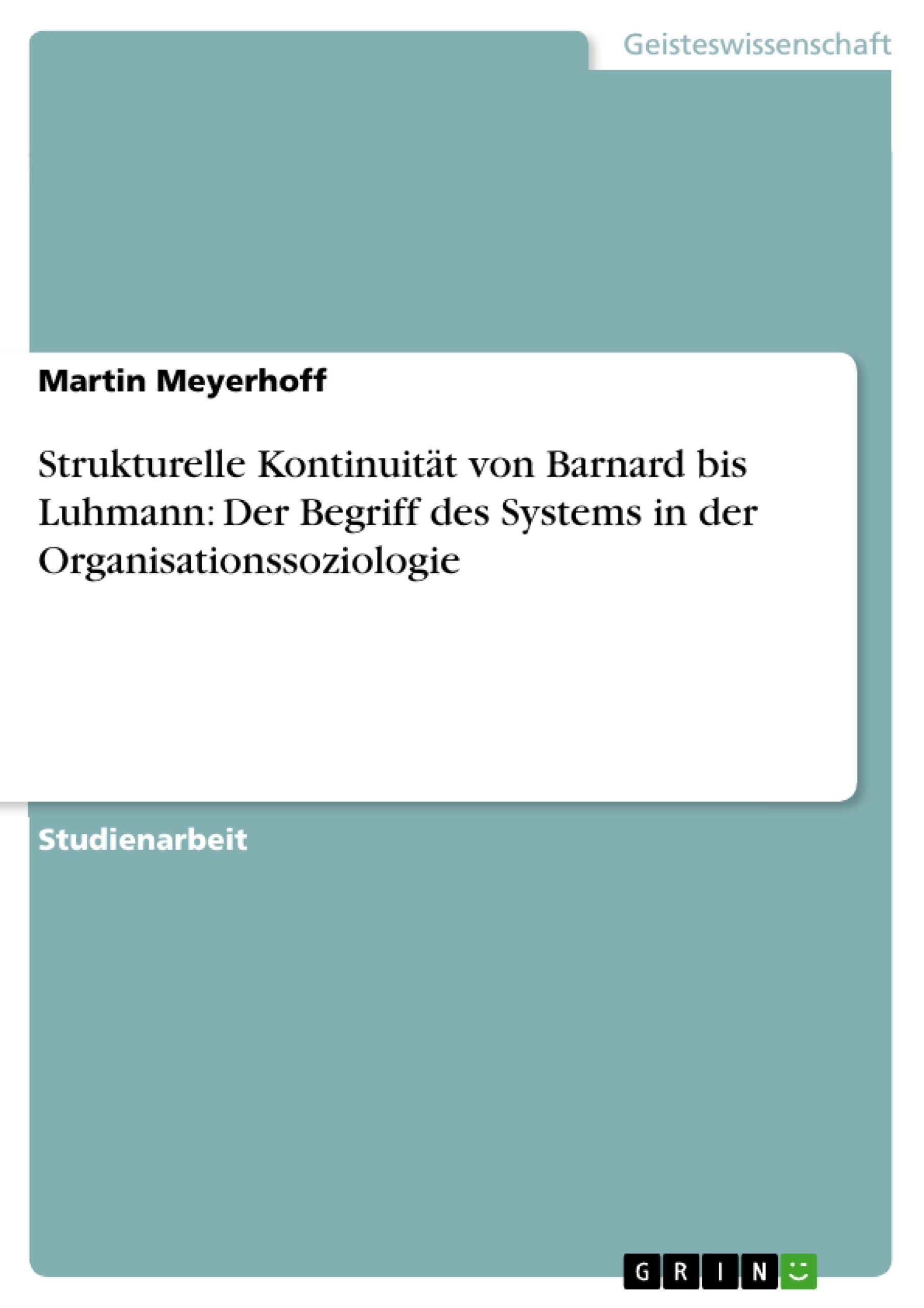Chester Barnard hat mit seiner berühmten Definition einer Organisation als „System bewußt koordinierter Handlungen zweier oder mehr Personen“ den Begriff des Systems in die Organisationstheorie eingeführt. Herbert Simon und seine Anhänger haben die handlungstheoretische Theorie Barnards weiterentwickelt - und in ihren Arbeiten Barnards Systembegriff aufgegriffen, jedoch die Elemente des Systems „Organisation“ neu gefasst. Schließlich hat Niklas Luhmann die Ansätze von Barnard und Simon in sein kommunikationstheoretisches Theoriegebäude „sozialer Systeme“ integriert. Die Einführung des Systembegriffs in die Organisationswissenschaften stellte für die Disziplin in zweierlei Hinsicht eine Revolution dar: Zum Einen konnte man von diesem Zeitpunkt an Organisationen abstrakt fassen - und war nicht mehr an konkrete Organisationen wie zum Beispiel Firmen oder öffentliche Verwaltungen als Forschungs- und Denkobjekte gebunden. Zum anderen war dieser Begriff des Systems die Grundlage für Luhmanns später folgenden Versuch, die Organisationstheorien in „naturwissenschaftlichen“, exakten Begriffen zu beschreiben und so in ein Theoriegebäude zu integrieren, dass nicht nur Organisationen, sondern sämtliches soziales Handeln beinhaltet.
Ziel dieser Arbeit ist es, die strukturelle Kontinuität der drei Ansätze anhand des jeweils zentralen Begriffs des „Systems“ herauszustellen. Dazu werde ich erst drei zentrale Merkmale dieses Begriffes - Elemente, Verbindungen und Welt-/Umwelt-Unterscheidung - herausarbeiten, und dann zeigen, wie diese Struktur in den Arbeiten von Barnard, Simon und Luhmann ausgefüllt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein System?
- Barnards Anwendung des Begriffs System auf Organisationen
- Elemente: Handlungen
- Handlungen verbunden durch bewußte Koordination
- Teil des Systems sind Handlungen – nicht Menschen
- Herbert Simon: die Organisation als Entscheidungsmaschine
- Elemente: Entscheidungen
- Entscheidungsprämissen als Verbindungen
- Nur die Entscheidung ist im System
- Einbettung der Organisation als System in Luhmanns Systemtheorie
- Elemente der Organisation bei Luhmann: Entscheidungen als Kommunikationen
- Was verbindet die Entscheidungen zur Organisation? Autopoesis!
- Die Unterscheidung zwischen System und Umwelt
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der strukturellen Kontinuität der Ansätze von Barnard, Simon und Luhmann im Hinblick auf den Begriff des Systems in der Organisationssoziologie. Sie analysiert die drei Ansätze anhand des jeweils zentralen Begriffs des „Systems“ und beleuchtet dessen Struktur in den Arbeiten der drei Autoren. Die Arbeit zeigt auf, wie der Systembegriff von Barnard über Simon zu Luhmann weiterentwickelt und in ein umfassendes Theoriegebäude integriert wurde.
- Der Begriff des Systems als zentrales Element der Organisationstheorie
- Die Entwicklung des Systembegriffs von Barnard über Simon zu Luhmann
- Die Bedeutung der Elemente, Verbindungen und Umwelt-Unterscheidung in der Systemdefinition
- Die Integration von Organisationen in Luhmanns Systemtheorie
- Die Rolle von Handlungen, Entscheidungen und Kommunikation in der Organisation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den Kontext der Analyse dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Systembegriffs für die Organisationssoziologie und die Relevanz der drei betrachteten Ansätze.
- Was ist ein System?: Dieser Abschnitt erläutert den Begriff des Systems aus philosophischer und wissenschaftlicher Perspektive. Er definiert die drei zentralen Merkmale eines Systems: Elemente, Verbindungen und Umwelt-Unterscheidung.
- Barnards Anwendung des Begriffs System auf Organisationen: Dieser Abschnitt untersucht Barnards Definition der Organisation als „System bewußt koordinierter Handlungen zweier oder mehr Personen“. Er analysiert die Elemente (Handlungen), Verbindungen (bewußte Koordination) und die Unterscheidung zwischen System und Umwelt in Barnards Systemverständnis.
- Herbert Simon: die Organisation als Entscheidungsmaschine: Dieser Abschnitt analysiert Simons Ansatz der Organisation als Entscheidungsmaschine. Er untersucht, wie Simon den Systembegriff weiterentwickelt hat und welche Elemente (Entscheidungen), Verbindungen (Entscheidungsprämissen) und die Unterscheidung zwischen System und Umwelt in seinem Ansatz relevant sind.
- Einbettung der Organisation als System in Luhmanns Systemtheorie: Dieser Abschnitt betrachtet Luhmanns Integration der Organisation in seine Systemtheorie. Er untersucht die Elemente (Entscheidungen als Kommunikationen), Verbindungen (Autopoesis) und die Umwelt-Unterscheidung in Luhmanns Systemverständnis.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Organisation, System, Handlung, Entscheidung, Kommunikation, Autopoesis, Barnard, Simon, Luhmann, Organisationstheorie, Systemtheorie, Soziologie, Umwelt, Struktur, Kontinuität.
Häufig gestellte Fragen
Wie definierte Chester Barnard eine Organisation?
Barnard definierte Organisation als ein „System bewusst koordinierter Handlungen zweier oder mehr Personen“, wobei nicht die Menschen, sondern die Handlungen die Systemelemente sind.
Was ist Herbert Simons Konzept der „Entscheidungsmaschine“?
Simon sieht Organisationen als Systeme von Entscheidungen. Die Verbindungen im System bestehen aus Entscheidungsprämissen, die das Verhalten der Mitglieder steuern.
Wie integriert Niklas Luhmann Organisationen in seine Systemtheorie?
Für Luhmann bestehen Organisationen aus Entscheidungen, die als eine spezielle Form der Kommunikation verstanden werden und sich durch Autopoiesis selbst reproduzieren.
Was sind die drei zentralen Merkmale eines Systems in der Soziologie?
Ein System wird durch seine Elemente, die Verbindungen zwischen diesen Elementen und die Unterscheidung zwischen System und Umwelt definiert.
Warum war die Einführung des Systembegriffs revolutionär?
Er erlaubte es, Organisationen abstrakt zu erforschen, unabhängig von konkreten Einzelfällen wie Firmen oder Behörden, und schuf eine Basis für exakte wissenschaftliche Beschreibungen.
- Quote paper
- Martin Meyerhoff (Author), 2006, Strukturelle Kontinuität von Barnard bis Luhmann: Der Begriff des Systems in der Organisationssoziologie , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64600