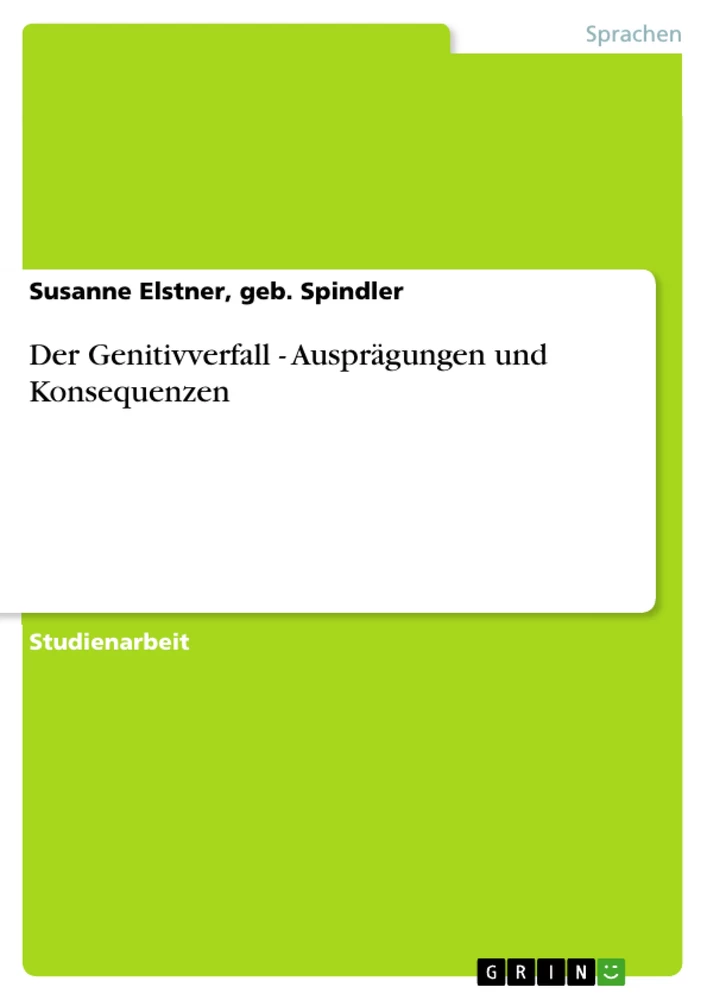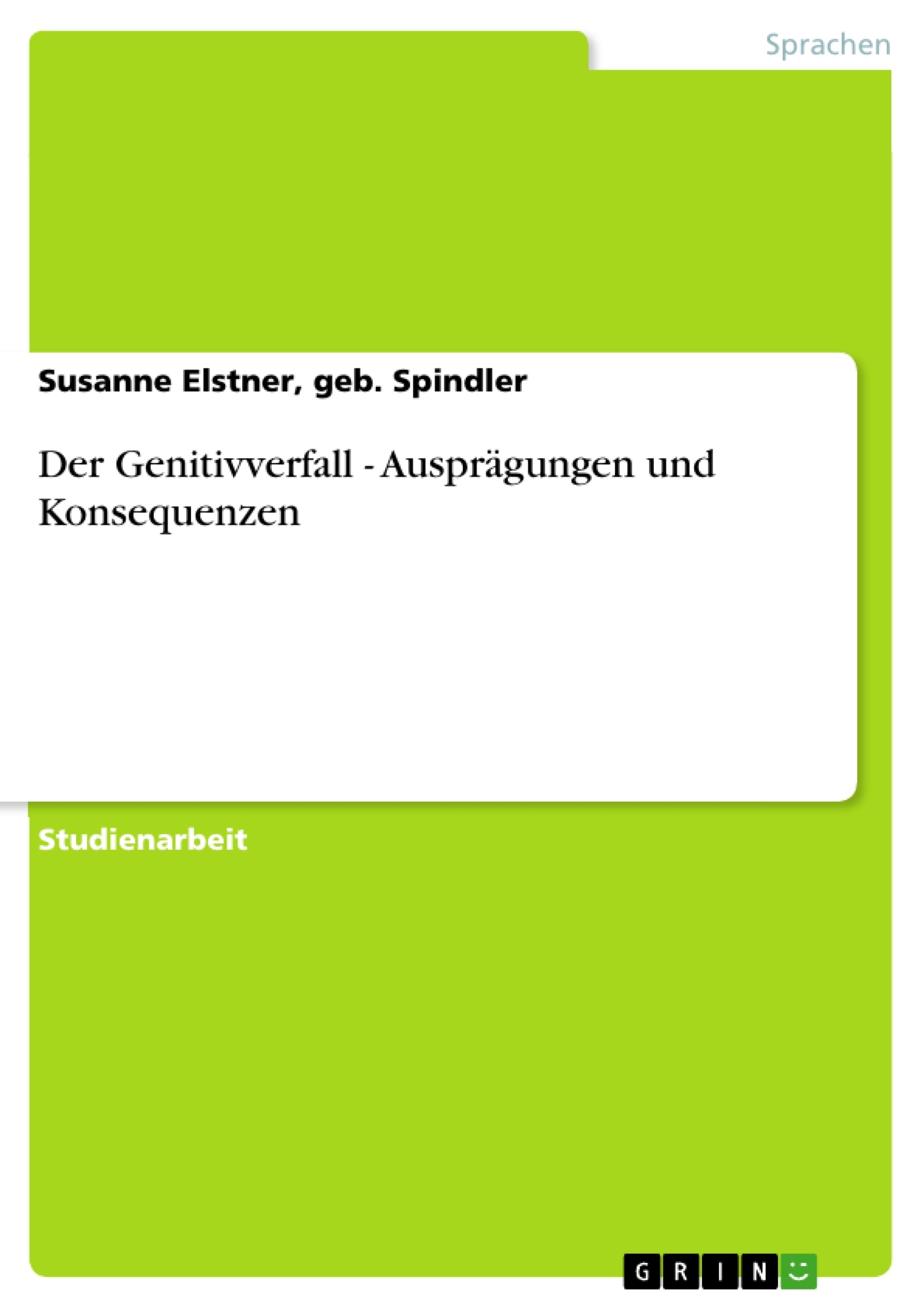Rettet den Genitiv! Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod! Solchen und vielen anderen Sätzen der Warnung bzw. Aufrüttelung begegnet man in Zeitungen, Schulen und Universitäten. Der Genitiv erhält auf diese Weise nach und nach den Status einer vom Aussterben bedrohten Tier- oder Pflanzenart, bei deren Anblick man ganz erfürchtig wird, weil man weiß, dass es das letzte Mal sein könnte. Der Mensch scheint auf gewissen Gebieten dualistische Vorlieben zu haben. Zum einen liebt er den Fortschritt, zu dem ihn seine Neugierde treibt, andererseits liebt er auch das alte Traditionelle, weil er sozusagen sein Nachkomme ist. Ähnlich verhält es sich beim Genitiv. Er wird immer mehr zum Alten. In der gesprochenen Sprache ist er schon fast ausgestorben bzw. in seiner Verwendung oft markiert. In der Schriftsprache ist seiner Verwendung zwar noch ein Stück alltäglicher, aber auch hier sind Verfallserscheinungen zu sehen. Sein Verfall ist nicht aufzuhalten. Wir können nicht über den täglichen Fortschritt der Welt und Menschheit mit veralteten Vokabeln und grammatischen Konstruktionen reden. Es ist abzusehen, dass der Genitiv, wie z.B. im Englischen, irgendwann einmal ganz wegfällt und ins Fachgebiet der Diachronischen Sprachwissenschaft gehört. Die Ausarbeitung befasst sich vor allem mit den verschiedenen Formen des Wegfalls, betrachtet Ausnahmen, versucht sich an Prognosen für die Zukunft und gibt Ratschläge für den Umgang mit dem Sachverhalt im schulischen Bereich.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Auf den ersten Blick
- 1.1. Das Genitiv-„s“
- 1.1.1. Wegfall des Genitiv-„s“
- 1.1.2. Hinzutreten des Genitiv-„s“
- 1.2. Die Genitiv-Rektion
- 1.2.1. Verlust der Genitiv-Rektion
- 1.2.2. Hinzutreten einer Genitiv-Rektion
- 1.3. Veraltung
- 1.4. Ersatzkonstruktionen
- 2. Der Verlust des Genitiv-„s“
- 2.1. Die Appelsche Theorie
- 2.2. Zustimmung und Gegentheorien
- 2.3. Vermehrung des Genitiv-„s“ - eine Gegentheorie?
- 3. Die Genitiv-Rektion
- 3.1. Rückgang der Genitiv-Rektion bei Verben und Präpositionen
- 3.2. Zunahme von Genitiv-Rektion bei Dativ-Adpositionen
- 3.3. Ersatzkonstruktionen und Konkurrenzformen
- 4. Der Genitiv heute
- 5. Prognosen
- 6. Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Rückgang des Genitivs im Deutschen, seine formalen Ausprägungen und Konsequenzen. Es werden verschiedene Theorien zum Genitivverfall beleuchtet und der aktuelle Stand des Genitivs in der deutschen Sprache analysiert. Zusätzlich werden Prognosen für die zukünftige Entwicklung des Genitivs formuliert.
- Der Verlust des Genitiv-„s“ und seine Ursachen
- Der Wandel der Genitiv-Rektion bei Verben und Präpositionen
- Ersatzkonstruktionen für den Genitiv
- Der aktuelle Gebrauch des Genitivs in der deutschen Sprache
- Zukünftige Entwicklungen des Genitivs
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zustand des Genitivs im Deutschen in den Mittelpunkt. Sie skizziert die historischen Entwicklungen des Genitivs, basierend auf Behaghel (1923), und benennt die Forschungsfragen der Arbeit: den formalen Wandel des Genitivs, seine Ersatzformen, seinen aktuellen Zustand und seine Zukunftsaussichten, sowie die Implikationen für den Sprachunterricht. Weiterhin kündigt sie die Untersuchung der scheinbar paradoxen Zunahme des „s“-Suffixes und des Rektionswechsels bei Adpositionen an, sowie eine eigenständige Betrachtung der Sonderrolle von Eigennamen im Genitivkontext an.
1. Auf den ersten Blick: Dieses Kapitel bietet einen ersten Überblick über den Rückgang des Genitivs. Es beschreibt den langfristigen Rückgang des Genitivs als flexivische Form in der Hochsprache, im Gegensatz zu den Mundarten. Es werden verschiedene Zukunftsprognosen diskutiert, wie der vollständige Ersatz durch präpositionale Fügungen oder der Verlust der „s“-Endung. Das Kapitel beschreibt die vier traditionellen Kennzeichen des Genitivs: Intonation, Flexionsendung, flektierte Artikel/Pronomen und flektiertes Adjektiv.
1.1 Das Genitiv-“s”: Dieses Kapitel fokussiert auf die Flexionsendung „s“ des Genitivs. Es beschreibt den beobachteten Rückgang des „s“ in verschiedenen syntaktischen Kontexten. Es werden Beispiele aus Appel (1941) aufgezeigt, die den Wegfall des „s“ in verschiedenen Konstellationen belegen, beispielsweise bei Substantiven mit nachgestellten oder vorangestellten Attributen, nach Präpositionen wie „trotz“, „wegen“, „mittels“, oder bei Appositionen. Es wird die Frage nach der Funktion des Apostrophs diskutiert und dessen mögliche Rolle im Kontext des „s“-Wegfalls.
2. Der Verlust des Genitiv-„s“: Dieses Kapitel beleuchtet Theorien zum Verlust des Genitiv-„s“, beginnend mit der Appelschen Theorie. Es diskutiert sowohl zustimmenden als auch gegenteiligen Standpunkten und betrachtet auch die vermeintliche Zunahme des „s“-Suffixes als mögliche Gegenthese zum Genitivverfall. Es analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und Argumente im wissenschaftlichen Diskurs über diesen Aspekt des Genitivwandels.
3. Die Genitiv-Rektion: In diesem Kapitel wird der Wandel der Genitiv-Rektion untersucht. Es wird der Rückgang der Genitiv-Rektion bei Verben und Präpositionen, sowie die Zunahme der Genitiv-Rektion bei Dativ-Adpositionen analysiert. Die Rolle von Ersatzkonstruktionen und Konkurrenzformen wird ebenfalls erörtert. Dieses Kapitel beleuchtet die dynamischen Veränderungen der syntaktischen Strukturen, die mit dem Rückgang des Genitivs einhergehen.
Schlüsselwörter
Genitivverfall, Genitiv-„s“, Genitiv-Rektion, Ersatzkonstruktionen, Flexion, Kasus, Sprachwandel, Hochsprache, Mundart, Appel, Behaghel.
Häufig gestellte Fragen zum Genitivverfall im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Rückgang des Genitivs im Deutschen, seine formalen Ausprägungen und Konsequenzen. Sie beleuchtet verschiedene Theorien zum Genitivverfall, analysiert den aktuellen Stand des Genitivs und formuliert Prognosen für seine zukünftige Entwicklung.
Welche Aspekte des Genitivverfalls werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Verlust des Genitiv-„s“, den Wandel der Genitiv-Rektion bei Verben und Präpositionen, die Zunahme der Genitiv-Rektion bei Dativ-Adpositionen, Ersatzkonstruktionen für den Genitiv, den aktuellen Gebrauch des Genitivs und seine zukünftige Entwicklung.
Welche Theorien zum Genitivverfall werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert unter anderem die Appelsche Theorie zum Verlust des Genitiv-„s“ und gegenteilige Standpunkte. Sie analysiert die verschiedenen Perspektiven und Argumente im wissenschaftlichen Diskurs über den Genitivwandel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: eine Einleitung, ein Kapitel mit einem ersten Überblick über den Genitivverfall, Kapitel zur Flexionsendung „s“ und zur Genitiv-Rektion, ein Kapitel zum aktuellen Stand des Genitivs, Prognosen und abschließende Gedanken. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Genitivverfalls.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Genitivverfall, Genitiv-„s“, Genitiv-Rektion, Ersatzkonstruktionen, Flexion, Kasus, Sprachwandel, Hochsprache, Mundart, Appel, Behaghel.
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die zentralen Forschungsfragen sind der formale Wandel des Genitivs, seine Ersatzformen, sein aktueller Zustand und seine Zukunftsaussichten, sowie die Implikationen für den Sprachunterricht.
Welche historischen Entwicklungen des Genitivs werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf historische Entwicklungen des Genitivs, basierend auf Behaghel (1923), um den aktuellen Wandel im Kontext der Sprachgeschichte zu verstehen.
Welche Rolle spielen Ersatzkonstruktionen?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Ersatzkonstruktionen für den Genitiv und analysiert deren Einfluss auf den Sprachwandel.
Wie wird der aktuelle Gebrauch des Genitivs beschrieben?
Die Arbeit analysiert den aktuellen Gebrauch des Genitivs in der deutschen Sprache und untersucht seine Verbreitung in verschiedenen Kontexten.
Welche Prognosen werden für die Zukunft des Genitivs gestellt?
Die Arbeit formuliert Prognosen für die zukünftige Entwicklung des Genitivs im Deutschen, basierend auf den analysierten Daten und Theorien.
- Quote paper
- Susanne Elstner, geb. Spindler (Author), 2003, Der Genitivverfall - Ausprägungen und Konsequenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64649