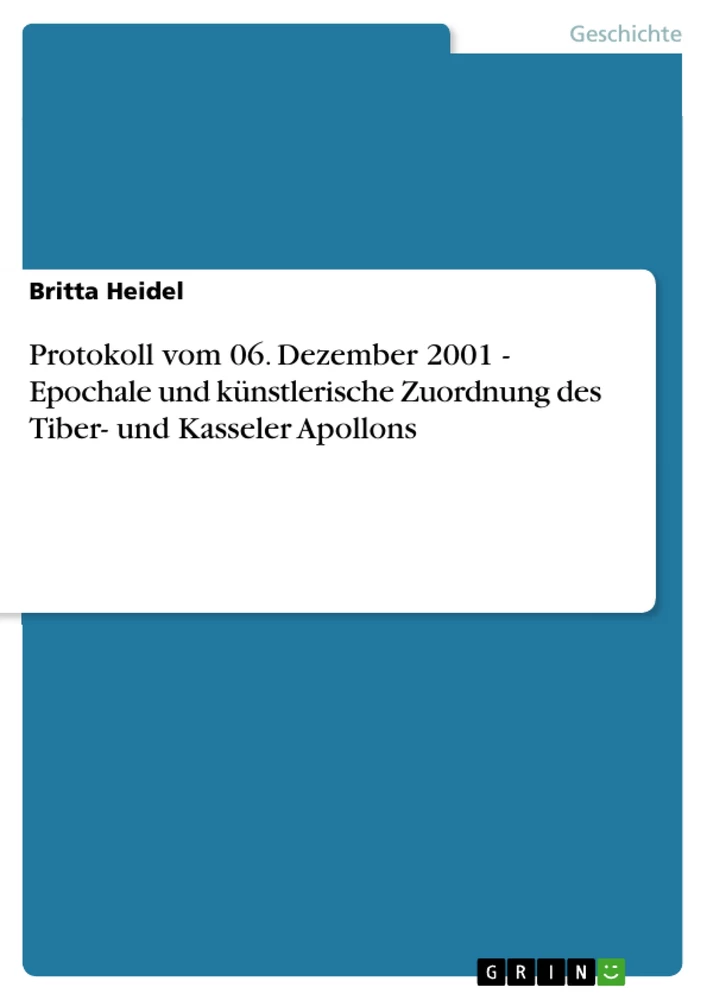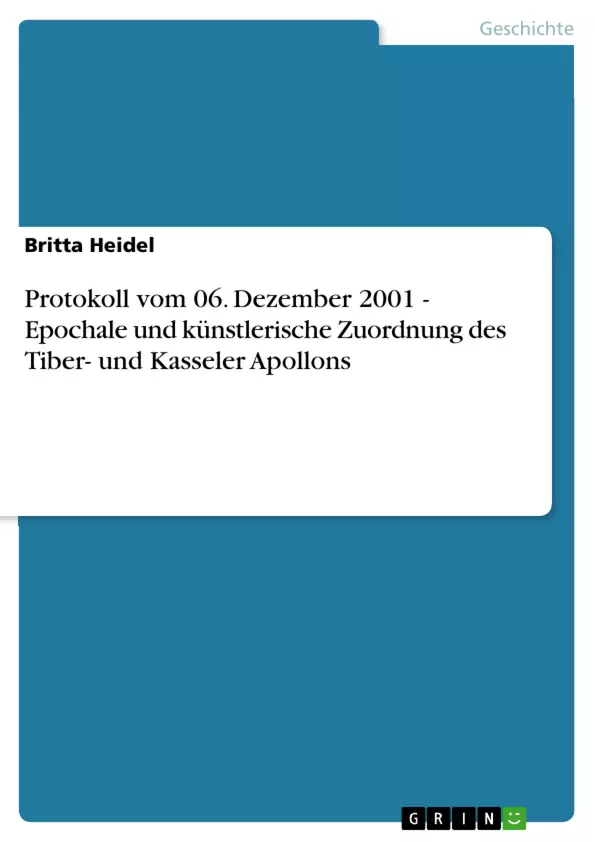Protokoll vom 06. Dezember 2001
Epochale und künstlerische Zuordnung des Tiber- und Kasseler Apollons
Eingereicht von: Britta Heidel
Studiengang: Kunstgeschichte 1
Klassische Archäologie 1
Wirtschaftswissenschaft 1
Abschluß: Magister
Wir beschäftigten uns eingehend mit dem Typus des Tiber- Apollons (Abb.1) und des Kasseler Apollons (Abb. 2). Dabei sollten Unterschiede der beiden Skulpturen und die Probleme der eindeutigen Zuordnung in die Epoche des möglichen Künstlers thematisiert werden.
Die Statue des Tiber-Apollons wurde 1891 im Tiber nahe dem Ponte Palatino gefunden und steht heute im Museo Nationale Romano in Rom. Die Höhe der Figur mißt 2,04 m.1 Der Körper ist hoch aufgerichtet. Der rechte Fuß ist leicht nach vorn und seitwärts gesetzt und tritt mit dem ganzen Fußballen auf. Die Muskeln der Standbeinseite sind angespannt. Das gesamte Gewicht der Figur ruht auf dem linken Bein. Dadurch liegt die linke Schulter eindeutig tiefer als die rechte.
Der rechte Arm hängt locker herab. Obwohl der linke Arm von der Schulter abwärts nicht mehr erhalten ist, kann man anhand der Muskelanspannung davon ausgehen, daß der Arm angewinkelt war. Die linke Hand war also erhoben.
Der Kopf ist halb abgewendet. Die Haare fallen in langen Locken auf die Schulter. Das Deckhaar ist strähnig ausgearbeitet und mündet auf der Stirn in kleine ,,Schneckenlocken". Diese Locken rahmen das jugendliche Gesicht zangenförmig ein. Die Gestalt blickt nachdenklich auf den Gegenstand, den er einst in seiner linken Hand hielt. Geht man von Darstellungen auf Münzen oder Gemmen aus, ist es möglich, daß die Figur in der rechten Hand einen Bogen und in der linken Hand einen Lorbeerzweig oder -kranz gehalten haben muß. Ein mögliches Indiz, daß es sich um einen Lorbeerzweig handelte, ist der halbhohe Baumstamm, der am linken Bein als Stütze der Figur dient. Andererseits kann die Statue auch eine Kithara in der linken Hand gehalten haben. Beide Möglichkeiten können hier in Betracht gezogen werden.
Apollon ist der griechische jugendliche Gott des Lichtes und des Todes, der Gesetzmäßigkeit und Ordnung, des Rechts und Friedens, Schutzgott der Künste und der Musen und Gott der Weissagungen mit den Orakelstätten in Delphi und Delos. Zu seinen Attributen zählen der Pfeil, Bogen, die Kithara und der Lorbeerzweig oder Lorbeerkranz.
[...]
1 Wolfgang Helbig: Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, Bd. 3, Tübingen 1969, S.161
Inhaltsverzeichnis
- Epochale und künstlerische Zuordnung des Tiber- und Kasseler Apollons
- Der Tiber-Apollon
- Der Kasseler Apollon
- Die klassische Kunst der Griechen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Protokoll befasst sich mit der epochalen und künstlerischen Zuordnung des Tiber- und Kasseler Apollons. Es untersucht die Unterschiede zwischen den beiden Skulpturen und die Herausforderungen bei der eindeutigen Einordnung in die Epoche des möglichen Künstlers.
- Analyse der spezifischen Merkmale des Tiber- und Kasseler Apollons
- Untersuchung der Unterschiede in Körperhaltung, Anatomie und Detailliertheit
- Identifizierung von Spuren der Restaurierung und Rekonstruktion
- Diskussion der römischen Kopien griechischer Originalstatuen
- Einordnung der Skulpturen in die verschiedenen Stilphasen der klassischen Kunst der Griechen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Tiber-Apollon
Die Statue des Tiber-Apollons wurde im 19. Jahrhundert im Tiber gefunden und zeichnet sich durch ihre hoch aufgerichtete Körperhaltung, die angespannte Muskulatur und den nachdenklichen Ausdruck aus. Die Statue zeigt Spuren von Schäden und Restaurierungen, die die Zartheit und Verwundbarkeit des Gottes betonen.
Der Kasseler Apollon
Die überlebensgroße Marmorstatue des Kasseler Apollons zeigt einen athletischen Körper mit geschmeidigen Muskeln, der Entschlossenheit und Konzentration ausstrahlt. Die Statue weist ebenfalls Schäden und Restaurierungen auf, die Hinweise auf die ursprüngliche Farbigkeit der Skulptur geben.
Schlüsselwörter
Tiber-Apollon, Kasseler Apollon, klassische Kunst, römische Kopie, griechische Originalstatuen, Stilphasen, strenger Stil, Hohe Klassik, Späte Klassik, Restaurierung, Rekonstruktion, Attribute, Muskeln, Körperhaltung, Ausdruck, Schäden, Farbigkeit, Bronzestatuen, Marmor, Material, Kunstgeschichte, Archäologie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmerkmale des Tiber-Apollons?
Der Tiber-Apollon zeichnet sich durch eine hoch aufgerichtete Haltung, zangenförmige „Schneckenlocken“ an der Stirn und einen nachdenklichen Blick aus. Er wurde 1891 im Tiber gefunden.
Wie unterscheidet sich der Kasseler Apollon vom Tiber-Apollon?
Der Kasseler Apollon wirkt athletischer und entschlossener. Er strahlt eine größere physische Kraft und Konzentration aus im Vergleich zur eher zarten Erscheinung des Tiber-Apollons.
Welche Attribute werden den Apollon-Statuen zugeschrieben?
Zu den klassischen Attributen gehören Bogen, Pfeil, die Kithara (Leier) sowie Lorbeerzweige oder -kränze.
Handelt es sich bei den Statuen um griechische Originale?
In der Regel handelt es sich um römische Marmorkopien nach griechischen Bronzeoriginalen aus der klassischen Epoche.
In welche Stilphasen werden die Skulpturen eingeordnet?
Die Arbeit diskutiert die Zuordnung zum „Strengen Stil“, der Hohen Klassik oder der Späten Klassik, basierend auf Anatomie und Ausdruck.
Warum dient ein Baumstamm oft als Stütze bei den Statuen?
Da Marmor schwerer und spröder ist als Bronze, benötigen Marmorkopien oft zusätzliche Stützen wie Baumstämme, um die Standfestigkeit der Figur zu gewährleisten.
- Quote paper
- Britta Heidel (Author), 2002, Protokoll vom 06. Dezember 2001 - Epochale und künstlerische Zuordnung des Tiber- und Kasseler Apollons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6473