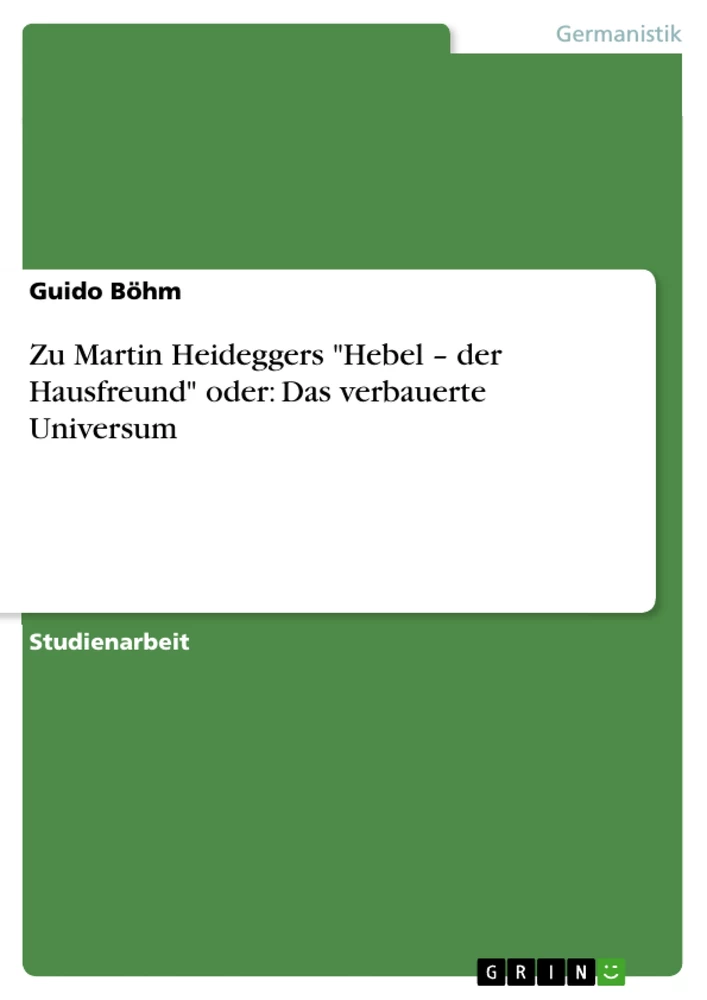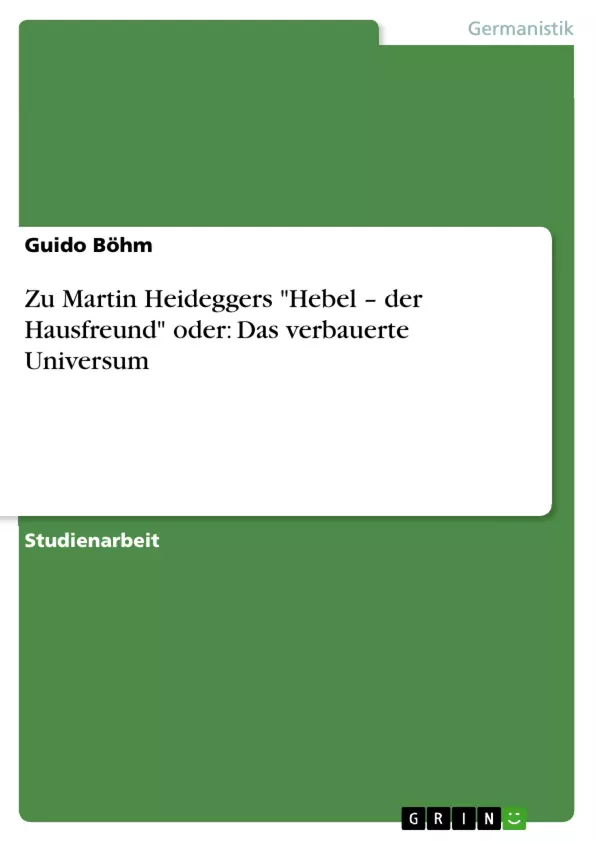Laut Heidegger existiert eine hohe Dichtung, deren, sie über jede gewöhnliche Literatur weit hinaushebende, Eigenschaft es ist, Werte und Inhalte zu transportieren, die hinter der bloßen Sprachaussage einen Schatz der Weisheit verbergen. Diese höchstzubewertende Literatur vermag zu helfen, das Wesen des Seins vermittelbar zu machen; zwischen den Worten teilt sie das Unsagbare mit. Den Sprachgeist der Literatur zu erwecken, die Texte gleichsam zur Sprache zu bringen, das ist Heideggers Anliegen. Als Beispiel für diese Art Vorgehen kann sein Aufsatz „Johann Peter Hebel – Der Hausfreund“ aus dem Jahre 1957 genannt werden. Hier bringt der Philosoph den Lesern einen Dichter näher, der seiner, ihm von Heidegger zugesprochenen Bedeutung nach, heutzutage kaum noch angemessen gelesen wird. Heidegger ergründet, wo und wie Hebels Werk das Wesen des Seienden offenbart, die Wahrheit über das Seiende mitteilt. Dies geschieht, indem er Hebel in einer literarischen Rolle vorführt: als dichterischen Hausfreund. Die vorliegende Arbeit soll die zentralen Themen des Heideggerschen Essays über Hebel erhellen. Dabei soll dargestellt werden wie Heidegger die Seins-Frage mit dem Hausfreund-Komplex verbindet. Gerade in Hebels dichterischer Demut liegt seine leuchtende Kraft, das erkennt Heidegger. Eben weil Hebels Werk in volkstümlich-bauernhafter Manier daherkommt, entdeckt Heidegger die in ihm ruhende Nähe zur Wahrheit. Mit Hebel erkennt Heidegger schließlich: „Sprache ist Sein“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Der Hausfreund.
- 1. Seine dichterische Gebärde..
- 2. Hausfreund und Mond.
- 3. Wohnen im Haus, das die Welt ist.
- 4. Der Schein dichterischen Sagens.
- 5. Das Licht...
- 6. Der Dichter...
- 7. Die Sprache.........
- 8. Mundartdichtung.
- 9. Exkurs: Platons Ideenlehre
- 10. Die Vermittlerfunktion des Hausfreundes
- II. Die Abwesenheit des Hausfreundes.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage nach dem Wesen des Seins, einem zentralen Thema in der Philosophie und Literatur. Die Arbeit untersucht, wie Martin Heidegger im Laufe seiner Karriere die Thematik des Seins und des Seienden behandelt und wie er diese philosophischen Konzepte in der Literatur, insbesondere in der Dichtung, wiederfindet.
- Das Verhältnis von Sein und Sprache
- Die Rolle der Dichtung in der Offenbarung des Seins
- Heideggers Spätwerk und die Analyse von Fremdtexten
- Heideggers Interpretation von Johann Peter Hebels Werk „Der Hausfreund“
- Die Vermittlungsfunktion von Literatur in Bezug auf das Wesen des Seins
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die zentrale Frage nach dem Wesen des Seins ein und stellt die Bedeutung von Philosophie und Literatur in dieser Debatte dar. Sie zeigt, wie die Suche nach dem Sein in der Geschichte der Philosophie und Literatur immer wieder auftaucht und wie diese Suche als eine niemals endende menschliche Suche verstanden werden kann.
Das erste Kapitel untersucht den Begriff des „Hausfreundes“ bei Johann Peter Hebel, indem es dessen dichterische Gebärde, den Bezug zur Natur und die Vermittlung von Weisheit durch seine Texte analysiert. Es betrachtet die Sprache und Mundartdichtung Hebels sowie die Rolle des „Hausfreundes“ als Vermittler zwischen dem Menschen und der Welt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Sein, Seiendes, Heidegger, Hebel, Dichtung, Sprache, Offenbarung, Vermittlung, Philosophie, Literatur, Hausfreund, Mundartdichtung.
- Arbeit zitieren
- Guido Böhm (Autor:in), 2001, Zu Martin Heideggers "Hebel – der Hausfreund" oder: Das verbauerte Universum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64808