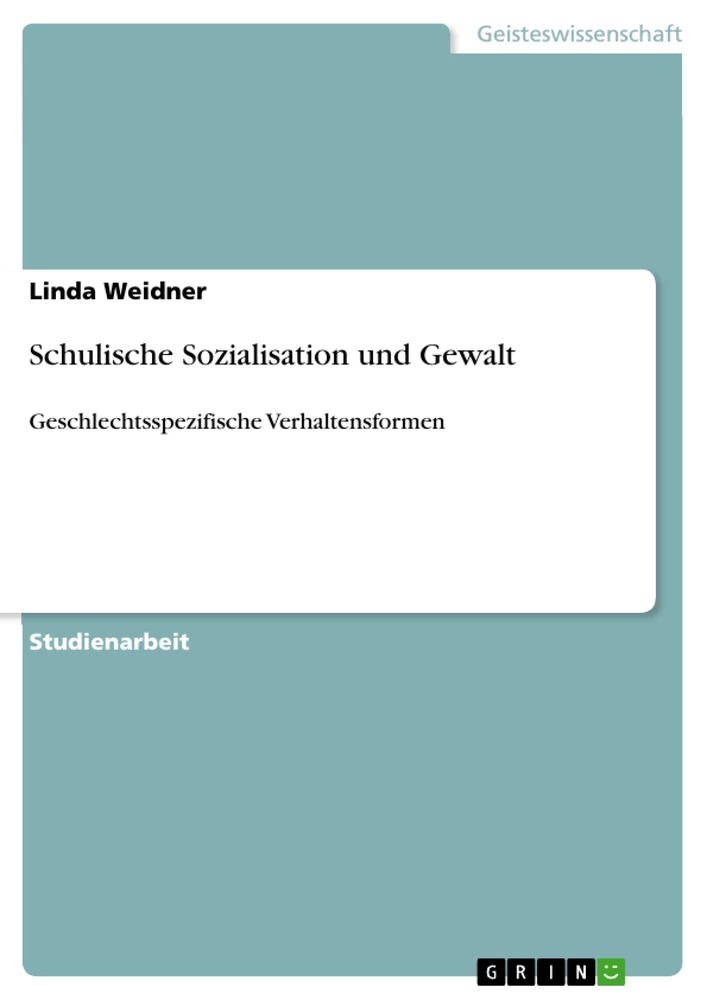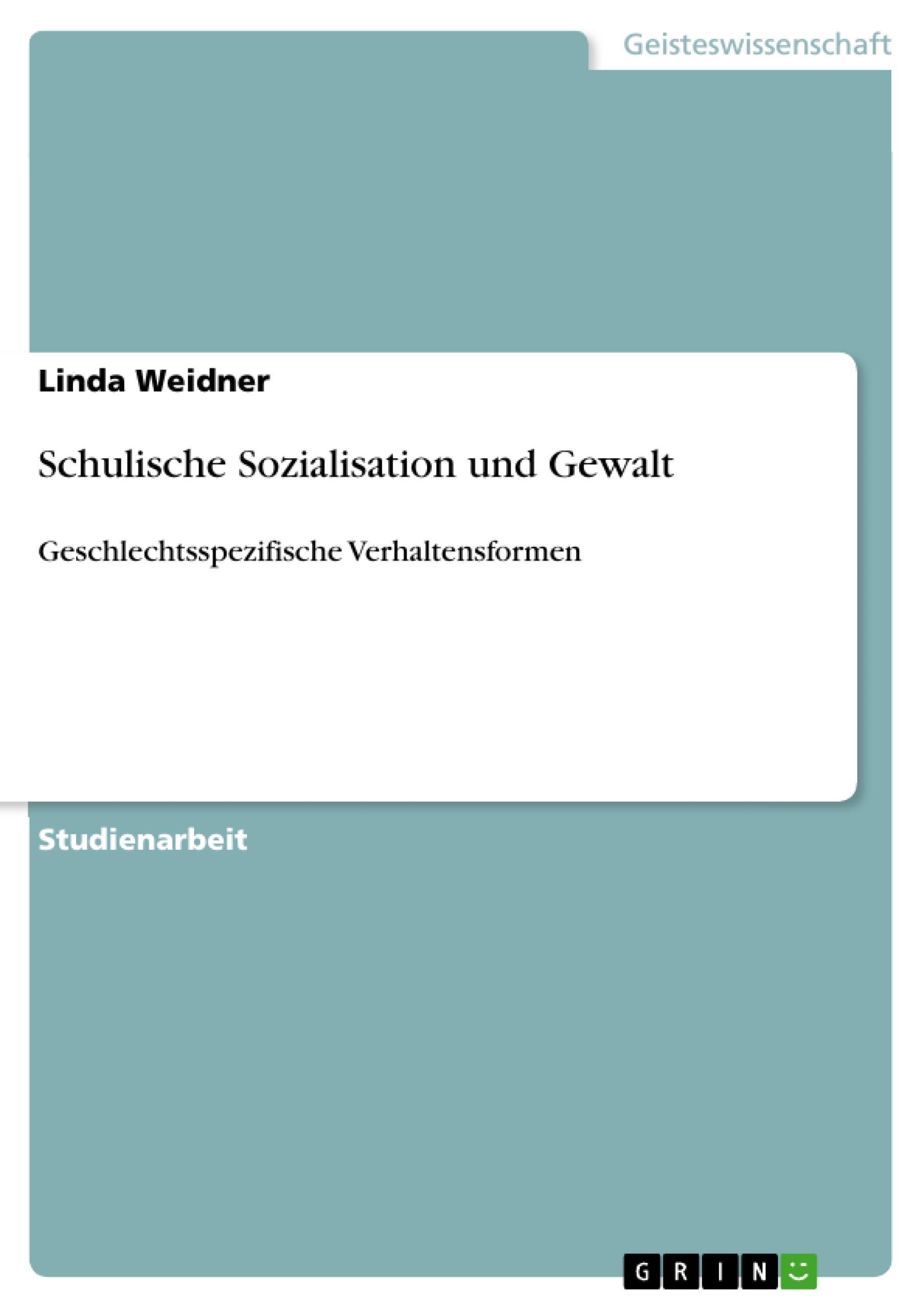Jeder fünfte Hauptschüler hat schon einmal so hart zugeschlagen, dass sein Opfer zum Arzt musste. Einer neuen Bochumer Studie zufolge vermöbeln sich Schüler einander nicht öfter als früher - aber deutlich brutaler. Meist geht es um verletztes Ehrgefühl.
Wir leben heute in einer Zeit, in der Aggression und Gewalt das Erleben und Handeln vieler Menschen zeichnet. Das gilt für Kinder und Jugendliche wie für Erwachsene. In zahlreichen Medien, in Spiel und Unterhaltung finden Gewalterleben und Gewaltverherrlichung weite Verbreitung. Kein Thema zieht z. Z. die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit so stark an sich, wie das der „Gewalt an Schulen“. Spektakuläre Massaker von Kindern und Jugendlichen, wie zum Beispiel zwei Schülern, die schwer bewaffnet ihre Schule in Littleton (Colorado) überfallen haben, entfachen immer wieder das Interesse der Öffentlichkeit und hinterlassen Bestürzung und Hilflosigkeit. Aber diese einzelnen Katastrophen täuschen zu leicht über die Alltäglichkeit der Gewalt auch an deutschen Schulen hinweg, die meist unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle liegt und nur selten in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Ebenso waren der Amoklauf in Erfurt und die Misshandlungen eines Schülers in Hildesheim Anfang 2004, Auslöser für viele Kommentare, Fernsehsendungen und Titelgeschichten. Schnell wird hiernach eine Verschärfung der Waffengesetze gefordert, Gewalt in den Medien soll stärker zensiert und Patentrezepte für gewaltfreie Schulen gefunden werden. Solche dramatischen Gewalttaten sind oft Einzelfälle, die für sich genommen natürlich erschreckend sind, aber oftmals dramatisiert in den Medien dargestellt werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Welche Ursachen werden heute für die steigende Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen an Schulen genannt und gibt es in diesem Zusammenhang geschlechtsspezifische Unterschiede?
Vermutlich wird eine völlig gewaltfreie Schule immer eine Illusion bleiben. Die Erkenntnisse aus dem Interventions- und Präventionsprogramm zeigen aber, dass wenn der Wille besteht, Gewalt zu reduzieren, dies in gewissem Umfang möglich ist. Um solche Programme zur Verringerung von Schulgewalt künftig noch wirksamer zu gestalten, bedarf es noch weiterer wissenschaftlicher Arbeit. Besonders die Erforschung der Ursachen für die Gewalt an Schulen muss noch weiter vorangetrieben werden. Nur so können effizientere Gegenmaßnahmen für ein immer bedeutsameres Problem gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schule als Sozialisationsbereich
- Was ist Gewalt?
- Begriffserklärung
- Verständnis und Verbreitung von
- physischer Gewalt und
- psychischer Gewalt im Hinblick auf geschlechtstypische Unterschiede bei unterschiedlichen Schulformen und Jahrgängen
- Kurzes Zwischenfazit
- Konflikte zwischen Schülern und Schülerinnen
- Ursachen und Einflussfaktoren für die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen Geschlechtsspezifische Unterschiede
- Wahrnehmung und Reaktion aus Schüler- und Lehrersicht
- Gewaltprävention nach Dan Olweus
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle der Schule als Sozialisationsbereich im Kontext von Gewalt und beleuchtet geschlechtsspezifische Verhaltensformen. Sie analysiert die Definition von Gewalt, untersucht die Verbreitung und Ursachen von Gewalt in der Schule, und betrachtet die Wahrnehmung von Gewalt aus Schüler- und Lehrersicht.
- Die Schule als Sozialisationsinstanz und ihre Rolle bei der Vermittlung von Werten und Normen
- Begriffserklärung und Analyse von Gewalt im schulischen Kontext
- Untersuchung der Ursachen und Einflussfaktoren für Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung und Reaktion auf Gewalt
- Möglichkeiten der Gewaltprävention
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit, "Schulische Sozialisation und Gewalt", vor und beleuchtet die aktuelle Situation in Deutschland anhand von Statistiken und aktuellen Ereignissen.
- Die Schule als Sozialisationsbereich: Dieses Kapitel beschreibt die Schule als Institution, die eine wichtige Rolle bei der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen spielt. Es untersucht die Bedeutung der Schule für die Vermittlung von Wissen, Werten und Normen sowie die Auswirkungen auf die Entwicklung sozialer Beziehungen.
- Was ist Gewalt?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Gewalt und zeigt unterschiedliche Ansichten und Perspektiven auf den Begriff auf. Es werden die Formen physischer und psychischer Gewalt im Schulkontext beleuchtet.
- Kurzes Zwischenfazit: Dieses Kapitel fasst die wesentlichen Punkte der vorherigen Kapitel zusammen und stellt die Weichen für die weiteren Ausführungen.
- Konflikte zwischen Schülern und Schülerinnen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen und Einflussfaktoren von Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen, insbesondere mit geschlechtsspezifischen Unterschieden. Es werden auch die Perspektiven von Schülern und Lehrern auf Gewalt dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Schulische Sozialisation, Gewalt, Geschlechtsspezifische Verhaltensformen, Gewaltprävention und Pädagogik. Sie analysiert die sozialen und psychologischen Faktoren, die zu Gewalt führen können und beleuchtet die Rolle der Schule bei der Prävention und Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Schule als Sozialisationsbereich?
Die Schule vermittelt nicht nur Wissen, sondern ist eine zentrale Instanz für das Erlernen von Werten, Normen und sozialen Verhaltensweisen im Umgang mit Gleichaltrigen.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei Gewalt an Schulen?
Ja, während Jungen häufiger zu physischer Gewalt neigen, äußert sich Gewalt bei Mädchen oft in psychischer Form, wie sozialer Ausgrenzung oder Mobbing.
Was sind die Ursachen für steigende Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen?
Genannte Ursachen sind unter anderem verletztes Ehrgefühl, mangelnde Perspektiven, Medieneinflüsse und Defizite in der familiären oder schulischen Sozialisation.
Was beinhaltet das Gewaltpräventionsprogramm nach Dan Olweus?
Es ist ein strukturiertes Programm zur Reduzierung von Mobbing, das auf klare Regeln, verstärkte Aufsicht und die Einbeziehung von Lehrern, Eltern und Schülern setzt.
Ist eine völlig gewaltfreie Schule möglich?
Experten halten eine komplett gewaltfreie Schule für eine Illusion, betonen jedoch, dass durch gezielte Prävention das Ausmaß und die Brutalität der Gewalt deutlich reduziert werden können.
- Quote paper
- Linda Weidner (Author), 2006, Schulische Sozialisation und Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64811