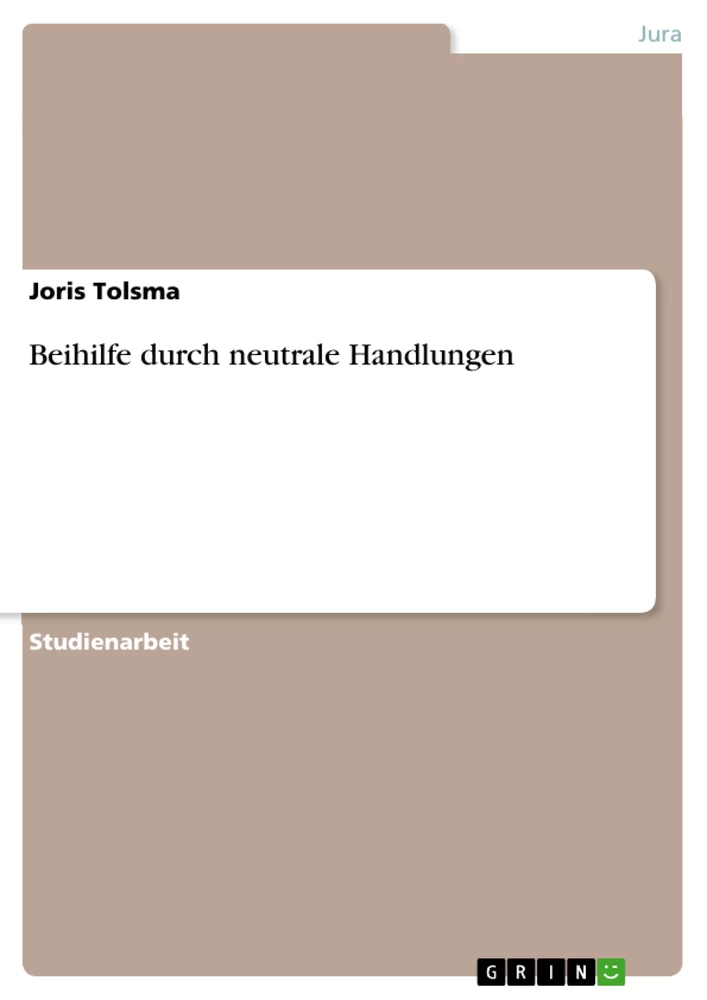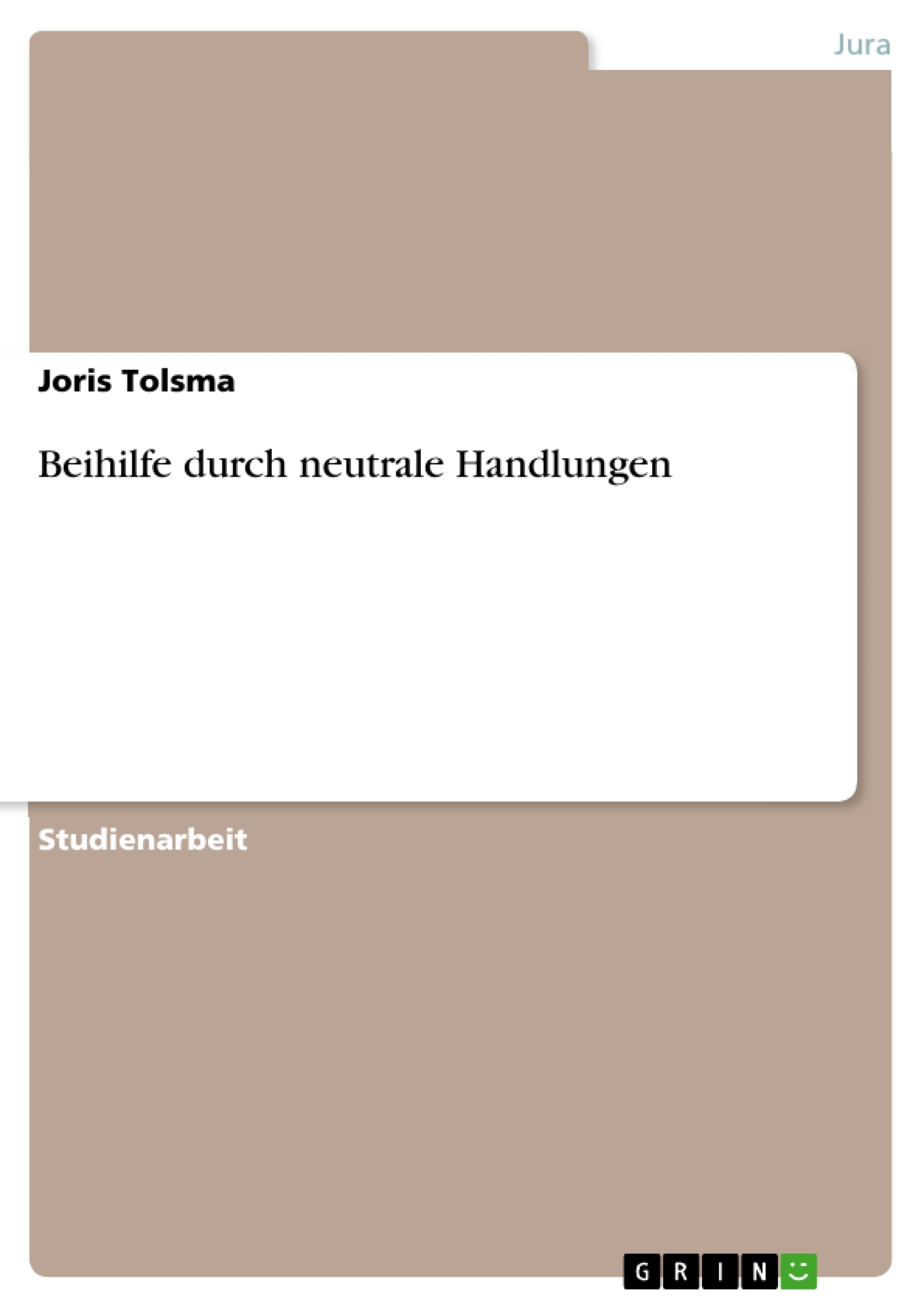Überaus kontrovers ist in den letzten Jahren in der Literatur die Frage diskutiert worden, unter welchen Voraussetzungen die Unterstützung fremder Straftaten durch „neutrale Handlungen“ als strafbare Beihilfe im Sinne des § 27 StGB zu qualifizieren ist. Die Beihilfe wird vom deutschen Gesetzgeber in § 27 Abs. 1 StGB als vorsätzliche Hilfeleistung zu einer tatbestandsmäßig-rechtswidrigen und vorsätzlichen Tat umschrieben. Um einen Einstieg in die Problematik der „neutralen Handlungen“ zu ermöglichen, soll folgender Fall dienen: Ein Naturfreund züchtet Blumen, obgleich er weiß, dass sein Nachbar, ein notorischer Heiratsschwindler, gerade diese Blumen stehlen und als Präsent zu einer Betrügerei ver-wenden wird. Bei schulmäßiger Subsumtion dieses Sachverhaltes gelangt man ohne größere Anstrengung zum Ergebnis der Beihilfestrafbarkeit, wenn die unterstützte Haupttat zumindest in das Versuchsstadium gelangt. Mit Blick auf den an sich alltäglichen Charakter dieser Handlung ist die Frage nach der strafrechtlichen Relevanz der zumindest mit neutralem Anschein versehenen Mitwirkungshand-lung notwendig. Vor dem Hintergrund des Funktionierens einer auf Arbeitsteilung angelegten Gesellschaft, in der ein neutrales Unterstützungsverhalten leicht zu erhalten ist, stellt sich die Frage, ob die uneingeschränkte Einbeziehung solcher „neutraler Handlungen“ in die Beihilfestrafbarkeit zu unangemessenen Ergebnis-sen führt. Ziel dieser Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über den Stand der Diskussion in der Rechtswissenschaft zum Thema „Beihilfe durch neutrale Handlungen“ zu geben. Hierfür wird zunächst die historische Entwicklung der Thematik dargestellt und sodann mögliche Erscheinungsformen „neutraler Hand-lungen“ vorgestellt. Im darauf folgenden Abschnitt wird auf den Strafgrund sowie auf den objektiven und subjektiven Tatbestand der Beihilfe näher eingegangen. Anschließend wird die Rechtsprechung anhand von ausgewählten Fällen darge-stellt und die existierenden Lösungsansätze in der Literatur nachgezeichnet und kritisch gewürdigt. Von der Bearbeitung des Themas „Beihilfe durch neutrale Handlungen“ soll die Problematik der Rechtsauskunft durch einen Anwalt als mögliche Beihilfe ausgeschlossen werden, da diese im Hinblick auf zahlreiche berufs- und verfassungsrechtliche Aspekte eine separate Bearbeitung erfordert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Historische Entwicklung der Thematik „neutraler Handlungen“
- A. Die Diskussion von 1840 bis 1994
- B. Die Diskussion ab 1994
- III. „Neutrale Handlungen“
- A. Formen „neutraler Handlungen“
- a. Gewerblicher Verkauf von Tatmitteln und -werkzeugen
- b. Gewerbliche oder freiberufliche Dienstleistungen
- c. Dienstleistung durch Arbeitnehmer
- B. Begriff
- A. Formen „neutraler Handlungen“
- IV. Die Beihilfe gemäß § 27 Abs. 1 StGB
- A. Strafgrund der Beihilfe
- a. Schuldteilnahmetheorie
- b. Unrechtsteilnahmetheorie
- c. Solidarisierungstheorie
- d. Verursachungstheorien
- aa. Strenge Verursachungstheorie
- bb. Akzessorietätsorientierte Verursachungstheorie
- cc. Theorie vom akzessorischen Rechtsgutsangriff
- B. Objektiver Tatbestand der Beihilfe
- a. Teilnahmefähige Haupttat
- b. „Hilfeleisten“ i.S.d. § 27 Abs. 1 StGB
- aa. Mittel der Beihilfe
- (1) Physische Beihilfe
- (2) Psychische Beihilfe
- bb. Zeitpunkt der Beihilfe
- cc. Kausalität des „Hilfeleistens“ für die Haupttat
- (1) Handlungsförderungstheorie
- (2) Erfolgsförderungstheorie
- (3) Gefährdungstheorien
- aa. Mittel der Beihilfe
- C. Subjektiver Tatbestand der Beihilfe
- A. Strafgrund der Beihilfe
- V. Beurteilung „neutraler Handlungen“ in der Judikatur
- VI. Ansichten zur Beihilfe durch „neutrale Handlungen“ in der Literatur
- VII. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die strafrechtliche Problematik der Beihilfe durch neutrale Handlungen. Ziel ist es, die verschiedenen juristischen Ansätze und Theorien zur Abgrenzung strafbarer von nicht strafbaren Handlungen im Kontext der Beihilfe zu analysieren und zu bewerten.
- Die historische Entwicklung des Begriffs „neutraler Handlungen“ im Strafrecht
- Die verschiedenen Theorien zur Definition und Abgrenzung von Beihilfe
- Die Rolle der Kausalität und des subjektiven Tatbestands bei der Beihilfe
- Die Beurteilung konkreter Fallbeispiele in der Rechtsprechung
- Die unterschiedlichen Ansichten in der Rechtsliteratur zur Beihilfe durch neutrale Handlungen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Diese Einführung legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem sie den Gegenstand der Untersuchung – die Beihilfe durch neutrale Handlungen – präzise definiert und die Forschungsfrage formuliert. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die behandelten Themenkomplexe. Die Einführung dient der notwendigen Kontextualisierung und schafft ein Verständnis der zentralen Problemstellung.
II. Historische Entwicklung der Thematik „neutraler Handlungen“: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Rechtsprechung und Literatur zum Thema „neutrale Handlungen“ im Laufe der Zeit. Es wird die Veränderung der juristischen Meinungen und Ansätze zur Einordnung dieser Handlungen im Kontext des Beihilfetatbestands nachvollzogen, von den Anfängen bis zur aktuellen Diskussion. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des juristischen Denkens und der Begründung unterschiedlicher Positionen.
III. „Neutrale Handlungen“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und verschiedenen Formen „neutraler Handlungen“. Es werden Beispiele für gewerbliche Verkäufe, Dienstleistungen und die Handlungen von Arbeitnehmern analysiert und anhand der gegebenen Definitionen eingeordnet. Die Unterscheidung zwischen neutralen Handlungen und solchen, die Beihilfe darstellen, wird systematisch erörtert.
IV. Die Beihilfe gemäß § 27 Abs. 1 StGB: Dieses Kapitel analysiert den Tatbestand der Beihilfe gemäß § 27 Abs. 1 StGB detailliert. Es werden die verschiedenen Theorien zum Strafgrund der Beihilfe, der objektive und subjektive Tatbestand und deren Bedeutung für die Beurteilung neutraler Handlungen im Detail erläutert. Die unterschiedlichen Verursachungstheorien werden umfassend verglichen.
V. Beurteilung „neutraler Handlungen“ in der Judikatur: In diesem Kapitel werden relevante Gerichtsurteile ("Bordell-Fall", "Gift-Fall", "Warentermin-Fall", "Steuerhinterziehungs-Fall", "Unerlaubter Aufenthalts-Fall") analysiert und ihre Auswirkungen auf die Rechtsprechung zur Beihilfe durch neutrale Handlungen dargestellt. Die Unterschiede in den Urteilen und ihre Begründung werden im Detail untersucht.
VI. Ansichten zur Beihilfe durch „neutrale Handlungen“ in der Literatur: Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen in der Literatur vertretenen Ansichten zur Beihilfe durch neutrale Handlungen. Es analysiert und vergleicht die Theorien der Sozialadäquanz, der professionellen Adäquanz, sowie gemischt subjektiv-objektive Theorien verschiedener Autoren (Schumann, Jakobs, Puppe, Frisch, Roxin, Meyer-Arndt, Otto). Die Stärken und Schwächen der einzelnen Theorien werden kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Beihilfe, neutrale Handlungen, § 27 Abs. 1 StGB, Schuldteilnahme, Unrechtsteilnahme, Verursachungstheorien, Kausalität, Objektiver Tatbestand, Subjektiver Tatbestand, Rechtsprechung, Rechtsliteratur, Sozialadäquanz, Professionelle Adäquanz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Beihilfe durch neutrale Handlungen
Was ist der Gegenstand der Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die strafrechtliche Problematik der Beihilfe durch neutrale Handlungen. Sie analysiert und bewertet verschiedene juristische Ansätze und Theorien zur Abgrenzung strafbarer von nicht strafbaren Handlungen in diesem Kontext.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Begriffs „neutraler Handlungen“, verschiedene Theorien zur Definition und Abgrenzung von Beihilfe, die Rolle der Kausalität und des subjektiven Tatbestands, die Beurteilung konkreter Fallbeispiele in der Rechtsprechung und die unterschiedlichen Ansichten in der Rechtsliteratur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einführung, historische Entwicklung der Thematik „neutraler Handlungen“, Definition und Formen „neutraler Handlungen“, die Beihilfe gemäß § 27 Abs. 1 StGB, Beurteilung „neutraler Handlungen“ in der Judikatur, Ansichten zur Beihilfe durch „neutrale Handlungen“ in der Literatur und Resümee.
Welche Theorien zur Beihilfe werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Theorien zum Strafgrund der Beihilfe, darunter die Schuldteilnahmetheorie, die Unrechtsteilnahmetheorie, die Solidarisierungstheorie und verschiedene Verursachungstheorien (strenge Verursachungstheorie, akzessorietätsorientierte Verursachungstheorie, Theorie vom akzessorischen Rechtsgutsangriff). Im Kontext der Literatur werden Theorien der Sozialadäquanz, der professionellen Adäquanz, sowie gemischt subjektiv-objektive Theorien verschiedener Autoren (Schumann, Jakobs, Puppe, Frisch, Roxin, Meyer-Arndt, Otto) untersucht.
Welche Fallbeispiele werden in der Judikatur betrachtet?
Die Arbeit analysiert relevante Gerichtsurteile zu neutralen Handlungen im Kontext der Beihilfe, darunter (jedoch nicht ausschließlich) "Bordell-Fall", "Gift-Fall", "Warentermin-Fall", "Steuerhinterziehungs-Fall" und "Unerlaubter Aufenthalts-Fall".
Welche Autoren werden in der Literaturanalyse berücksichtigt?
Die Literaturanalyse berücksichtigt die Ansichten verschiedener Autoren wie Schumann, Jakobs, Puppe, Frisch, Roxin, Meyer-Arndt und Otto zu Beihilfe durch neutrale Handlungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Beihilfe, neutrale Handlungen, § 27 Abs. 1 StGB, Schuldteilnahme, Unrechtsteilnahme, Verursachungstheorien, Kausalität, Objektiver Tatbestand, Subjektiver Tatbestand, Rechtsprechung, Rechtsliteratur, Sozialadäquanz, Professionelle Adäquanz.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen juristischen Ansätze und Theorien zur Abgrenzung strafbarer von nicht strafbaren Handlungen im Kontext der Beihilfe zu analysieren und zu bewerten.
- Citation du texte
- Joris Tolsma (Auteur), 2006, Beihilfe durch neutrale Handlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64827