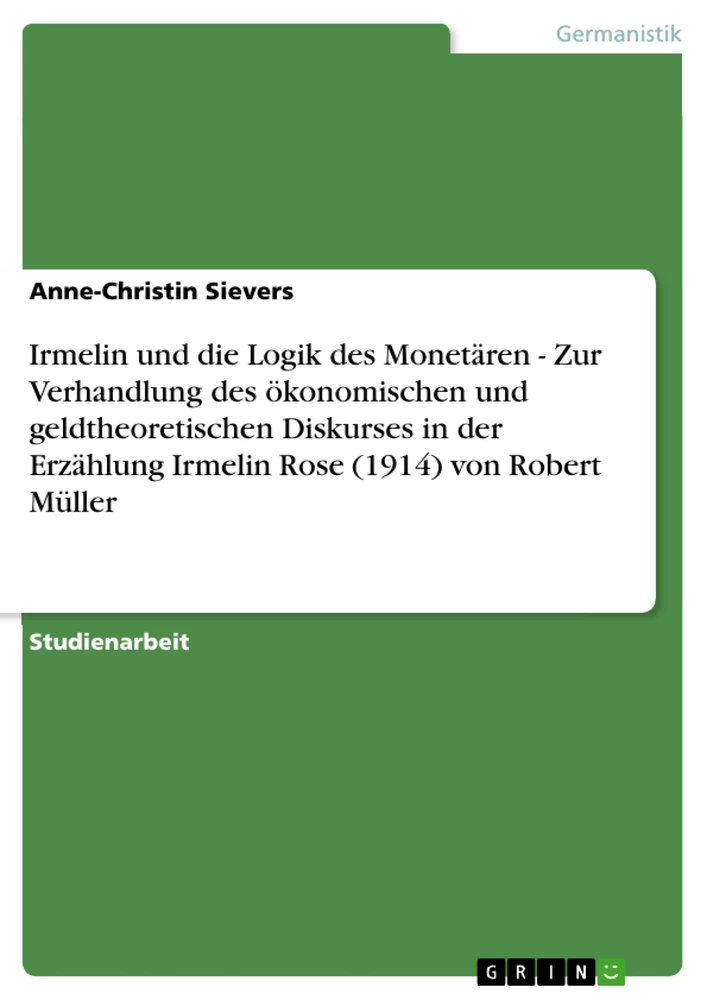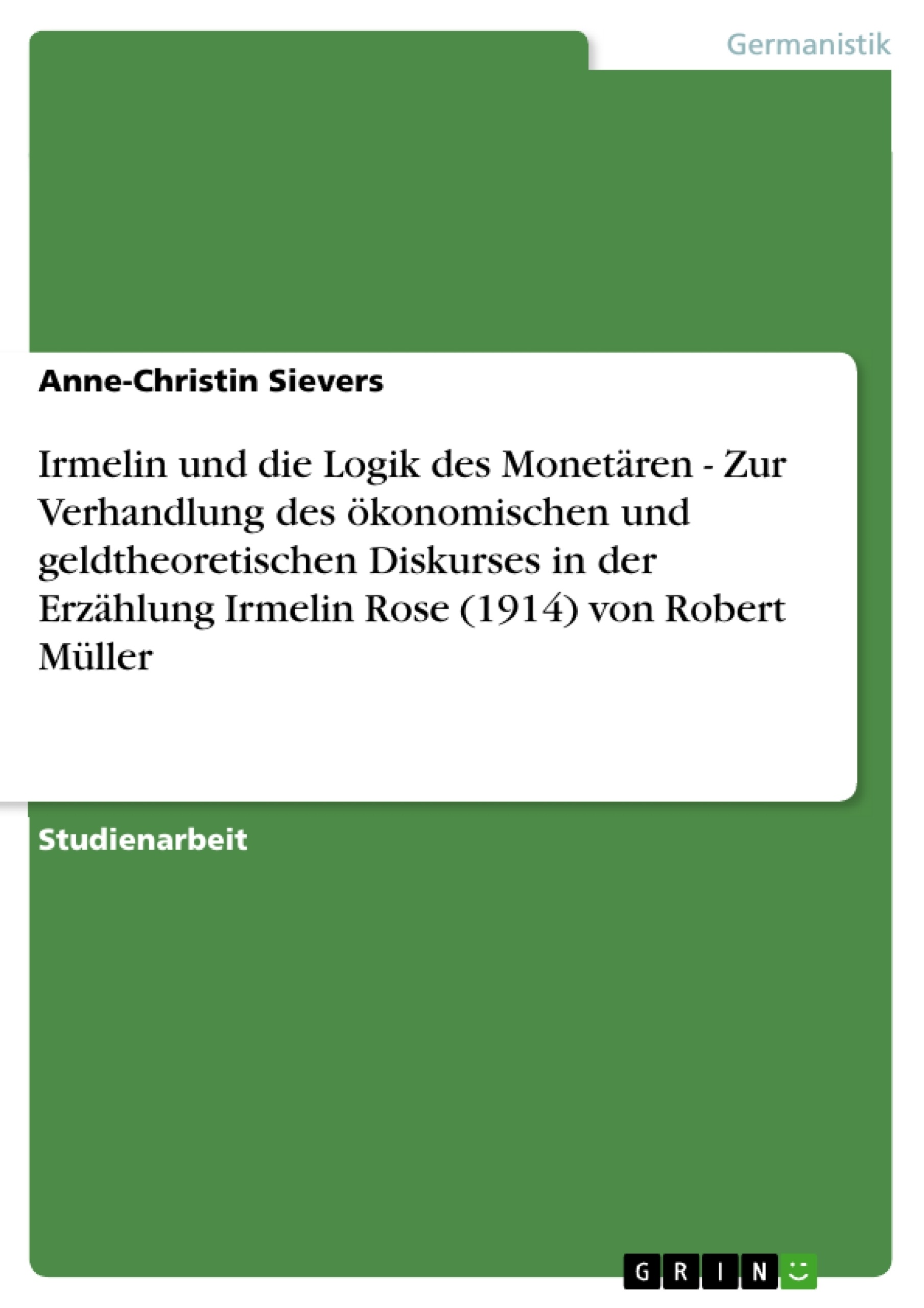Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich in Anlehnung an den Aufsatz von Robert Matthias Erdbeer Der Einkaufsbummel als Horrortrip den höchst enigmatischen Text Irmelin Rose (1914) von Robert Müller durch die Verwendung eines diskurstheoretischen Interpretationsansatzes erhellen. Jedoch soll im Gegensatz zum Ansatz Erdbeers nicht der ‚Schaufenster-Diskurs’ des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts für die Analyse herangezogen 1 , sondern der Versuch unternommen werden, die Verarbeitung der ökonomischen und geldtheoretischen Diskurse der Jahrhundertwende in der Erzählung aufzuzeigen. Dabei stehen die Fragen im Mittelpunkt, wie die Erzählung den ökonomischen Diskurs nutzt, um ihrer eigene Poetologie und die Krise der Sprache in der Moderne zu reflektieren, und wie dieser das Erzählverfahren des Textes, seine Semiotik, seine Metaphorik und seine Struktur verändert. Zunächst werde ich in einem methodologischen Abschnitt die theoretischen Voraussetzungen eines Vergleichs zwischen literarischem und ökonomischem Diskurs erläutern. Nach einem kurzen Exkurs über Robert Müllers Verhältnis zum ökonomischen Raum der Großstadt widmet sich die Arbeit der Analyse der Erzählung und dem darin hervortretenden geldtheoretischen Diskurs der Jahrhundertwende am Beispiel der Philosophie des Geldes (1900) von Georg Simmel. Einer Einführung in Simmels Hauptwerk folgend, werden die Bezüge zwischen der Erzählung und dem monetären und ökonomischen Diskurs in drei Schritten herausgearbeitet. In einem ersten Schritt interpretiert die Untersuchung Irmelins Einkaufsverhalten und Verhältnis zu den Dingen als Ausdruck der Logik des Monetären. Es wird die These aufgestellt, dass Irmelin selbst als Verkörperung des Prinzips des Geldes als unendliche Möglichkeit gelesen werden kann, das zu einer Rastlosigkeit des Begehrens führt. Jedoch erscheint Irmelin durch ihre fehlende Distanz zu den Dingen und damit durch ihre Unfähigkeit zu einer ökonomischen Wertung als Fremdkörper des geldwirtschaftlichen Systems. In einem zweiten Schritt wird auf die Bedeutung von Irmelins Tod und dessen Beziehung zum ökonomischen System eingegangen und die Frage erörtert, ob sich der Tod in der Erzählung als unverrechenbare Individualität dem ökonomischen System entzieht oder ob er in dieses eingebunden ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodologische Vorbemerkungen: Zum Verhältnis von Ökonomie und Literatur
- Analyse der Erzählung Irmelin Rose
- Die Logik des Monetären
- Tausch und Tod
- Poetologische Reflexion des ökonomischen Diskurses
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Robert Müllers Erzählung "Irmelin Rose" (1914) unter Anwendung eines diskurstheoretischen Ansatzes. Ziel ist es, die Verarbeitung ökonomischer und geldtheoretischer Diskurse der Jahrhundertwende in der Erzählung aufzuzeigen und deren Einfluss auf die Poetologie, das Erzählverfahren, die Semiotik, Metaphorik und Struktur des Textes zu analysieren. Es wird untersucht, wie die Erzählung den ökonomischen Diskurs nutzt, um die Krise der Sprache in der Moderne zu reflektieren.
- Die Logik des Monetären in "Irmelin Rose"
- Das Verhältnis von Tod und ökonomischem System in der Erzählung
- Die poetologische Reflexion des ökonomischen Diskurses in Müllers Werk
- Der Vergleich literarischer und ökonomischer Diskurse
- Die Anwendung des New Historicism und New Economic Criticism auf literarische Texte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, Robert Müllers "Irmelin Rose" durch einen diskurstheoretischen Ansatz zu interpretieren. Im Fokus steht die Analyse der Verarbeitung ökonomischer und geldtheoretischer Diskurse der Jahrhundertwende und deren Einfluss auf die poetischen Mittel der Erzählung. Es wird angekündigt, dass die Arbeit zunächst methodologische Vorbemerkungen liefert, bevor sie sich der Analyse der Erzählung und dem darin hervortretenden geldtheoretischen Diskurs widmet, unter Bezugnahme auf Georg Simmels "Philosophie des Geldes".
Methodologische Vorbemerkungen: Zum Verhältnis von Ökonomie und Literatur: Dieses Kapitel etabliert die theoretische Grundlage für den Vergleich literarischer und ökonomischer Diskurse. Es argumentiert gegen die traditionelle Trennung beider Disziplinen und plädiert für einen Dialog, basierend auf einem semiotischen Kulturbegriff, der ökonomische und literarische Phänomene als Texte begreift. Der New Historicism wird als methodischer Ansatz eingeführt, der die Einbettung literarischer Texte in den umfassenderen Kontext historischer, philosophischer und ökonomischer Diskurse betont. Weiterhin wird der New Economic Criticism vorgestellt, der die Ökonomie als diskursiv geformte Kulturwissenschaft begreift und die Rolle von Metaphern und Narrativen in der ökonomischen Theorie analysiert. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, die Ökonomie als diskursiv konstruierte Wissenschaft zu verstehen und nicht als objektive Naturwissenschaft.
Schlüsselwörter
Irmelin Rose, Robert Müller, Ökonomischer Diskurs, Geldtheorie, Georg Simmel, Philosophie des Geldes, New Historicism, New Economic Criticism, Moderne, Poetologie, Sprache, Diskursanalyse, Monetäres System, Tausch, Tod.
Häufig gestellte Fragen zu Robert Müllers "Irmelin Rose"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert Robert Müllers Erzählung "Irmelin Rose" (1914) unter Anwendung eines diskurstheoretischen Ansatzes. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Verarbeitung ökonomischer und geldtheoretischer Diskurse der Jahrhundertwende und deren Einfluss auf die Poetologie, das Erzählverfahren, die Semiotik, Metaphorik und Struktur des Textes.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen diskurstheoretischen Ansatz, der den New Historicism und den New Economic Criticism integriert. Sie betrachtet ökonomische und literarische Phänomene als Texte und betont die Einbettung literarischer Texte in den umfassenderen Kontext historischer, philosophischer und ökonomischer Diskurse. Die Ökonomie wird als diskursiv konstruierte Wissenschaft verstanden, nicht als objektive Naturwissenschaft.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht die "Logik des Monetären" in "Irmelin Rose", das Verhältnis von Tod und ökonomischem System, die poetologische Reflexion des ökonomischen Diskurses in Müllers Werk, den Vergleich literarischer und ökonomischer Diskurse und die Anwendung des New Historicism und New Economic Criticism auf literarische Texte. Ein zentraler Aspekt ist die Reflexion der Krise der Sprache in der Moderne durch den ökonomischen Diskurs in der Erzählung.
Welche Rolle spielt Georg Simmel?
Die Arbeit bezieht sich auf Georg Simmels "Philosophie des Geldes", um den geldtheoretischen Diskurs in "Irmelin Rose" zu analysieren und zu interpretieren. Simmels Werk dient als theoretischer Bezugsrahmen für die Untersuchung der ökonomischen Aspekte in der Erzählung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, methodologische Vorbemerkungen zum Verhältnis von Ökonomie und Literatur, eine Analyse der Erzählung "Irmelin Rose" (unterteilt in die Logik des Monetären, Tausch und Tod, sowie die poetologische Reflexion des ökonomischen Diskurses) und einen Schluss. Die Einleitung skizziert die Zielsetzung und den methodischen Ansatz. Die methodologische Vorbemerkung etabliert die theoretische Grundlage des Vergleichs literarischer und ökonomischer Diskurse. Die Analyse von "Irmelin Rose" bildet den Kern der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Irmelin Rose, Robert Müller, Ökonomischer Diskurs, Geldtheorie, Georg Simmel, Philosophie des Geldes, New Historicism, New Economic Criticism, Moderne, Poetologie, Sprache, Diskursanalyse, Monetäres System, Tausch, Tod.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, aufzuzeigen, wie ökonomische und geldtheoretische Diskurse der Jahrhundertwende in Robert Müllers "Irmelin Rose" verarbeitet werden und welchen Einfluss dies auf die poetischen Mittel der Erzählung hat. Es geht darum, die Interaktion zwischen ökonomischem Diskurs und literarischer Gestaltung zu analysieren und die Krise der Sprache in der Moderne im Kontext dieser Interaktion zu beleuchten.
- Quote paper
- Anne-Christin Sievers (Author), 2006, Irmelin und die Logik des Monetären - Zur Verhandlung des ökonomischen und geldtheoretischen Diskurses in der Erzählung Irmelin Rose (1914) von Robert Müller , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64882