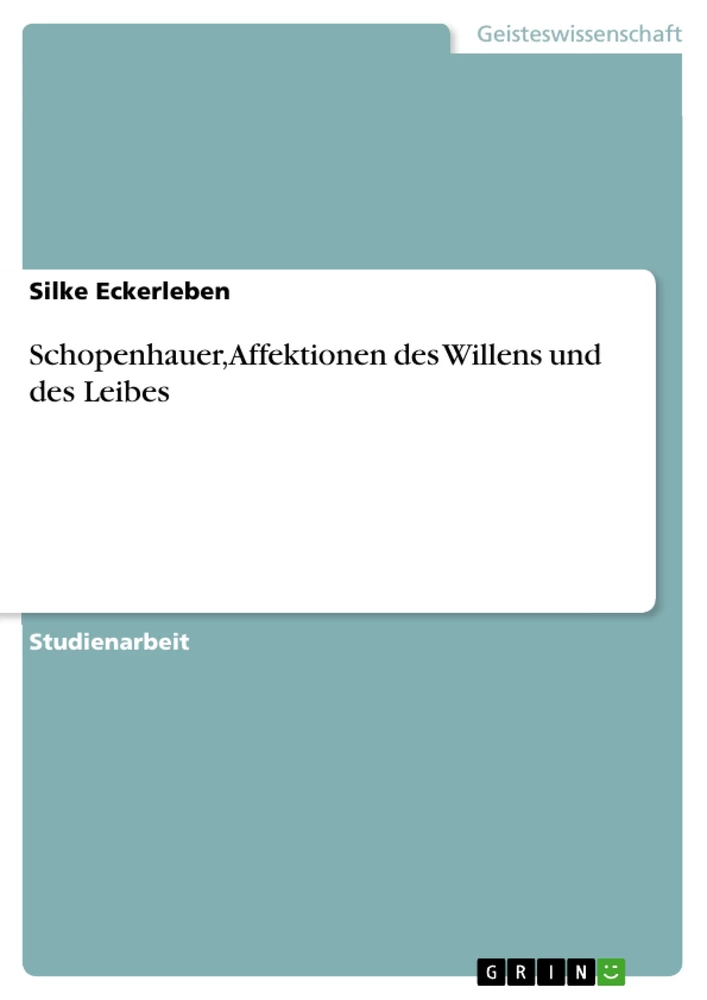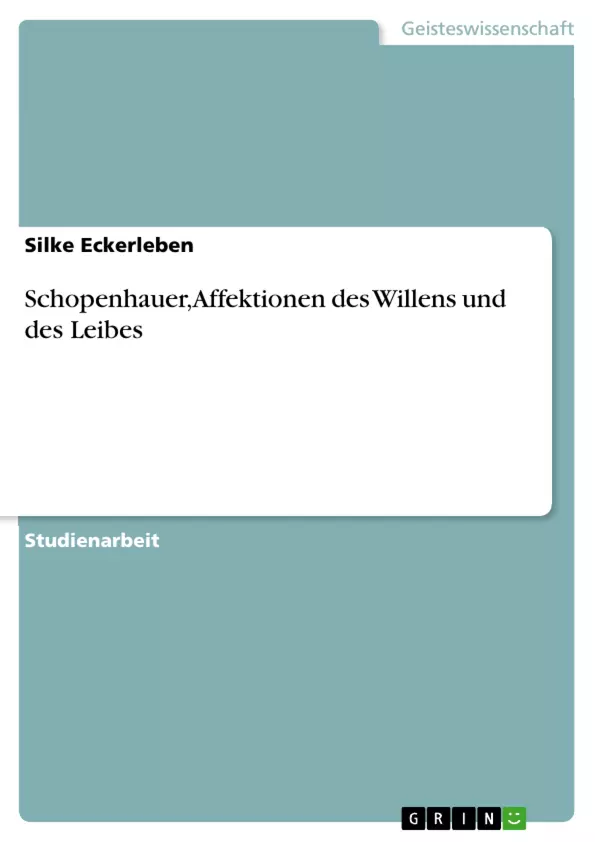1. Einleitung
Im zweiten Buch seines Werkes „Die Welt als Wille und Vorstellung“ betrachtet Arthur Schopenhauer die Vorstellung nicht mehr auf abstrakte Weise, wie er es im ersten Buch getan hat, sondern untersucht sie auf ihren Inhalt, versucht die Bedeutung der Vorstellung, der Objekte, zu verstehen. Dieser Frage versucht er mit Hilfe der Mathematik und der Naturwissenschaften auf den Grund zu gehen. Das Problem hierbei ist allerdings, dass diese Wissenschaften immer nur Relationen zwischen Objekten angeben können. Sie können niemals die wirkliche Bedeutung der Objekte aufzeigen. Durch Beobachtungen können also Gesetzmäßigkeiten erkannt werden, jedoch der Grund für diese Gesetzmäßigkeiten bleibt verborgen, da der Mensch diesen Objekten nur gegenübersteht, ihr inneres Wesen also nicht begreifen kann. Nun ist jedem Menschen aber ein Objekt gegeben, dem er nicht bloß gegenübersteht, sondern mit dem er verbunden ist: das unmittelbare Objekt, der Leib. Dadurch ist der Mensch Teil dieser Welt als Vorstellung, betrachtet sie nicht nur von außen, sondern „wurzelt […] in jener Welt“ (S.156/157 ). Das erkennende Subjekt und der Leib bilden gemeinsam das Individuum. Dadurch besteht für den Menschen die Möglichkeit, sich die Bedeutung von Objekten zu erschließen, indem das Individuum die Bedeutung des eigenen Leibes enträtselt. Und dies zu tun ist er imstande aufgrund des Willens, der ihm „den Schlüssel zu seiner eigenen Erscheinung“ (S. 157) gibt. Dieser Wille drückt sich aus in jeder Bewegung des Individuums, die Bewegungen des Leibes sind der so genannte objektivierte, in Erscheinung getretene Wille.
Schopenhauer erklärt im Zweiten Buch, dass also nicht nur jede Bewegung des Leibes, sondern der ganze Leib selbst nichts anderes sei als objektivierter Wille. Daher verwendet er statt des Begriffs des unmittelbaren Objekts in diesem Buch den Begriff Objektität des Willens. Er behauptet weiter, dass nun auch die „auf bloße Reize erfolgenden, unwillkürlichen“ Bewegungen des Leibes als objektivierter Wille anzusehen seien. Dies erscheint auf den ersten Blick sehr fragwürdig, da dies ja keine Bewegungen sind, von denen ein Mensch sagen würde, dass er sie wirklich will, sondern dass sie einfach geschehen. Des Weiteren schließt er im Folgenden einige Eindrücke auf den Leib aus diesen Affektionen des Willens aus: [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Willens
- Identität von Leib und Wille
- Kritik
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen Affektionen des Willens und des Leibes in Schopenhauers „Die Welt als Wille und Vorstellung“. Im Fokus steht die Frage, wie Schopenhauer den Willen als das „Ding an sich“ definiert und wie er die Identität von Leib und Willen begründet. Dabei werden die Begrenztheit des menschlichen Wissens und die Rolle des unmittelbaren Objekts, des Leibes, analysiert.
- Die Bedeutung des Willens als „Ding an sich“ nach Schopenhauer
- Die Verbindung von Leib und Wille als Ausdruck des Willens
- Die Kritik an Schopenhauers Argumentation hinsichtlich der Affektionen des Willens und des Leibes
- Die Rolle des unmittelbaren Objekts, des Leibes, für die Erkenntnis des Willens
- Die philosophische Wahrheit als unmittelbare Erkenntnis der Identität von Leib und Willen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor, die besagt, dass Schopenhauer die eigene Theorie in Bezug auf Affektionen des Willens und des Leibes nicht konsequent verfolgt. Sie erläutert, dass Schopenhauer den Willen als die Grundlage für die Erkenntnis der Welt betrachtet, die durch die Verbindung von Leib und Subjekt ermöglicht wird.
- Der Begriff des Willens: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Willens nach Schopenhauer und grenzt ihn vom allgemeinen Verständnis ab. Es wird deutlich, dass der Wille bei Schopenhauer nicht mit rationalem Streben oder bewusstem Handeln gleichzusetzen ist, sondern als das "Ding an sich" verstanden werden muss, das sich in den Aktionen des Leibes manifestiert.
- Identität von Leib und Wille: Dieses Kapitel erläutert die These Schopenhauers, dass Leib und Wille identisch sind. Jede Aktion des Leibes ist demnach ein Ausdruck des Willens. Schopenhauer argumentiert, dass diese Identität zwar nicht bewiesen werden kann, jedoch durch unmittelbare Erfahrung nachgewiesen werden kann.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf zentrale Begriffe und Konzepte aus Schopenhauers Philosophie, darunter: Wille als "Ding an sich", Leib und Wille, Affektionen des Willens, unmittelbares Objekt, objektivierter Wille, philosophische Wahrheit, Motiv, Erscheinung des Willens, Satz vom Grunde.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Schopenhauer unter dem „Willen“?
Der Wille ist bei Schopenhauer das „Ding an sich“, das innere Wesen der Welt, das sich in allen Erscheinungen, insbesondere im menschlichen Leib, manifestiert.
Wie hängen Leib und Wille zusammen?
Schopenhauer behauptet eine Identität von Leib und Wille: Jede Bewegung des Körpers ist ein objektivierter Willensakt, der für das Subjekt unmittelbar erfahrbar ist.
Warum ist der Leib das „unmittelbare Objekt“?
Im Gegensatz zu äußeren Objekten, die wir nur als Vorstellung wahrnehmen, sind wir mit unserem Leib direkt verbunden, was uns den Schlüssel zum Verständnis unseres Wesens gibt.
Sind auch unwillkürliche Körperfunktionen „Wille“?
Ja, Schopenhauer zählt auch Reize und unwillkürliche Bewegungen zur Objektität des Willens, was in der Arbeit jedoch kritisch hinterfragt wird.
Was ist die zentrale Kritik an Schopenhauers Theorie in dieser Arbeit?
Die Arbeit problematisiert, dass Schopenhauer seine Theorie der Affektionen nicht konsequent verfolgt, indem er bestimmte Eindrücke auf den Leib wieder aus der Definition des Willens ausschließt.
- Arbeit zitieren
- Silke Eckerleben (Autor:in), 2006, Schopenhauer, Affektionen des Willens und des Leibes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64905