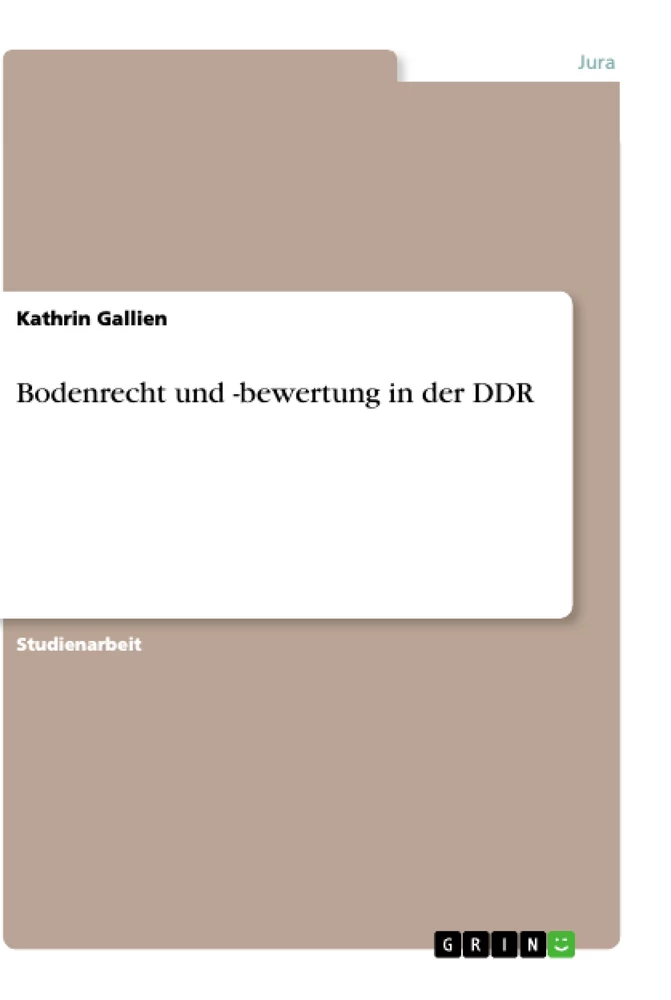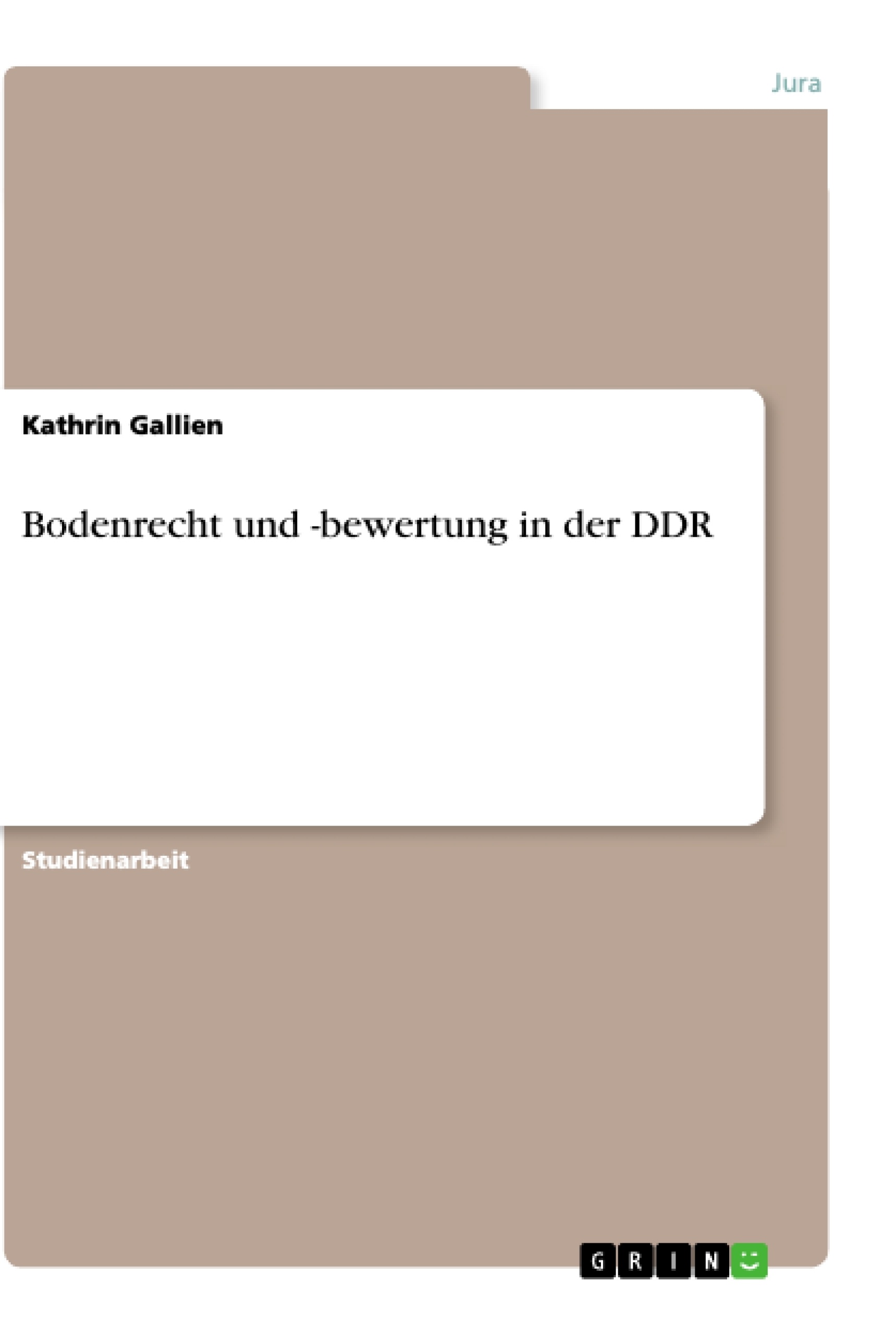Das Thema der vorliegenden Hauptseminararbeit soll Aufschluss über die Bodenordnung und Bodenpolitik der ehemaligen DDR geben. Die Stellung von Grund und Boden in der DDR ist eine andere als in der BRD oder anderen westeuropäischen Staaten. Grund dafür ist das politische System, welches sich am Vorbild der ehemaligen Sowjetunion orientierte. Mit der Spaltung des ehemaligen Deutschen Reiches nach Kriegsende 1945 in vier Besatzungszonen, war der Grundstein für die DDR gelegt. Die sowjetische Besatzungszone, die später DDR wurde, wurde durch ihre Besatzer politisch und gesellschaftlich geprägt, kontrolliert und bis zur Gründung der DDR auch regiert.
Viele Verordnungen und Gesetze orientierten sich am System des „großen Bruders“. Eine freie Marktwirtschaft, demokratisch freie Wahlen, ein Mehrparteiensystem und die freie Verkehrsfähigkeit von Grund und Boden waren in der DDR nicht gewollt und nicht existent. Aufgrund des immensen Umfangs des betreffenden Themas, werden in dieser wissenschaftlichen Arbeit nur ausgewählte Inhalte bzgl. des Bodenrechtes und der Bodenbewertung erörtert. Mit freundlicher Unterstützung der Kommunalen Bewertungsstelle in Halle war es möglich das Kapitel der Bewertung von Grund und Boden in der DDR genauer darzustellen.
Im wesentlichen soll erreicht werden, dass der interessierte Leser einen Überblick über Grundsätze der Bodenpolitik der DDR bekommt. Es werden vorrangig die rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Bürger im Zusammenhang mit der Bodennutzung erörtert. Das öffentliche Bodenrecht wurde nicht behandelt. Über diesen Teil des Bodenrechtes gibt es kaum Literatur. Einschlägige Rechtsnormen hierzu sind nach der Wende sang und klanglos verschwunden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Entstehungsgeschichte der DDR
- 2. Der Eigentumsbegriff in der DDR
- 3. Die Entwicklung des Bodenrechts
- 3.1. Die Bodenreform
- 3.2. Nutzung von Volkseigentum an Grund und Boden
- 3.3. Das LPG-Nutzungsrecht
- 3.4. Die Belastbarkeit von Grundstücken
- 3.4.1. Grundpfandrechte in der DDR
- 3.4.2. Gebäudeeigentum und Miteigentumsanteil
- 4. Bodenrecht der DDR 1989/1990
- 4.1. Gesetz über den Verkauf volkseigener Grundstücke
- 4.2. Das Treuhandgesetz
- 4.3. Veränderungen im wohnungswirtschaftlichen Sektor
- 4.4. Bodenreformgesetz
- 4.5. Landwirtschaftsanpassungsgesetz
- 5. Bodenbewertung in der DDR
- 5.1. Rahmenbedingungen für die Wertermittlung in der DDR
- 5.2. Inhalt der Preisverfügung Nr. 3/87
- 5.3. Die Wertermittlungsverfahren in der DDR
- 5.3.1. Das DDR-Sachwertverfahren
- 5.3.2. Das DDR-Ertragswertverfahren
- 5.4. Die Wertermittlungsverfahren im Ost-West-Vergleich
- 6. Die Bodenbewertung in der DDR 1989/1990
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Bodenrechts und der Bodenbewertung in der DDR. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Methoden der Wertermittlung im Kontext der sozialistischen Planwirtschaft zu geben und die Veränderungen im Zuge der Wiedervereinigung aufzuzeigen.
- Entstehung und Entwicklung des Bodenrechts in der DDR
- Der Eigentumsbegriff und seine Ausprägung im sozialistischen System
- Methoden der Bodenbewertung in der DDR und deren Vergleich zum westdeutschen System
- Rechtliche und wirtschaftliche Veränderungen im Bodenrecht nach 1989/1990
- Die Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Transformation auf den Umgang mit Grund und Boden
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Diese Einleitung dient als Einführung in das Thema Bodenrecht und -bewertung in der DDR und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
1. Die Entstehungsgeschichte der DDR: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Hintergründe der DDR, die Entstehung des Staates und die damit verbundenen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, die das Bodenrecht maßgeblich prägten. Es setzt den Kontext für die folgenden Kapitel.
2. Der Eigentumsbegriff in der DDR: Das Kapitel analysiert den in der DDR geltenden Eigentumsbegriff, der sich grundlegend vom westlichen Verständnis unterschied. Es wird der Unterschied zwischen Volkseigentum und persönlichem Eigentum erläutert und die damit verbundenen rechtlichen Implikationen für den Umgang mit Grund und Boden dargestellt.
3. Die Entwicklung des Bodenrechts: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Bodenrechts in der DDR von der Bodenreform bis zum Ende der DDR. Es werden die verschiedenen Rechtsnormen und -praktiken erläutert, die die Nutzung und Belastung von Grundstücken regelten, einschließlich der Rolle von LPGs und des Volkseigentums.
4. Bodenrecht der DDR 1989/1990: Dieses Kapitel fokussiert auf die tiefgreifenden Veränderungen des Bodenrechts im Zuge der Wiedervereinigung. Es analysiert die Einführung neuer Gesetze und Regelungen, wie das Treuhandgesetz und das Bodenreformgesetz, und deren Auswirkungen auf die Eigentumsverhältnisse und die Bodenordnung.
5. Bodenbewertung in der DDR: Dieses Kapitel widmet sich den Methoden der Bodenbewertung in der DDR. Es werden die spezifischen Verfahren, wie das Sachwert- und das Ertragswertverfahren, detailliert beschrieben und im Vergleich zum westdeutschen System betrachtet. Der Einfluss der planwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf die Wertermittlung wird analysiert.
6. Die Bodenbewertung in der DDR 1989/1990: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen und Veränderungen der Bodenbewertung nach der Wende, im Kontext der Privatisierung und des Übergangs zur Marktwirtschaft. Es beleuchtet die Anpassungen der Bewertungsmethodik und die neuen Rahmenbedingungen.
Schlüsselwörter
Bodenrecht, Bodenbewertung, DDR, Volkseigentum, Treuhandanstalt, Bodenreform, LPG, Wertermittlungsverfahren, Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren, Wiedervereinigung, Eigentumsverhältnisse, Planwirtschaft, Marktwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Bodenrecht und der Bodenbewertung in der DDR
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Bodenrecht und die Bodenbewertung in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Bodenrechts von der Gründung der DDR bis zur Wiedervereinigung, einschließlich der Eigentumsverhältnisse, der Bewertungsmethodik und der rechtlichen und wirtschaftlichen Veränderungen nach 1989/1990.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entstehungsgeschichte des Bodenrechts in der DDR, der spezifische Eigentumsbegriff im sozialistischen System (Volkseigentum), die Entwicklung des Bodenrechts über die Zeit (einschließlich Bodenreform und LPG-Nutzungsrecht), die Methoden der Bodenbewertung (Sachwert- und Ertragswertverfahren) im Vergleich zum westdeutschen System, die rechtlichen Veränderungen nach der Wiedervereinigung (Treuhandgesetz, Bodenreformgesetz), und die Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Transformation auf den Umgang mit Grund und Boden.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und der Entstehungsgeschichte der DDR. Es folgt eine detaillierte Analyse des Eigentumsbegriffs und der Entwicklung des Bodenrechts. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bodenbewertung in der DDR, inklusive der Beschreibung der angewandten Verfahren und eines Vergleichs mit Westdeutschland. Die letzten Kapitel befassen sich mit den Veränderungen im Bodenrecht und der Bodenbewertung nach 1989/1990 im Kontext der Wiedervereinigung.
Welche Methoden der Bodenbewertung wurden in der DDR angewendet?
In der DDR wurden hauptsächlich das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren zur Bodenbewertung angewendet. Das Dokument beschreibt diese Verfahren im Detail und vergleicht sie mit den Methoden, die in Westdeutschland verwendet wurden. Die Unterschiede resultieren aus den unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Systemen.
Wie unterschied sich der Eigentumsbegriff in der DDR vom westlichen Verständnis?
Der Eigentumsbegriff in der DDR unterschied sich grundlegend vom westlichen Verständnis. Das Konzept des Volkseigentums spielte eine zentrale Rolle, wobei der Staat der Eigentümer von Grund und Boden war. Persönliches Eigentum existierte zwar, war aber stark eingeschränkt und unterlag den Vorgaben der sozialistischen Planwirtschaft. Das Dokument analysiert diesen Unterschied und seine Auswirkungen auf das Bodenrecht.
Welche Rolle spielte die Bodenreform in der DDR?
Die Bodenreform spielte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Bodenrechts in der DDR. Sie war ein zentraler Bestandteil der sozialistischen Umgestaltung und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Eigentumsverhältnisse und die Landnutzung. Das Dokument beleuchtet die Bedeutung der Bodenreform im Kontext der Entstehung des DDR-Bodenrechts.
Welche Veränderungen gab es im Bodenrecht nach der Wiedervereinigung?
Nach der Wiedervereinigung erfuhr das Bodenrecht der DDR tiefgreifende Veränderungen. Das Treuhandgesetz und das Bodenreformgesetz spielten dabei eine zentrale Rolle. Diese Gesetze regelten die Privatisierung von Volkseigentum und die Anpassung des Bodenrechts an die Bedingungen der Marktwirtschaft. Das Dokument analysiert diese Veränderungen und deren Auswirkungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments prägnant beschreiben, sind: Bodenrecht, Bodenbewertung, DDR, Volkseigentum, Treuhandanstalt, Bodenreform, LPG, Wertermittlungsverfahren, Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren, Wiedervereinigung, Eigentumsverhältnisse, Planwirtschaft, Marktwirtschaft.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Gallien (Autor:in), 2006, Bodenrecht und -bewertung in der DDR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64906